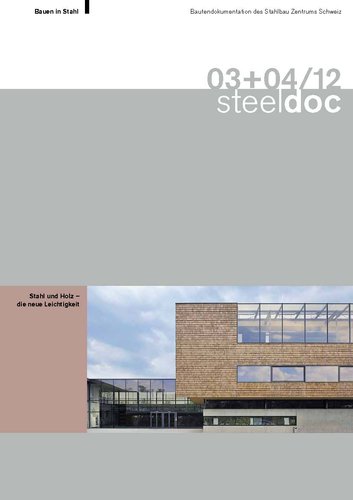Editorial
So unterschiedlich Stahl und Holz als Materialien sind, so komplementär verhalten sie sich im Verbund. Gerade diese Unterschiedlichkeit macht die Stärke der Hybridbauweise in Stahl und Holz aus. während Stahl mit schlanken Tragelementen grosse Spannweiten überbrückt und wirtschaftliche Verbindungen schafft, wirkt Holz in der Fläche als Decken- oder Wandelement und spielt hier seine Vorteile aus. Mit dieser Kombination beider Bauweisen sind die Schwachstellen der jeweiligen anderen praktisch aus dem Weg geschafft. Es entstehen filigran wirkende, wirtschaftlich schlanke und leichte Bauten, welche die Vorteile der reinen Holzbauweise übertreffen.
Vorliegende Doppelnummer von Steeldoc thematisiert die Stärken jeder Bauweise im Verbund mit der anderen. Ein einführender Artikel schafft den Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten der Materialkombination und deren statischen und bauphysikalischen Vorteile. Die Hybridbauweise in Stahl und Holz hat ein grosses Entwicklungspotenzial. Sind einmal die Berührungsängste der jeweiligen Baubranchen überwunden, ergeben sich immer neue Synergien. So zum Beispiel denkbar im Brandschutz. Denn Holz ist zwar entflammbar, schützt den Stahl jedoch vor Hitze. Diese Verbundwirkung ist derzeit noch nicht genügend erforscht. Vorteile bietet die Kombination auch beim erdbebensicheren Bauen. Denn hier ist die Tragstruktur in Stahl oft schon duktil genug; hinzu gesellt sich nun die Flächenwirkung von Holz in Wandelementen. Auch punkto Nachhaltigkeit spielt die Stahl-Holz-Bauweise Hand in Hand.
Der nachwachsende Baustoff Holz lässt sich von demjenigen mit der höchsten Recyclingrate tragen: Stahl. Die aktuelle Diskussion um die Anerkennung der Rezyklierbarkeit der Baustoffe und insbesondere der Trennbarkeit der Bauteile wird der Hybridbauweise Stahl-Holz noch viele Türen öffnen.
Die nachfolgende Bautendokumentation zeigt eine Palette verschiedener Bautypologien, von öffentlichen Gebäuden, über Wohnhäuser bis hin zu Industriehallen. Vor allem aber zeigt sie eine Bandbreite der Anwendung von Stahl oder Holz als Tragelement, in der Fassade oder in der Fläche. Eine tatsächliche Hybridwirkung geschieht vor allem dann, wenn beide Materialien in einem Bauteil kombiniert sind wie zum Beispiel bei Hybriddecken-Systemen. Hier überzeugt nicht nur die Ästhetik sondern vor allem die Schlankheit und Wirtschaftlichkeit der Konstruktion.
Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre der nachfolgenden Seiten von Steeldoc und hoffen, dass sich der eine oder andere Leser von der Eleganz und Leichtigkeit dieser vielversprechenden Bauweise überzeugen lässt.
Inhalt
Editorial
Einleitung
Stahl und Holz – die neue Leichtigkeit
Mediathek, Oloron-Sainte-Marie, F
Schwereloser Raumkörper am Fluss
Schulzentrum, Taufkirchen an der Pram, A
Selbstverständliche Eleganz
Produktions- und Verwaltungsgebäude, Biel
Innovativer Geist in luftigen Hallen
Läden im Viadukt, Zürich
Von der Eisenbahnbrücke zum verbindenden Park
Wohnhaus in Den Hout, NL
Kontrastierende Hüllen
Rheinfall Besucherzentrum, Schloss Laufen
Holz und Stahl im heiteren Dialog
Impressum
Innovativer Geist für eine Produktionshalle
Produktions- und Verwaltungsgebäude, Biel
Trotz aussergewöhnlicher Dimensionen wirkt das neue Produktions- und Verwaltungsgebäude der Firma Sputnik Engineering elegant und nicht typisch industriell. Zu verdanken ist dies einer innovativen Hybridbauweise, welche die Vorzüge des schlanken Stahlbaus und des warmen Holzbaus nutzt.
Das neue Produktions- und Verwaltungsgebäude ermöglicht der Firma Sputnik Engineering, ihre verschiedenen Standorte in Biel unter einem Dach zu vereinen. Die international tätige Unternehmung ist auf Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Wartung von netzgekoppelten Photovoltaik-Wechselrichtern spezialisiert. Alleine das Tätigkeitsgebiet lässt schon darauf schliessen, dass bei diesem Gebäude die ökologische Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielt.
So sollten die verwendeten Materialien möglichst effizient, entsprechend ihren jeweiligen Stärken, eingesetzt werden. Das Ergebnis ist eine Konstruktion, in der Stahlbau, Holzbau und Betonbau in einer hybriden Weise miteinander kombiniert wurden. Der Neubau mit einer Länge von rund 132 Metern, einer Breite von knapp 90 Metern und einer überbauten Grundfläche von 11 800 Quadratmetern weist nicht alltägliche Dimensionen auf und bietet Raum für bis zu 500 Mitarbeitende.
Kompakt und doch grossräumig
Das architektonische Konzept des Neubaus leitet sich direkt von der Funktion des Gebäudes ab. So ist das Volumen im Produktionsbereich sehr kompakt, im darüber liegenden Verwaltungsgeschoss aber wird es mit einem begrünten Innenhof aufgelockert. Dank Bindern mit 18 Metern Spannweite bieten die Fabrikationsräume im Erdgeschoss die gewünschte Flexibilität im Grundriss, und Oberlichter garantieren auch in der Mitte der Produktionshalle eine optimale Belichtung. Im Erdgeschoss, das über zwei Stockwerke reicht, befindet sich ausser der grosszügigen Eingangshalle, die für Ausstellungen benutzt werden kann, auch das Personalrestaurant. Die Bürotrakte im Obergeschoss nehmen nicht die gesamte Gebäudefläche ein. Sie sind in Form von 19 Meter breiten Riegeln im Abstand von 19 Metern auf das Erdgeschoss gesetzt. Verbunden werden sie durch eine Kommunikationszone, sodass ein U-förmiger begrünter Innenhof entsteht.
Jedes Material am richtigen Platz
Analog dem architektonischen Konzept leitet sich auch die Konstruktion des Gebäudes direkt von den jeweiligen Nutzungen ab. Über den vorfabrizierten Betonstützen des Erdgeschosses liegen Primärträger aus Stahl, die eine Holz-Beton-Verbunddecke aufnehmen, wobei die Stahlträger zusammen mit dem Überbeton als Verbundträger ausgeführt sind. Die HEB-Träger über dem Erdgeschoss fangen jeweils eine Stützenachse des darüber liegenden Bürogeschosses ab, hier sind die Stützen aus Stahlhohlprofilen in einem Raster von 6,25 x 6,25 Metern angeordnet. Die Deckenscheiben, im Speziellen deren Überbeton, bilden die horizontale Aussteifung und sind damit wesentliche Bestandteile der Gebäudeaussteifung. Sie leiten die Horizontallasten in die Treppenkerne. Die Dächer über den Bürotrakten sind als reine Brettstapeldecken ausgeführt. Eine reine Holzkonstruktion ist auch das Dach über der Produktion im Erdgeschoss. Es wurde mit BSH-Satteldachträgern, Pfetten und OSB-Platten als Dachscheibe konzipiert.
Effizient dank Vorfabrikation
Um das beachtliche Bauvolumen kosten- und terminmässig möglichst effizient zu realisieren, entschied man sich für eine Bauweise mit vorfabrizierten Elementen. Dank der gewählten Beton,- Stahl- und Holzbauweise konnte der Bau in rund 14 Monaten erstellt werden. Analog zu den Deckenelementen wurden auch die Fassaden in Holzelementbauweise realisiert. Eine hinterlüftete Holzschalung kaschiert die vorfabrizierten Fassadenelemente und prägt das Erscheinungsbild des Gebäudes. Während um die Produktionshalle umlaufend eine offene, sägerohe vertikale Lärchenholzschalung angebracht wurde, sind die Bürotrakte ost- und westseitig mit einer vorbehandelten, regelmässigen horizontalen Fichtenholzschalung eingekleidet. Mit diesen im Detail zwar unterschiedlich ausgeführten, punkto Material aber einheitlichen Fassaden gelang es, dem Gebäude trotz verschiedener Nutzungen im Innern ein einheitliches Erscheinungsbild zu verleihen.
Umfasssend nachhaltig
Nachhaltigkeit wurde bei diesem Projekt als ausgewogenes Verhältnis zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Faktoren verstanden. Die Mitarbeiter und ihr Wohlbefinden standen im Vordergrund. Genügend Tageslicht, ein angenehmes Raumklima, die Wohnlichkeit der Holzbauweise, der Garten im Innenhof sowie ein gutes Angebot von Nischen und Rückzugsräumen führen zu einer besseren Befindlichkeit und bieten eine offene Bürolandschaft, in der sich motiviert und kreativ arbeiten lässt. Dem Aspekt der Ökologie wurde mit dem materialgerechten Einsatz von gezielt ausgewählten Baustoffen und einer energieeffizienten Bauweise Rechnung getragen. Dies ermöglichte schliesslich ein nach Minergie zertifiziertes Gebäude. Eine betriebseigene Photovoltaikanlage auf den Bürodächern trägt zusätzlich zur Nachhaltigkeit bei. Die hohe Flexibilität der Büro und Produktionsräume erhöhen den Wert des Neubaus.(vra)
Ort: Biel BE
Bauherrschaft: Sputnik Engineering AG, Biel
Architekten: Burckhardt Partner AG, Bern
Ingenieure: Merz Kley Partner AG, Altenrhein SG
Stahlbau: Jakem AG, Münchwilen AG
Holzbau: Hector Egger Holzbau AG, Langenthal BE
Tragsystem: Skelettbau
Material und Konstruktion: Beton-, Stahl- und Holzbau
Vorfertigung und Montage: Vorfabrizierte Stahlbetonstützen,
Decken und Fassaden: vorfabrizierte Holzelemente
Tonnage: 530 t
Energie-Effizienz/Nachhaltigkeit: Kontrollierte Raumlüftung
(gemäss Minergielabel)
GF: 21 810 m²
Volumen: 128 590 m³
Länge, Breite, Höhe: 132 m, 88.5 m, 15.7 m
Kosten: CHF 260/m3, CHF 37.7 Millionen exkl. Mwst.
Bauzeit 14 Monate, Fertigstellung Ende August 2012
Bilder
Hansueli Schärer, Bern S. 22, 23, 24, 26
Jakem AG S. 27 oben
Burckhardt Partner AG S. 27 untenSteeldoc, Mo., 2012.12.31
31. Dezember 2012 Virgina Rabitsch
Holz und Stahl im heiteren Dialog
(SUBTITLE) Rheinfall Besucherzentrum, Schloss Laufen
Die Fassade des neuen Besucherzentrums Schloss Laufen erinnert ein wenig an eine Ritterrüstung. Doch die stählerne Hülle ist lichtdurchlässig und filigran perforiert. Ihre bewitterte Oberfläche trotzt den Naturgewalten und lässt sich mit ihnen auf einen Dialog ein. Im Innern trägt traditionsgemäss ein Holzfachwerk. So begegnen sich die beiden Materialien auf neue Weise.
Die Schlossanlage auf dem Felssporn des Rheinknies als historische Zeugin, die Kirche mit Pfarrhaus als geistige Stätte und das Besucherzentrum als Profanbau für die touristische Nutzung bilden zusammen die baulichen Elemente des Weilers Laufen am Rheinfall. Das dem Schloss vorgelagerte Besucherzentrum verrät in keiner Weise mehr das ehemalige Personalhaus, das sich hinter dem einfachen, langgestreckten Baukörper verbirgt. Zusätzlich zur südlichen Erweiterung erhielt das bestehende Gebäude eine allseitig umlaufende äussere Hülle aus wetterfestem, archaisch anmutendem Stahl, die dem Bau ein einheitliches Aussehen verleiht. Die Vordächer illustrieren in ihrer Form noch die ursprüngliche Idee von aufklappbaren Fassadenfronten.
Den touristischen Bedürfnissen angepasst
Die Raumanordnung folgt der Regel eines typischen Besuchsablaufs. An vorderster Stelle bei der Ankunft, im Neubauteil, befinden sich die gedeckten Kassen und Infoschalter sowie der Geldautomat. Unmittelbar danach und räumlich mit den Kassen eine Einheit bildend folgt der grosszügige und von drei Seiten mit Licht durchflutete Souvenirshop. Im darüber liegenden Obergeschoss bilden wandhohe Fachwerkträger einen geschlossenen Dachraum, in dem sich ein geräumiger Mehrzwecksaal befindet, der sich dank eigenem Zugang autark betreiben lässt. Im hinteren Teil des Erdgeschosses, im eigentlichen Altbau, ist das Selbstbedienungsrestaurant untergebracht. Im Südwesten, dem Gebäude vorgelagert, entstand eine grosszügige Terrasse, die eigentlicher Gastraum ist und freie Sicht auf die Schlossanlage gewährt. Mit der Konzentration der Lager- und Technikflächen im erweiterten Gebäudesockel, der gleichzeitig die Terrasse bildet, konnte die Dienstebene von der Publikumsebene entkoppelt werden.
Stahl für Schutz und Patina
«Die funktional sehr unterschiedlichen Anforderungen an die Zugänge und Öffnungen im Erdgeschoss, die verschiedenen Ein- und Ausblicke im Obergeschoss sowie die Intensitätsunterschiede der Nutzung in der unmittelbaren Umgebung können am besten ästhetisch befriedigend eingelöst werden, wenn die Fassade auf ein einziges Material reduziert wird», so die Begründung der Architekten für die gewählte Aussenhülle. Dieses Material musste für die Ein- und Aussichten lichtdurchlässig und gegen intensiven Gebrauch robust sein. Zudem sollte es eine naturnahe Patina entwickeln. Diese Anforderungen konnten mit wetterfestem Stahlblech in vorzüglicher Weise erfüllt werden. Die spielerisch unregelmässige Perforierung der Aussenhaut vergleichen die Architekten mit Stickereitüchern.
Das Muster, das aus einem komplexen Entwurfsprozess hervorging, wurde mit Lasertechnik in die Bleche geschnitten, jedes Blech ist ein Unikat.
Neue Rollenverteilung
Werden Stahl und Holz kombiniert, übernimmt der Stahl in den meisten Fällen die tragende Funktion und Holz eine verkleidende oder ausfachende. Im Fall des Besucherzentrums jedoch besteht das Tragwerk aus einer Kombination von Massiv- und Holzständerbau, während der wetterfeste Stahl die äussere, vorgehängte Hülle bildet.
Das heisst, die Architekten haben hier die übliche Rollenverteilung unter den Materialien umgekehrt, mit faszinierendem Resultat.Steeldoc, Mo., 2012.12.31
31. Dezember 2012 Virgina Rabitsch