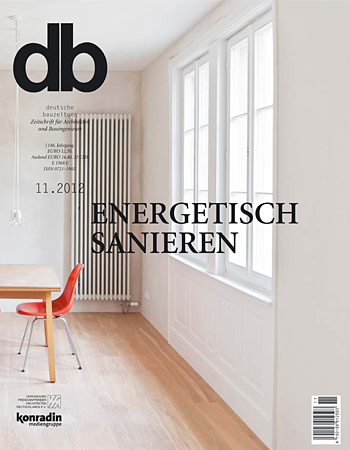Editorial
… mit Augenmaß: Nicht alles, was bei einer Sanierung bezüglich Dämmung, Fenstertausch oder Gebäudetechnik machbar ist, stellt sich als tatsächlich notwendige oder vernünftige Maßnahme heraus; und nicht alles, was in Förderpaketen enthalten ist, muss auch sinnvoll sein. Nur ein Hinterfragen, ein Abwägen der Möglichkeiten und ein angemessener, individueller und sensibler Umgang mit der Bausubstanz kann den Gebäudecharakter und folglich unsere Baukultur erhalten. Dies demonstrieren die nachfolgenden, behutsam sanierten Projekte. Sie stehen jeweils für eine bestimmte Epoche und einen speziellen Bautypus und bilden alltägliche Bauaufgaben ab. Das Thema der energetischen Sanierung greifen wir jedoch nicht nur in den vorgestellten Projekten auf: Mit Aktuellem aus Berlin ( Magazin S. 10), Statements von Architekten (S. 46) über die Rubrik Energie bis hin zu Produktempfehlungen (ab S. 76) runden wir den Schwerpunkt dieser Ausgabe ab. | Christine Fritzenwallner
Fördern und fordern?
(SUBTITLE) Was sich bei der energetischen Sanierung ändern muss
Wer im Gebäudebestand Energie sparen will, hat es nicht leicht. Wenn es darum geht, den Charakter eines Gebäudes zu bewahren, gleichzeitig die Ansprüche der EnEV und der Fördermittelgeber zu erfüllen und dann auch noch dafür zu sorgen, dass das Ganze bezahlbar bleibt, gerät man schnell zwischen die Fronten. An welchen Stellschrauben müsste gedreht werden, um beim Sanieren die Kombination von großen Einsparungen und gestalterischem Anspruch zu erleichtern?
Läuft bei der energetischen Sanierung unseres Gebäudebestands alles rund? Mitnichten. Der Anteil an Bauten, die jährlich eine energetische Aufwertung erfahren, ist zu gering, statt einer Quote von 2 %, die im Rahmen der Energiewende in Deutschland angestrebt wird, erreichen wir nur rund 1 %. Und noch immer leidet dabei zu häufig das Aussehen der Gebäude, noch immer verschwinden zu viele Bauten, die einst mit Sorgfalt gestaltet wurden, hinter zumeist weniger sorgfältig gestalteten Dämmpaketen. Sowohl Quantität als auch Qualität der momentanen Sanierungspraxis lassen also zu wünschen übrig. Was lässt sich dagegen tun?
Dringend erforderlich ist zunächst einmal ein Überdenken der unausgegorenen Förderpolitik. Immer wieder ist es in den vergangenen Jahren vorgekommen, dass die Töpfe plötzlich leer waren, sodass Planer und Bauherren sich nicht darauf verlassen konnten, dass ihr Vorhaben tatsächlich bezuschusst wird. Hier brauchen wir mehr Verlässlichkeit, mehr Konstanz. Und wenn die Sanierungsquote steigen soll, wird man nicht umhin kommen, unterm Strich mehr Geld zur Verfügung zu stellen.
Auch die Frage der Wirtschaftlichkeit ist entscheidend. Nur wenn es gelingt, die Modernisierungen preiswerter zu gestalten als bisher, wird es eine neue Welle geben, mit der sich die angestrebte Quote erreichen lässt. Viele Eigentümer lassen sich von hohen Sanierungskosten abschrecken und unternehmen daher erst mal gar nichts. Hier gilt es, kleinere Brötchen zu backen und günstige Teilsanierungen stärker zu fördern. Es bringt in der Summe mehr, wenn zehn Bauherren 20 % Energie einsparen, als wenn ein Bauherr 100 % spart. Für Mietwohnungen hat die Deutsche Energie-Agentur dena untersucht, bis zu welchem Energiestandard sich Modernisierungen warmmietenneutral durchführen lassen. Eine Auswertung von 350 Projekten von Vorkriegsbauten bis zum 70er Jahre-Wohnblock ergab: Wenn ein Gebäude ohnehin saniert werden müsse, lasse sich der Energiebedarf um bis zu 75 % drosseln, ohne dass es für die Mieter teurer werde. Bis zu diesem Standard könne der Vermieter seine Kosten decken. Zwar müsse er die Kaltmiete um 0,82 Euro/m2 und Monat erhöhen, dem stünden aber Energiekosteneinsparungen von 0,92 Euro/m2 und Monat gegenüber. Die Warmmiete erhöhe sich also nicht.
Wird darüber hinaus dennoch eine Modernisierung auf Passiv- oder gar Plusenergiestandard angestrebt, lohnt es sich, verstärkt darüber nachzudenken, ob sich die Mehrkosten auffangen lassen, indem zusätzlicher Wohnraum geschaffen wird. Der Ausbau leer stehender Dachgeschosse, das Umwandeln von Loggien zu Wohnraum oder der Anbau von Balkonen erhöht die Gesamtwohnfläche eines Mehrfamilienhauses. Gerade in Großstädten mit ihren hohen Immobilienpreisen können Wohnbaugesellschaften auf diese Weise beim Umbau ihres Bestands ein Plus erzielen, mit dem sich die hohen Modernisierungskosten ausgleichen lassen, sodass sich die Mehrbelastung für Mieter in Grenzen hält. Energetische Prestigeprojekte sollten sich also auf Bauten mit solchen Raumreserven beschränken, wenn die Sanierung sozialverträglich bleiben und nicht zur Gentrifizierung beitragen soll.
Fördermittel als Problem
Während die Quantität der Sanierungen mit der Höhe der Fördermittel recht leicht gesteuert werden kann, wird es bei der Qualität schwieriger. Sie lässt sich nicht einfach per Finanzspritze erhöhen. Doch auch hier bietet die Förderpolitik Lenkungsmöglichkeiten, mit denen sich zumindest der unreflektierte Dämmwahn bremsen lässt. Der Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger BVS empfiehlt beispielsweise, die Bedingungen der KfW-Programme zur Energieeinsparung auf den Prüfstand zu stellen. Momentan vergebe die KfW Zuschüsse nur, wenn 15 % der Energie durch Wärmedämmung von Gebäuden eingespart werden. Der BVS schlägt stattdessen eine differenziertere Förderung von energiesparenden Maßnahmen vor: »Vielfach lässt sich eine Energieeinsparung von 15 % bereits durch sinnvolles Energiemanagement eines Bestandsgebäudes erreichen, ohne zusätzliche Dämmstoffe verbauen zu müssen. Für solche schonenden Maßnahmen wird aber keine KfW-Förderung gewährt.« So sei es aus Sicht eines Bauherrn wirtschaftlich sinnvoller, ein Gebäude neu zu dämmen, anstatt die bestehende Substanz und Haustechnik intelligenter aufeinander abzustimmen. »Es ist irrwitzig, dass der Verbau von größtenteils chemischen Dämmstoffen mit staatlichen Mitteln gefördert wird, während schonende Maßnahmen zur Erreichung des Ziels der Energieeinsparung nicht in den Förderprogrammen berücksichtigt werden.« Der Gesetzgeber sollte also das Ziel der Energieeinsparung fördern, nicht die Mittel zu dessen Erreichen. Fördern und fordern? Die detaillierten Forderungen, welche die KfW an die Vergabe der Fördermittel knüpft, sind das Problem, sie schränken Planer ein und erschweren ein flexibles Eingehen auf unterschiedliche Bauwerke. Nötig sind folglich ein größerer Spielraum und mehr Entscheidungsfreiheit bei der Frage, auf welchem Weg man die gebotenen Energieeinsparungen erzielen möchte.
Auch die Fixierung auf den Verbrauch gilt es zu hinterfragen. Bei Gebäuden mit erhaltenswerten Fassaden muss es nicht immer sinnvoll sein, den Wärmebedarf mit aller Gewalt zu senken. Warum nicht einen etwas höheren Verbrauch akzeptieren, diesen aber aus regenerativen Quellen decken, etwa mit Erdwärme? Auf diese Weise ließen sich genauso viel Gas, Öl und CO2-Emissionen einsparen wie mit einer Dämmung – aber ohne schädliche Nebenwirkungen auf die Gestalt des Gebäudes.
Und ohne all die Graue Energie, die in den Dämmstoffen steckt. Denn bislang wird nur der Energieverbrauch im laufenden Betrieb des Gebäudes betrachtet. Wie viel Energie hingegen während der Sanierung verloren geht, wenn alte Baustoffe entsorgt und neue, aufwendig produzierte Materialien eingebaut werden, findet keine Berücksichtigung in der EnEV und bei KfW-Förderprogrammen. Die Frage nach der energetischen Amortisation der eingesetzten Dämm- und Baustoffe stellt niemand – u.a., weil solche Ökobilanzen nur sehr aufwendig zu erstellen sind. Während es heute technisch kein großes Kunststück mehr ist, Gebäude so umzubauen, dass sie in der täglichen Nutzung kaum noch Energie verbrauchen, wird die nächste Herausforderung v. a. darin liegen, den Energiebedarf für die Konstruktion in den Griff zubekommen. Es geht darum, ressourcenschonende Baustoffe zu entwickeln und Planern Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen komplexe Ökobilanzen leichter zu beherrschen sind.db, Mo., 2012.11.19
19. November 2012 Christian Schönwetter
Vom Schandfleck zum Schmuckstück
(SUBTITLE) »Haus der Begegnung« in Königstein im Taunus
Baudenkmäler haben zwar keine strengen EnEV-Vorgaben einzuhalten – eine halbwegs wirtschaftliche Nutzung muss aber möglich sein. Bei der Sanierung des »Haus der Begegnung« ist diese Gratwanderung zwischen Bewahren des Charmes und energetischer Ertüchtigung weitgehend gelungen, sodass es unlängst sogar eine Green Building-Auszeichnung bekam: eine Erfolgsgeschichte aus dem Taunus, die, nach jahrelangem Auf und Ab, Investorensuche und bereits erteilter Abrissgenehmigung, von einer glanzvollen Wiedergeburt erzählt.
Rund 300 m² Glasfassade mit Blick in den Taunus – das Markenzeichen des »Haus der Begegnung« machten das kirchliche Zentrum seinerzeit zum »modernsten und schönsten Tagungshaus Hessens« (so die zeitgenössische Presse 1955), aber auch zu einer Energieschleuder. Denn zu Veranstaltungen musste der karge Nachkriegsbau früher drei Tage lang vorgeheizt werden. An sonnigen Tagen wurde es dann aber hinter der bleiverglasten Südwestfassade rasch zu warm. Eine innere Schutzverglasung, später ein grüner Anstrich, zuletzt, in den 80er Jahren, die komplette Verbretterung schufen zwar bauphysikalisch Abhilfe, doch ruinierten sie gerade das Markenzeichen des Hauses.
Obwohl das Gebäude 1988 unter Denkmalschutz gestellt wurde, schien schließlich alles auf einen Abriss hinauszulaufen. Die Stadt als neue Eigentümerin konnte Anfang der 90er nachweisen, dass ihr der Betrieb wirtschaftlich nicht mehr zumutbar war, 2000 erteilte das Landesamt für Denkmalpflege die Abrissgenehmigung. Erstaunlicherweise kam es fünf Jahre später zu einem Bürgerbegehren, das sogar die damals regierende Partei spaltete und die Wende einleutete: Unterstützt vom Förderprogramm der Deutschen Energieagentur dena (Modellvorhaben »Niedrigenergiehaus im Bestand«), die seit 2007 energetische Sanierungen öffentlicher Gebäude wissenschaftlich begleitet, gab der Stadtrat den Umbau und die Sanierung zu einem »Leuchtturmprojekt« in Auftrag. Dies wird der Rolle des Gebäudes in der Königsteiner Geschichte, v. a. aber auch der besonderen Ästhetik dieses 50er-Jahre-Baus gerecht.
Offen, transparent und in Bauhaus-Manier
Das »Haus der Begegnung« wurde 1955 als Zentrum der katholischen Vertriebenen auf einem ehemaligen Kasernengelände am Rande Königsteins eingeweiht. Hier fanden Kongresse, Seminare und Bischofskonferenzen statt, außerdem sammelte die Organisation »Kirche in Not/Ostpriesterhilfe« Kräfte für Osteuropa. Zu diesem asketisch-missionarischen Anspruch passte die schlichte, unprätentiöse Behausung (Architekt: Hans Busch, Frankfurt, mit dem Künstler Jupp Jost), geschmückt allein mit einem weit ausgreifenden Engels-Sgraffito auf den Hauptschauseiten, der in elegantem Schwung in die Glasfassade hineinreichte. Sie stand in Anknüpfung an die Bauhaus-Moderne für Offenheit, Transparenz und demokratische Werte. Ursprünglich schloss sich seitlich noch ein niedrigerer Bettentrakt für Gäste und Mitarbeiter an. Er war zum Ende der 90er Jahre hin zwar nutzlos geworden, ergänzte das Ensemble aber zu einem reizvollen Hof, einer Zuflucht in der Zeilen-Vorstadt. Davon ist – leider – nach der Sanierung nur noch das luftige Torgebäude übrig geblieben, das den Eingang zum Quartier markiert. Die Sanierer mussten aus Kostengründen Prioritäten setzen.
Die 2009 von Architekten und Stadt veranschlagten 5 Mio. Euro erwiesen sich ohnehin bald als zu knapp kalkuliert: Das »Haus der Begegnung« war seinerzeit vom billigsten Bieter errichtet, das Baumaterial aus Trümmerschutt zusammengebacken, Pläne waren nur lückenhaft hinterlassen. Die Darmstädter Architektengruppe werk.um unter Leitung von Arne Steffen, beauftragt zunächst mit einem Gutachten, daraufhin mit der Ausführungsplanung, war zwar fasziniert von der »unverdorbenen« Qualität des ohne viele Veränderungen erhaltenen Haupthauses, sah sich aber mit einer nach heutigen Maßstäben äußerst mageren Statik und zahlreichen Bauschäden konfrontiert.
Immerhin war dem Gebäude mit den gängigen Mitteln beizukommen: Betonsanierung, Dämmung von Außenwänden, Böden und Decken, Erneuerung der Fenster sowie nahezu sämtlicher Oberflächen und natürlich der Haustechnik. Abgesehen von der besseren Anbindung des einst als Garagen für die Missionsbusse dienenden und nun für weitere Tagungsräume zu nutzenden UGs durch ein neues Treppenhaus gab es keine Eingriffe in tragende Strukturen.
Unverdorbenes nicht verfetten
Eine im Denkmalschutz gern bevorzugte Innendämmung schied für die Architekten aus: zu teuer, bauphysikalisch zu problematische Anschlussdetails, heißt es von dort. Die Denkmalpflege stimmte einem WDVS unter der Bedingung zu, dass die vorhandenen Sgraffiti auf die neue Außenhaut übertragen werden. Das gelang dann auch in akribischer Kleinarbeit – die Architekten sind dabei voll des Lobes für die Handwerker. Der dunkelgrau gefärbte Putz ist von einer fast händisch-rohen Rauheit, die einem aus Nachkriegsbauten vertraut ist.
Die 10 cm Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum führte zumindest bei der Fassade nicht zur befürchteten Verfettung, da auch die neuen Fenster herausgerückt wurden und fast bündig mit der Fassade abschließen. Die Dachüberstände hingegen sind erkennbar mächtiger, die zuvor sanft gebogenen Eternitplatten der Eindeckung etwas zu eckig geworden. Die schlanken Aluprofile der Lochfenster wurden wieder im Stile der 50er durch feine weiße Umrahmungen abgesetzt, die mehrflügeligen Fenster getreu den Vorbildern gefertigt.
Bleifenster auf Dreifachverglasung
Die große Glasfassade indes musste völlig neu konzipiert werden. Da die prägenden schmalen Bleifenster lückenhaft waren, musste diese »Schmuckschale« originalgetreu neu aufgebaut werden (ein Kirchenfenster-Experte nahm sich dieses Themas an). Als Trägerschicht dienen großformatige, von schmalen Leisten gehaltene und durch aufgeklebte Sprossen weiter unterteilte Elemente aus gängigem Dreifachglas. Als Vorbild für dieses Laminierverfahren diente Gerhard Richters unlängst für den Kölner Dom gefertigtes Kirchenfenster. In dieser Größe ist die Fassade aber ein Novum und zumindest in der Gliederung nah am Original. Ohne eine Hinterlüftung in Form einer Doppelfassade – eine aufwendigere Option, die aus Kostengründen verworfen wurde –, musste der Energieeintrag durch Sonnenschutzverglasung reduziert werden, die glücklicherweise keinen ausgeprägten Spiegeleffekt hat.
Im Innenraum steuert eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung der verbleibenden Wärmelast entgegen und sorgt nach ersten Erfahrungen für guten thermischen Komfort. Abluftöffnungen und -kanäle wurden in den Wänden, über den Fenstern und in der neuen, stark vergrößerten Brüstung der Empore versteckt. Die Zuluft wird über einen Erdkanal nach Bedarf vorerwärmt oder -gekühlt. Die Restwärme erzeugt ein Pelletkessel im UG. So liegt der Primärenergiebedarf bei respektabel niedrigen rund 100 KWh/m²a, was 65 % unter dem Höchstwert der hier maßgeblichen EnEV 2007 und immer noch 40 % unter dem schärferen Limit von 2009 liegt.
Fifties Revival, nur: Was ist hier noch alt?
Abgesehen von der fachlichen Begleitung durch die dena gab es für das Pilotprojekt einen zinsvergünstigten Kredit der KfW, der mit 550 Euro/m² NGF folglich 250 Euro höher war als die typische kfW-Förderung, sowie einen fünfstelligen Zuschuss aus Denkmaltöpfen. Mittlerweile sonnt sich die Stadtverwaltung in der Publicity für ihr »Green Building« und bereut keinesfalls den Mehraufwand für die Sanierung. Das Haus bewährte sich in diesem Sommer schon bei einem großen Musikevent und erfreut sich auch im Alltag reger Belegung durch örtliche Vereine und Institutionen. Kaum einer trauert hier mehr den kühneren Abriss- und Neubauplänen nach, die es einmal gab.
Wer das Gebäude betritt, erlebt ein runderneuertes Haus, an dem außer Kubatur und Gliederung allerdings nur noch sehr wenig sichtbar alt ist. Alles ist zwar so originalgetreu wie möglich, doch insbesondere die optische Leichtigkeit, die Beschwingtheit der 50er Jahre musste an einigen Stellen geopfert werden, meist aus Sicherheitsgründen wie etwa bei den Treppengeländern und den Stützen im großen Saal oder bei der Empore, in der die neue Technik untergebracht werden musste. Allein der wunderbare Mosaikboden aus großformatigen Natursteinen im Foyer strahlt, poliert und ausgebessert, noch den echten informellen Charme aus. Von der abgehängten Saaldecke aus gefalteten Acella-Elementen (PVC-Paneelen von seidigem Glanz), die über die Jahre löchrig wurden, ließ sich nur noch ein schmaler Streifen über der Empore original erhalten. Die nachgebildete Konstruktion trägt weiter wesentlich zur guten Raumakustik bei. Im bereits früher veränderten Foyer erlaubten sich die Planer hingegen, die abgehängte Holzlattendecke zu entfernen, um mehr Licht ins Innere zu leiten. Auch durch behindertengerechte Einbauten in den Tagungsräumen gibt es Störungen der Harmonie, doch insgesamt ergibt sich ein stimmiges Bild. Die Architekten blieben hier ganz in der dienenden Rolle, und fraglich ist, ob eine mutigere Kontrastierung dem Interieur gutgetan hätte.
Im Außenraum jedoch nahm man erstaunlich wenig Rücksicht auf die alte Situation, und das tut dem Ort nicht gut: An die Stelle der prägenden und städtebaulich wichtigen Hof-Situation trat eine offene, grafische Beetgestaltung, die Fluchttreppen landen auf einer ungeschützten, lediglich gesplitteten Terrasse. Ausgerechnet auf dem urbanen Präsentierteller reichten offenbar Geld und Gestaltungshoheit der Akteure nicht aus, um großzügiger zu planen. Warum wagte man etwa anstelle des obsoleten Bettentrakts keinen Neubau für Hotel oder Gastronomie, der den im Stadtgefüge etwas abgelegenen Ort zudem beleben und zu einem Platz machen würden? Keinen Fake wie ein paar Schritte weiter, wo eine nagelneue Altenresidenz im historistischen Retro-Mix steht, sondern einen Dialog mit den 50er Jahren. Dann würde womöglich für alle deutlich: Mit seiner formalen Klarheit und Kargheit wirkt das »Haus der Begegnung« in dieser reichen Stadt geradezu provozierend zeitgemäß.db, Mo., 2012.11.19
19. November 2012 Christoph Gunßer
Grossmassstäbliche Wohnwertsteigerung
(SUBTITLE) Grosswohnsiedlung Märkisches Viertel in Berlin
Energieeinsparung, Kosteneffizienz und Gestaltungsqualität müssen keine Gegensätze sein. Das zeigt beispielhaft die behutsame Erneuerung des Märkischen Viertels mit seinen rund 17 000, im Norden Berlins gelegenen Wohnungen. Jahrelang als Ghetto verpönt, entwickelt sich die Siedlung, die zu 90 % aus Hochhäusern besteht, nun mit jedem neuen Sanierungsabschnitt weiter in ein optisch ansprechenderes Quartier. Dass die energetische Sanierung dabei nur mit WDVS geschehen kann, verwundert angesichts der Dimensionen kaum.
Das Image des Märkischen Viertels war lange denkbar schlecht. Errichtet als eine von drei West-Berliner Großwohnsiedlungen zwischen 1963 und 1974 nach dem städtebaulichen Konzept von Werner Düttmann, Hans C. Müller und Georg Heinrichs, offenbarte sich schon kurz nach Fertigstellung der rund 17 000 Wohnungen ein Mangel an sozialer Infrastruktur, der bis Ende der 70er Jahre behoben wurde. Mitte der 80er Jahre begannen erste Umgestaltungen und Sanierungen von Einzelgebäuden. 2006 entschied sich schließlich die kommunale Gesobau als Haupteigentümerin, die Grundsanierung ihrer 15 000 Wohnungen und deren energetische Modernisierung miteinander zu verknüpfen, um den großen baukonstruktiven und technischen Mängeln, den steigenden Instandhaltungs- und Betriebskosten und dem daraus resultierenden Wegzug von Mietern wirksam entgegenzutreten. Allerdings sei »kein Leuchtturmprojekt unter Umsetzung aller denkbaren technischen Maßnahmen vorgesehen, sondern ein wirtschaftlicher Umbau verbunden mit einem hohen Gestaltungsanspruch«, erläutert Jochen Kellermann, Projektleiter der Gesobau.
Warmmietenneutral
Innerhalb von acht Jahren, bis 2015, wird die Gesobau in die Erneuerung von 13 000 Wohnungen insgesamt 480 Mio. Euro investieren, die sie bis auf Tilgungszuschüsse aus KfW-Förderprogrammen selbst finanziert. Die energetische Modernisierung sieht als wichtigste Maßnahmen die Dämmung der Gebäudeoberflächen mit WDVS der Wärmeleitgruppe 035 in einer Dicke von 80 bis 140 mm, den Einbau doppelt verglaster Isolierglas-Kunststofffenster und die Umstellung der Heizungsanlagen auf ein energieeffizientes Zweirohrsystem vor. Der Endenergieverbrauch soll damit von durchschnittlich 174 kWh/m²a auf 70 bis 80 kWh/m²a sinken, die Höchstwerte der Energieeinsparverordnung 2007 um mindestens 30 % unterschritten werden. Alternativen zur viel diskutierten Dämmung der Gebäudeoberflächen mit WDVS, die rund 50 % der gewünschten Energieeinsparung erbringen soll, wurden geprüft, aber entweder als zu teuer verworfen, so z. B. Plattenbekleidungen, oder von Anfang an wegen bauphysikalischer Nachteile ausgeschlossen, wie etwa eine Innendämmung. Als Dämmmaterial werden nun Mineralwolle und expandiertes Polystyrol verwendet. Ersteres kommt überall dort zum Einsatz, wo es gilt, einer möglichen, höheren Brandgefahr durch Polystyrol entgegenzuwirken – also zum einen für alle Hochhäuser, die im Märkischen Viertel 90 % des Gebäudebestands ausmachen, und zum anderen als Brandriegel über jedem zweiten Geschoss bei allen übrigen Gebäuden. Da die Außenwände aus den unterschiedlichen Materialien und Konstruktionen bestanden, musste für das WDVS teilweise sogar eine Zulassung im Einzelfall eingeholt werden.
Mit dem Einbau von funkablesbaren Heizkostenverteilern wird erstmals eine individuelle Abrechnung und Kontrolle des Verbrauchs möglich, die den Mietern das Energiesparen erleichtern wird. Denn nur so sei laut Kellermann das Ziel einer insgesamt warmmietenneutralen Sanierung zu erreichen. Durch die angestrebte Halbierung der warmen Betriebskosten soll die Gesamtmiete im Durchschnitt um nicht mehr als 4 % steigen, wodurch auch für sozial schwächere Bewohner die Mietbelastung moderat bleibt. Mit einer umfassenderen Sanierung leer stehender Wohnungen sollen zudem zahlungskräftigere Neumieter angesprochen werden. Darüber hinaus werden mit der Modernisierung strukturelle Gebäudemängel beseitigt, so die Eingangsbereiche für eine bessere Orientierung neu gestaltet und rund 1 000 Wohnungen für ältere Mieter »barrierearm« umgebaut. Nach der Sanierung der Hälfte der Wohnungen bestätigen die ersten Ergebnisse den Erfolg des Gesamtkonzepts: Die Einsparziele werden laut Bauherr erreicht und sogar übertroffen und Zeit- und Kostenplan eingehalten, der Leerstand sinkt. Und auch den Anspruch einer qualitätsvollen Neugestaltung können die bisher fertiggestellten Bauten weitgehend einlösen.
Übergreifendes Farbkonzept
Eigene Akzente konnten die für jede Gebäudegruppe, die sogenannte Wohnhausgruppe (WHG) einzeln beauftragten Architekten v. a. durch eine neue Farbgestaltung und den Umbau der Eingangsbereiche setzen. Für ein stimmiges Gesamtbild entwickelten die Gesobau und der Farbdesigner Markus Schlegel von der Hochschule für Gestaltung in Hildesheim einen gebäudeübergreifenden Masterplan, der auf Grundlage der ursprünglichen, kontrastreichen Farbgestaltung des Künstlers Utz Kampmann eine Auswahl an möglichen, neuen Farbtönen für jedes Bauteil definiert. Die Basis bilden dabei Weißtöne, die durch Akzentfarben ergänzt werden.
Diesen Gestaltungsspielraum nutzten Dahm Architekten + Ingenieure bei der für das Pilotprojekt ausgewählten, einst von Oswald Mathias Ungers entworfenen Wohnhausgruppe 908, um an der Fassade neue belebende, lindgrüne Akzente zu setzen. Geprägt werden die Baukörper damals wie heute durch die weißen Wohn-/Treppenhaustürme und die jeweils dazwischen liegenden, früher dunkelblau, heute grau abgesetzten Balkonzonen. Eine bessere Orientierung ermöglichen die großflächig verglasten, neuen Eingangspavillons, die mit ihrer Bekleidung durch Schichtstoffplatten überdies einen sehr angenehmen Material- und Farbkontrast zu Fassade und Fenstern bewirken.
Weniger gelungen erscheint dagegen die Neugestaltung der von Herbert Stranz entworfenen Wohnhausgruppe 905 durch SPP Property-Projekt-Consult. Der einst kräftige Kontrast zwischen weißen Wandflächen und dunkelblauen Fensterbändern blieb zwar weitgehend erhalten, wurde jedoch durch die Verwendung von Hellblau für einen Gebäudeteil verunklart. Mit Ausnahme der heute angenehm hellblau abgesetzten Balkone und der leider allzu plakativ roten, neuen Hauseingänge nutzten die Planer zu wenig neue Farben, um Akzente zu setzen und die Baukörper so zu beleben.
Betont farbig gegliedert zeigen sich dagegen die von Hans C. Müller und Georg Heinrichs errichteten und durch Stefan Ludes Architekten und SPP Property-Projekt-Consult sanierten Wohnhausgruppen 911, 912 und 922. Der ursprünglich starke Farbkontrast zwischen den weißen Wohnscheiben und den Erschließungs- bzw. Wohntürmen in Blau-, Gelb- und Rottönen wurde durch die Neugestaltung in gedeckteren Farbtönen wohltuend abgemildert. Unnötige Unruhe in das ohnehin stark bewegte Fassadenbild der vertikalen Bauteile bringen jedoch die zwischen den blauen Fensterbändern liegenden, heute im Gegensatz zu früher nicht mehr blau, sondern grau abgesetzten Fassadenflächen. Die neuen Hauseingänge, transparente bzw. farbig hinterlegte Glaswände in Stahlrahmen, präsentieren sich dagegen sehr gelungen.
Nochmal getoppt
Bei dem von René Gagès und Volker Theißen errichteten und ebenfalls von Dahm Architekten + Ingenieure sanierten Wohnhausgruppe 907, dem sogenannten langen Jammer, gelingt die Verknüpfung von Farbgestaltung, Energieeinsparung und pragmatischen Umgang mit dem Bestand beispielhaft. Aufgrund des kompakten Baukörpers und eines höheren Modernisierungsstandards, der durch den Erhalt der 80er-Jahre-Eingangspavillons des Gebäudes möglich wurde, konnte hier der Endenergieverbrauch sogar um 75 % auf 48 kWh/m²a gesenkt werden. Dabei wurde im Vergleich zu anderen Wohnhausgruppen stärker gedämmt, wurden dreifach verglaste Fenster eingesetzt und wird die Wärme aus der Abluft von Bädern und Küchen zurückgewonnen.
Außerdem wurde in die vorhandenen Eingangspavillons eine zusätzliche Tür eingebaut, um echte Windfänge herzustellen und damit eine klare thermische Trennung zu erreichen. Mit der Neugestaltung erhielten die Treppenhaustürme ihre zwischenzeitlich verschwundenen Farbbänder zurück, jedoch nicht mehr in konstrastreichem Blau und Rot, sondern ebenso attraktiv in Grau-, Gelb- und Rottönen, die erstmals, gemeinsam mit weiteren roten Farbakzenten auch die Rückseite des Gebäudes beleben.
In der Sanierung befinden sich zurzeit zwei weitere Wohnhausgruppen, die den überwiegend positiven Gesamteindruck noch verstärken. Kosteneffizienz, große Energieeinsparungen und hohe Gestaltungsqualität miteinander zu verbinden, gelingt im Märkischen Viertel ganz überwiegend. Voraussetzungen dafür sind jedoch ein ohnehin vorhandener, hoher Sanierungsbedarf, klar strukturierte Baukörper und Oberflächen, die den Einsatz von WDVS ohne großen Verlust an Gestaltungsqualität ermöglichen, und Bauherren sowie Planer, die energetische Sanierung als reizvolle Gestaltungsaufgabe begreifen.db, Mo., 2012.11.19
19. November 2012 Carsten Sauerbrei