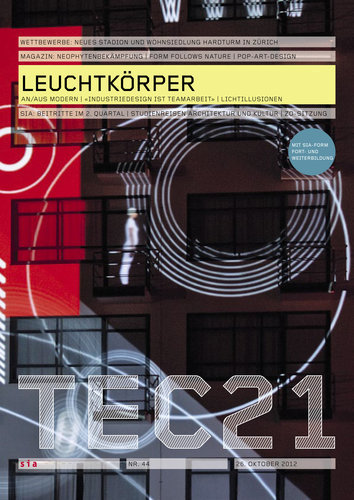Editorial
Die enge Wechselbeziehung von gestalterischen und technischen Aspekten stellt Industriedesignerinnen und -designer bei der Entwicklung von Leuchten vor eine grosse Herausforderung. Ein neues Objekt muss vielfältige technische und konstruktive Einflüsse und Ansprüche in sich vereinen. Ausserdem soll es gestalterisch überzeugen, in grossen Stückzahlen produzierbar und am Ende auch verkaufbar sein.
Bevor der elektrische Strom die Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten vervielfachte, dienten Fackeln, Petroleum- und Gaslampen zur Beleuchtung, aber auch zur Inszenierung von Orten und Räumen. Damit waren die Lichtquellen zugleich auch Objekte, die für den jeweiligen funktionalen oder repräsentativen Einsatz geformt wurden. Doch die Entwicklungsgeschichte verlief nicht ohne Brüche: Der Designer und Bauhaus-Experte Bernd Dicke beschreibt in seinem Beitrag «An/Aus Modern», wie unentschlossen die Protagonisten der Moderne den neuen Möglichkeiten noch gegenüberstanden. In den meisten ihrer bekannten Bauten zogen sie sich beim Kunstlichteinsatz auf ihre Kernkompetenz zurück und setzten gestalterisch reduzierte Leuchtkörper ein – vielfach bereits auf dem Markt erhältliche Industrieleuchten. In dieser Entwicklungsreihe steht auch der Schweizer Industriedesigner Michel Charlot. Mit nur 28 Jahren hat er bereits zwei kommerzielle Leuchten gestaltet, deren Form konstruktiv und technisch begründet ist («Industriedesign ist Teamarbeit»). Offensichtlich ist die Hilflosigkeit der elektrischen Anfangsjahre inzwischen einer selbstbewussten Gelassenheit gewichen: Die Gestalter integrieren souverän die aktuellsten Leuchtmittel und planen im Sinn der Nachhaltigkeit die Weiterentwicklung der Technik in kurzen Intervallen ein. Das bestehende Design kann technisch nachgerüstet werden.
Ebenfalls auf die aktuelle Lichttechnik setzt der junge Norweger Daniel Rybakken («Lichtillusionen»). Mithilfe zeitgemässer LED-Flächen greift er jedoch ein älteres Gestaltungsmittel wieder auf: Seine – oft geometrisch verzerrten – Lichtinstallationen täuschen dem Auge des Betrachters das Vorhandensein von Tageslicht vor. Mit diesen künstlerischen Leuchten verändert Rybakken den architektonischen Raum – ähnlich den Trompe-l’Œil-Malereien der Renaissance.
Alexander Felix
Anmerkung:
[01] www.urbanscreen.com/usc/323
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Neues Hardturm-Stadion in Zürich | Wohnsiedlung Hardturm in Zürich
12 MAGAZIN
Seit 100 Jahren über den Tellerrand | Neophytenbekämpfung an Gewässern | Form Follows Nature | Ämter und Ehren | Augenschmaus Pop-Art-Design | Neubauten – in Kürze
24 AN/AUS MODERN
Bernd Dicke
Die Moderne opferte atmosphärische Zwischentöne des künstlichen Lichts der reduzierten Gestaltung. Es entstanden neue Leuchten, aber es fand keine kritische Auseinandersetzung mit der elektrischen Beleuchtung statt.
27 «INDUSTRIEDESIGN IST TEAMARBEIT»
Katharina Altemeier
Der junge Schweizer Industriedesigner Michel Charlot hat bereits zwei Leuchten für Firmen entworfen. Im Gespräch wird deutlich, wie pragmatisch die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Designer, Industrie und Technikern funktioniert.
30 LICHTILLUSIONEN
Katharina Altemeier
Dem jungen norwegischen Designer Daniel Rybakken geht es nicht um Objekte, sondern um Licht als architektonisches Element zur Gestaltung von Räumen. Er hat sich auf Trompe-l’Œil-artige Installationen spezialisiert, die die Wirkung von Tageslicht imitieren.
35 SIA
Beitritte zum SIA im 2. Quartal 2012 | Studienreisen Architektur und Kultur | Fort-
und Weiterbildung | Sitzung der ZO 3/2012
40 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
AN/AUS modern
Seit seiner Erfindung wurde das künstliche Licht vielfältig gestaltet und genutzt. Doch die Architekten und Gestalter der Moderne opferten atmosphärische Zwischentöne der reduzierten Gestaltung. So brachte das Neue Wohnen zwar neue Leuchten in den Wohnraum, aber eine kritische Auseinandersetzung mit der elektrischen Beleuchtung sucht man verge-bens. Das Licht der Moderne leuchtete vielmehr im öffentlichen Stadtraum.
Bereits in der Antike war der verschwenderische Umgang mit Licht ein Zeichen von Wohlstand und die Wahl der Leuchte ein Ausdruck von Geschmack und Distinktion. Spätestens mit der auf die Gasbeleuchtung folgende Elektrifizierung der Haushalte entwickelten sich jedoch private Beleuchtungskulturen, die sich von den kultischen Inszenierungen früherer Zeiten abgrenzten. Das indirekte Licht, das Flächen erstrahlen und glühen, quasi von innen her leuchten liess, war trotz spektakulärer Inszenierungen im öffentlichen Raum, besonders wenn es um die suggestive Wirkung beleuchteter Architekturen ging, kein Vorbild für den Wohnraum. Die dafür erforderliche Technik stand bereit, aber besonders die Architekten der Moderne bestanden in der Wohnung auf der Sichtbarkeit der Lichtquelle, während sie die Nachtwirkung ihrer Architekturen lichtgrafisch hevorzuheben versuchten. Die Übergangsphase vom Sonnenlicht des Tages zur neuen Helligkeit der Nacht wurde auf die Drehung eines Knebels reduziert, der nicht zufällig dem Gashahn ähnelte. So wurde das atmosphärische Potenzial wechselnder Lichtstärken einer mehr und mehr binären, auf Polaritäten reduzierten Empfindung angepasst: an/aus, hell/dunkel, ja/nein. Schattenreiche und Zwielicht überleben in der Moderne bestenfalls in literarischen und cineastischen Refugien, in der Wohnung aber schied man, nunmehr unabhängig vom Lauf der Gestirne, durch eine Handbewegung die Nacht vom Tag, ohne sich eines Verlustes bewusst zu werden.
Elektrische Sachlichkeit statt mutiger Experimente
Das Zeigen der nackten Glühlampe war zwar ein euphorisches Bekenntnis des Neuen Wohnens zur Maschine, doch das Offenlegen technischer Strukturen erschöpfte sich in der puristischen Provokation und blieb in der Anwendung oft unzulänglich. So karg und bescheiden oder kunstvoll und teuer die Leuchte auch gewesen sein mochte, sie blieb ein sichtbares Objekt und Teil der Einrichtung. Die Architekten des Neuen Bauens, dessen Ursprünge unter anderem in die Lebensreformbewegung zurückreichen, widmeten der natürlichen Belichtung der Wohnung besondere Aufmerksamkeit. Paradoxerweise kam die elektrische Beleuchtung als zeitgemässe Erweiterung der Möglichkeiten bei dieser Revolution zu kurz. Auch wenn Le Corbusier in der Villa Roche in Paris eine nackte Glühlampe an einem horizontalen Rohrausleger in den Raum auskragen liess, war die Lichtwirkung einer herkömmlichen Deckenleuchte vergleichbar, die ungewöhnliche Erscheinung beschränkte sich hauptsächlich auf die Tageswirkung. Der grosse, um mutige Experimente nicht verlegene Innovator machte keine Hehl aus seinen Problemen mit dem elektrischen Licht: «Wir stammeln noch die allerersten Anfänge einer ganz neuen Erfindung.» Seine Unentschiedenheit zwischen Konvention und Innovation ist kennzeichnend für die meisten Architekten der jungen Moderne. Zu tief war das Misstrauen gegen pathetische Konzepte aus Kult, Kirche und Kino. Sachlich war anders – oft heller, aber selten besser.
Zurückhaltung am Rande der Kargheit
Ein «Lob des Schattens» gar, wie es Jun’ichiro Tanizaki in seinem langen Essay für die Architektur Japans zu kultivieren suchte, findet man in der westlichen Architektur kaum. In der Wohnung und bei der Arbeit blieb Licht eine technische Angelegenheit und wurde keine atmosphärische oder gar künstlerische. Eine Ausnahme bildeten die Mitte der 1920er-Jahre in Mode kommenden Deckenfluter, die, obwohl formal reduziert, die Form antiker Amphoren oder Kohlenbecken zitierten. Sie warfen einen hellen Lichtschein unter die Decke und sorgten so mit starkem Licht von unten für eine weiche, relativ gleichmässige Beleuchtung.
Um dies zu erreichen, waren in den hohen Räumen der Gründerzeitbauten allerdings enorme Wattzahlen erforderlich. Sie blieben eine anachronistische, luxuriöse Referenz an feudale Inszenierungen, wie sie eher für die zeitlich parallele Art-déco-Strömung bezeichnend erscheinen. Der häufig verwendete «Luminator» war ein patentierter, hochglanzpolierter, trichterförmiger Aluminiumeinsatz, der das Licht einer kopfverspiegelten Glühlampe reflektierte (Abb. 01). Der Maharadscha von Indore kaufte Luminatoren für seinen Palast, Marcel Breuer setzte sie ein, und Ludwig Mies van der Rohe verwendete einen im eigenen Atelier. Letzten Endes aber waren auch die Deckenfluter Apparate zur möglichst schattenfreien Ausleuchtung und entsprachen dem Hang zum technisch-klinisch Klaren, das seinerseits für rationale Zweckmässigkeit stand. Zusammen mit dem Ornament sollte auch das dynamische Spiel von Licht und Schatten verschwinden, das Feuer und Flamme über Jahrtausende in die Wohnstätten gebracht hatten.
Es erstaunt, dass die sonst um subtile Sensationen bemühte Avantgarde diesen Bereich weitgehend unbearbeitet liess. Selbst in Mies van der Rohes mit Haustechnik üppig ausgestatteter Villa Tugendhat, der Apotheose des luxuriösen Purismus, blieb das Kunstlichtkonzept hinter den Möglichkeiten zurück. Noble Zurückhaltung am Rande der Kargheit auch hier. Mies, der die Frage des Neuen Wohnens stets als baukünstlerisches Problem begriff und nicht vorrangig als technisch-ökonomisches, verwendete meist handelsübliche Deckenleuchten von Louis Poulsen, wie sie ansonsten in Schulräumen und Ladenlokalen anzutreffen waren.
Besonderer Beliebtheit erfreuten sich Soffittenröhren, eigentlich Glühlampen, die von Le Corbusier und Gropius als Ausweis einer bedingungslos avantgardistischen Haltung ohne jeden Blendschutz frei vor der Wand oder unter der Decke angebracht wurden. Vom Hersteller waren sie als verdeckte Leuchtmittel in Vitrinen, Schränken und im Ladenbau vorgesehen. Die Avantgarde liebte die Röhre um ihrer visuellen Reize willen, die höher eingeschätzt wurden als die technischen Möglichkeiten.
Breuer setzte gern scheinwerferartige Spiegelleuchten im Wohnraum ein, die für den nicht einsehbaren Teil einer Schaufensteranlage gedacht waren, um die Auslagen zu beleuchten (Abb. 02). Auch hier blieb es bei einer demonstrativen Zurschaustellung technischer Apparate, deren Licht jedoch bestenfalls zweckdienlich war. Obwohl der Reflektor der Schaufensterstrahler gegen die Decke gerichtet wurde, vermied man die theatralische Wirkung selbstleuchtend wirkender Flächen, indem die Leuchte stets als technische Ursache präsent blieb, als Beleg für Objektivität und Aufrichtigkeit. Ihre maschinenartige Erscheinung selbst war Ausweis fortschrittlicher Haltung und kam der verbreiteten Abneigung gegen lampenloses Licht auf paradoxe Weise entgegen.
Das eigentliche Licht der Moderne erstrahlte anderswo: auf der Strasse, in den Bars, Kinos, Varietés und Tanzdielen (Abb. 03). Die Lichter der Grossstadt waren die ästhetische Brücke zwischen Expressionismus und Sachlichkeit, aber sie folgten keinem Manifest und nicht einmal einem Konzept. Die keinem Plan gehorchende nächtliche Sensation der elektrischen Symphonie vereinte Verfechter und Kritiker der Moderne in ihrer scheinbar mühelosen Selbstverständlichkeit. Sie war jedoch eher ein Gemeinschaftskunstwerk der städtischen Massen, zu dem alle mit dem Drehen eines Schalters beitrugen.TEC21, Fr., 2012.10.26
26. Oktober 2012 Bernd Dicke
«Industriedesign ist Teamarbeit»
Der Schweizer Industriedesigner Michel Charlot hat in seiner noch jungen Karriere bereits zwei Leuchten entworfen, die auf dem Markt erhältlich sind: Als Student an der Ecole Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) entwickelte er den Lampenschirm «Mold» aus Faserzement, der heute tatsächlich produziert wird. Jüngst hat er die LED-Spotfamilie «U-Turn» konzipiert.
Im Gespräch mit ihm wird deutlich, wie pragmatisch die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen einem jungen Designer, grossen Industrieunternehmen und Technikern funktioniert.
Katharina Altemeier: Herr Charlot, wie fühlt es sich an, wenn man als junger Designer nach dem Studium zum ersten Mal mit einem renommierten Hersteller zusammenarbeitet?
Michel Charlot: Es ist sehr befriedigend, weil ich genau mit diesem Ziel Design studiert habe. Mir geht es darum, ein interessantes Produkt zu machen, das funktioniert und sich gut verkauft.
K. A.: Das klingt sehr pragmatisch. Haben Sie diese Einstellung an der Ecole Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) vermittelt bekommen?
M. C.: Nach wie vor beenden an der ECAL im Schnitt etwa 30 Studierende pro Jahr ihr Studium. Nur sehr wenige von ihnen schaffen es, von ihrer Arbeit als Designer zu leben.
Und noch weniger können ihr eigenes Büro eröffnen. Die Schule und das Studium sind
eine Sache, aber man muss sich auch auf das Berufsleben vorbereiten.
K. A.: Wie ist Ihnen das gelungen?
M. C.: Die ECAL bietet vieles an, was andere Schulen nicht im Programm haben – zum Beispiel Workshops mit externen Designern, in denen man die Chance hat, Erfahrungen zu sammeln und sich auszutauschen. Zusätzlich gibt es immer wieder Zusammenarbeiten
mit Unternehmen, die einen bestärken und ermutigen. Dadurch bekommt man einen guten Einblick in den Alltag eines Herstellers, und manchmal ist es auch eine Gelegenheit, einen künftigen Kunden kennenzulernen.
K. A.: Wie ist die Leuchte «U-Turn» entstanden?
M. C.: Die Grundidee stammt, ehrlich gesagt, gar nicht von mir. Das Unternehmen kam auf mich zu, als ein interner Techniker schon einen Prototypen entworfen hatte.[1] Zu diesem Zeitpunkt wollten sie eine Leuchte mit zwei Spots und unterschiedlich grossen Leuchtköpfen entwickeln.
K. A.: Wie haben Sie sich als Designer in den Entwicklungsprozess eingebracht?
M. C.: Die Firma bat mich, diese Idee weiterzuentwickeln. Das habe ich gern gemacht, weil ich den Ausgangspunkt interessant fand. Nach etlichen Skizzen in 3-D und gemeinsamen Besprechungen haben wir uns entschieden, mit einer wesentlich simpleren Struktur zu beginnen. Allein diese Entscheidung war schon ziemlich harte Arbeit. Industriedesign ist interdisziplinäre Teamarbeit; die Firma und der Designer teilen sich die Verantwortung.
K. A.: Wie entwickelt man konkret eine Leuchte im Team?
M. C.: Insgesamt waren drei bis fünf Personen involviert. Wir haben uns über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren mindestens einmal im Monat getroffen. Ideen konnte jeder einbringen: Designer, Techniker, Produktmanager und Geschäftsführer. Unser Ziel war es, ein Produkt zu gestalten, das ins Auge fällt, aber unaufdringlich ist und sich gut verkauft. Es ging vor allem immer darum, alle technischen Möglichkeiten auszuloten, um sicher zu sein, dass wir die beste wählen. Der grösste Durchbruch war das magnetische Kugelgelenk. Diese Konstruktion ermöglicht direktes und indirektes Licht – und das mit nur einer Lichtquelle.
K. A.: Welche Rolle spielte die Lichttechnik?
M. C.: «U-Turn» wäre ohne LED-Technik so nicht möglich gewesen. Nur weil die Lichtquelle auf LED basiert und deshalb nicht so heiss wird, kann man den Leuchtenkopf einfach abnehmen und mit dem Licht spielen.
K. A.: Aber die Technik von heute wird morgen schon veraltet sein.
M. C.: Deswegen haben wir darauf geachtet, dass sich die Leuchte bei Bedarf auch modernisieren lässt. Die LED-Scheibe im Leuchtenkopf könnte man relativ leicht austauschen, wenn die Technologie sich weiterentwickelt.
K. A.: Mit den runden Vertiefungen erinnert die Oberflächenstruktur des Leuchtkopfs von «U-Turn» an einen Golfball.
M. C.: Das war eine Designentscheidung. Ich habe viele andere Optionen ausprobiert, bevor ich zu dieser kam. Ich finde, dass ein sportliches Design gut zu dieser Leuchte passt – auch weil der Benutzer mit ihr spielen soll. Ausserdem hat das Produkt so einen hohen Wiedererkennungswert.
K. A.: Wie wichtig waren Nachhaltigkeitsüberlegungen beim Design von «U-Turn»?
M. C.: Es ist in erster Linie wichtig, ein Produkt zu entwickeln, das der Käufer viele Jahre besitzen und benutzen möchte. Im Entwicklungsprozess wählt man immer wieder zwischen der einen oder anderen Einzellösung, weil sie eine grössere Nachhaltigkeit verspricht.
Bei «U-Turn» haben wir uns für sehr dauerhafte Materialen entschieden und für die Möglichkeit, die Leuchte technisch nachrüsten zu können.
K. A.: Ihre Leuchte «Mold», die Sie während des Studiums in einem Workshop entworfen haben, basiert in erster Linie auf einem ungewöhnlichen Umgang mit Faserzement. Wie wichtig sind Materialien für Sie?
M. C.: Im Fall von «Mold» war es so, dass wir Studierenden in einem Workshop gebeten wurden, neue Ideen für die Verarbeitung von Faserzement zu entwickeln. Aber an sich gehe ich als Designer nicht von einem bestimmten Material aus, sondern begreife jedes Material einfach als ein Mittel. Bei «U-Turn» haben wir zum Beispiel Hochdruck-Aluminiumguss für den Leuchtkopf verwendet, weil das Bauteil durch die gute Wärmeleitfähigkeit des Materials wie ein Kühlelement funktioniert.
K. A.: Wie beschreiben Sie Ihren Designansatz?
M. C.: Zuerst braucht es ein zukunftsfähiges Konzept, dann entwerfe ich sozusagen von innen nach aussen. Ich arbeite nicht auf eine von vornherein feststehende Form hin, die finale Gestalt eines Produkts ist vielmehr das Ergebnis eines langen Prozesses. Ausserdem habe ich den Anspruch, dass meine Produkte nützlich, intuitiv verständlich und langlebig sein sollen. Der Kunde muss denken: «Natürlich ist das so und nicht anders!» – das ist gar nicht so leicht zu erreichen.
K. A.: Mit «Mold» ist es Ihnen gelungen, eine Leuchte zu entwerfen, die auf dem besten Weg ist, ein Klassiker zu werden.
M. C.: Ich finde es wichtig, dass ein Produkt seine Zeit repräsentiert. An die Idee eines zeitlosen Klassikers glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass etwas, das einmal gut ist, auch über einen langen Zeitraum hinweg gut bleibt. Jean Prouvé hat gesagt, er gestalte lieber für eine Generation und nicht für die Ewigkeit, denn nur dann habe der Entwurf die Chance, den nachfolgenden Generationen standzuhalten.[2]
Anmerkungen:
[01] Vor etwa eineinhalb Jahren entstand der Kontakt des Designers zu Vitra, und wenige Wochen später kam die Anfrage von Belux, der zu Vitra gehörenden Leuchtenfirma.
[02] «Construisez pour l’éternité et ces objets deviendront peut-être des reliques du passé. Construisez pour une génération et ils serviront peut-être à plusieurs générations.» Aus einem Gespräch von Anniina Koivu mit Jean Prouvés Tochter Catherine; www.vitra.com/fr-fr/collage/design/catherine-prouv-ber-jean-prouv/TEC21, Fr., 2012.10.26
26. Oktober 2012 Katharina Altemeier