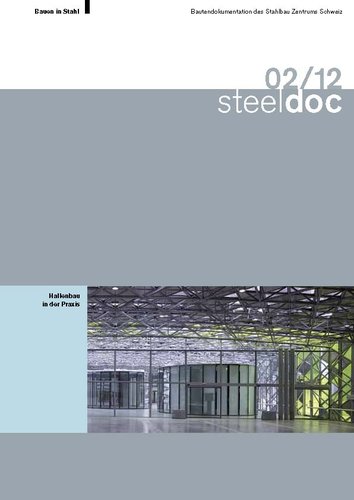Editorial
Stahl ist prädestiniert für den Industrie- und Hallenbau. Schon seit der frühen Industrialisierung wurden die Vorteile der grossen Stützenabstände und Spannweiten im Stahlbau für Fabrikationshallen genutzt – in jüngerer Zeit natürlich auch für Sport-, Freizeit- und Ausstellungshallen. Ein Hallenbau muss auch heute kostengünstig und praktisch sein, ist aber auch Imageträger der Firmenphilosophie und der Marke.
Angesichts der in unseren Vorstädten wild wuchernden Industriezonen ist es erstaunlich, dass es für den Industriebau noch keine städtebaulichen Gestaltungsrichtlinien gibt. Umso wichtiger scheint es, Bauherren und Planer für die Qualität von Industrie- und Hallenbauten zu sensibilisieren. Die Geschichte zeigt denn auch, dass sich die Qualität langfristig auszahlt: Attraktive Industriegebäude aus früheren Jahrhunderten werden heute zu Kulturdenkmälern erhoben und in teuren Wohn- und Lebensraum umgenutzt. Die Gestaltung von Hallenbauten richtet sich dennoch in erster Linie nach praktischen Parametern. Die Nutzung eines Gebäudes bedingt die Berücksichtigung von Lasten, Ausmassen und Produktionsabläufen oder Aktivitäten. Die Wahl der Tragstruktur hat also direkte Auswirkungen auf die Raumdimension, die Leitungsführung für technische Installationen und die langfristige Nutzbarkeit der Geschosse. Es werden deshalb meistens Struktur-Typen gewählt, die sich additiv oder modular erweitern lassen, was letztlich auch die Langlebigkeit des Gebäudes ausmacht.
Im vorliegenden Steeldoc zeigen wir Beispiele von Hallenbauten, bei denen sich Form und Funktion die Waage halten und die das Image der Bauherrschaft bewusst prägen. Die Ausgabe gibt praktische Anregungen, nachdem die Nummer 01/12 von Steeldoc die Grundlagen des Hallenbaus als Planungsleitfaden vorgestellt hat.
Wie immer geht die Dokumentation bis ins Detail, so dass sie praktische Anregung und Planungshilfe bietet. Wir wünschen viel Vergnügen beim Studium der folgenden Seiten von Steeldoc.
Evelyn C. Frisch
Inhalt
Editorial
Verkehrskontrollzentrum, Saint-Maurice CH
Ein «Blütenblatt» aus Stahl und Glas
Kundenhalle
Amada Solution Center, Haan D
Designzentrum
Cité du Design, Saint-Etienne F
Produktionshalle
Produktionshalle für Grossprodukte, KSB AG, Frankenthal D
Wartungshalle
A380-Wartungshalle Flughafen Frankfurt am Main D
Ausstellungshalle
Ener[gie]nger, München D
Sportzentrum Burkertsmatt, Widen CH
Spiel mit Transparenz und Spiegelungen
Impressum
Spiel mit Transparenz und Spiegelungen
Laufen sie durch oder nicht? fragt sich wohl jeder Architekt, der die kühnen Träger aus der Glasfassade ragen sieht. Die Sporthalle in Burkertsmatt zeigt, wie solche Details im Zeitalter der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gelöst werden. Ästhetischer Minimalismus mit viel technischem Know-how realisiert.
«Sport im Park», mit dieser Projektidee gewann Rolf Mühlethaler den Wettbewerb für das regionale Sport-, Freizeit- und Begegnungszentrum Burkertsmatt in Widen am Mutschellen. Der Gebäudekomplex mit seinen verschiedenen Aussenanlagen folgt der natürlichen Topographie des Hasenberges. Der präzis geschnittene Baukörper liegt am Fuss des Hanges und bildet mit dem gegenüberliegenden Islerenwald den Raum für die Leichtathletikanlage. Fussgänger- und Fahrradverbindungen, Hangmauern, Baumreihen und der offen gelegte Pflanzerbach gliedern das offene Gelände und verleihen dem Ort die gewünschte Identität als Park. Mit dem transparent gestalteten Baukörper lässt der Architekt Innen- und Aussenraum ineinander fliessen und schafft einheitliche Fassaden ohne ausgeprägte Vorder- und Rückseiten.
Über eine grosszügig angelegte Zugangsrampe gelangt man zum Halleneingang auf der öffentlichen Terrasse, der Bel Etage, von der man die Leichtathletikanlage, die Fussballfelder und das Beach-Volleyballfeld überblicken kann. Hier, im eigentlichen Obergeschoss, befinden sich das Foyer und die Vereinsküche sowie die Zuschauertribünen. Im Erdgeschoss sind die Sporthalle, die Garderobenanlagen, der Jugendbereich und die Technikräume untergebracht. Auf demselben Niveau befindet sich die Aussentribüne zur Leichtathletikanlage und zu den Fussballfeldern.
Dank der kompakten und zentralen Anordnung zwischen den Hallen- und Aussenanlagen können die Garderoben je nach Veranstaltungsdichte getrennt oder gemeinsam für Innen- und Aussenanlässe genutzt werden.
Ausgeklügelte Horizontalaussteifung
Die Tragkonstruktion der Sporthalle Burkertsmatt ist auf drei statische Hauptelemente reduziert: Hauptstützen (HEB 320), Blechträger (1400/300 mm) und Dachblech. Die über 50 Meter frei gespannten Dachträger liegen jeweils auf zwei 9 Meter hohen Stützen, die auf der Bodenplatte des Erdgeschosses fundiert und auf Niveau Obergeschoss in der Stahlbeton-Tribüne seitlich gehalten sind. Die Aussteifung der Konstruktion gegen horizontale Erdbeben- und Windkräfte wird über das als Scheibe ausgebildete Dachblech und die eingespannten Stützen erreicht. Tatsächlich stellte für den Ingenieur die Stabilisierung der schlanken Blechträger gegen das seitliche Ausknicken (Kippen) des Druckflansches bei der Tragwerkskonzeption die grösste Herausforderung dar. Um die Stabilisierung zu gewährleisten, wurde das Dach mit Trapezblech, Verlegehilfe-Blech und einem zusätzlichen Verstärkungs-Z-Blech als statische Scheibe ausgebildet. Träger, Dachbleche und die integrierten Verstärkungsbleche wurden mit Nieten und Nägeln statisch miteinander verbunden. Diese Scheibenkonstruktion dient nun zugleich der horizontalen Lastabtragung der Erdbeben und Windkräfte auf die eingespannten Stützen.
Die mit den Stützen verschraubten sichtbaren Blechträger wurden wegen ihrer Länge vor Ort jeweils an zwei Stellen verschweisst und die Montageschweissnähte mittels Ultraschall geprüft. Die Träger, die in der Mitte 120 Millimeter überhöht wurden, kragen auf der einen Hallenseite um 5, auf der gegenüberliegenden um 1,6 Meter über die nach innen versetzte Fassade hinaus. Dort, wo sie die Glasfassade durchdringen, sind die innenliegenden Träger von den auskragenden Partien mit einer Schicht Wärmedämmung getrennt und nur punktuell mit Stahlplatten und Schrauben verbunden. Zugstangen eben den Fassadenstützen minimieren die vertikalen Verformungen der Träger in diesem empfindlichen Bereich.
Dosierte Transparenz
Die Fassaden bestehen aus einer selbsttragenden Pfosten-Riegel-Konstruktion mit einer Rasterbreite von 1,68 Metern und einer Gesamthöhe von 6,83 Metern. An den Fassadenstützen (IPE 180) befinden sich auf einer Höhe von 2,3 Metern Fugenhalter in Form von Flachstahl-Auslegern. Auf ihnen ruhen die oberen Glaselemente. So können die Vertikallasten aus der Fassade in die Stahlbetonkonstruktion des Sockelgeschosses abgeleitet werden. Die Fassadenstützen sind im Randbereich der Dachkonstruktion so eingespannt, dass sie einen kleinen Teil der Dachlasten abtragen. Ausserdem übernehmen sie die auf die Fassadenpfosten wirkenden Windlasten.
Spezialverglasungen mit eingebautem Vlies aus Seidengespinnst in den unbeschatteten Ost- und Westfassaden verhindern störendes Blenden. Gleichzeitig lässt diese abgestufte Transparenz die Halle in Nord-Südrichtung um so offener und transparenter erscheinen. Die Landschaft fliesst förmlich durch das Gebäude hindurch.
Die Ruhe selbst
Grau- und Silbertöne prägen den Innenausbau sowie das äussere Erscheinungsbild. Nur der auf dem Betonsockel aufgesetzte Glaskörper hebt sich ab und spiegelt die Farben der Umgebung und des Himmels. Im Innern wurden die technischen Einrichtungen konsequent in die Wände und Decken integriert. So wirkt auch die vom Trapezblech profilierte Deckenuntersicht der Sporthalle äusserst ruhig und elegant. Ein Ort für Sport und Bewegung, der Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt.Steeldoc, Mo., 2012.10.15
15. Oktober 2012 Evelyn C. Frisch, Virgina Rabitsch
Ein «Blütenblatt» aus Stahl und Glas
Die 60 Meter lange Halle neben der Autobahn bei Saint-Maurice beherbergt ein Kontrollzentrum für den Schwerverkehr. Unter der Blechverkleidung versteckt sich ein ausserordentlich komplexes und dichtes Stahltragwerk. Das Gebäude entspricht dem Minergiestandard und den Normen für erdbebengerechtes Bauen.
Ein grossflächiger Schwarzbelag, darauf ein siebeneckiges begrüntes Flachdach mit Oberlichtern, die scheinbar zufällig wie Konfettis darüber gestreut sind, und am Boden verteilt ein paar Blumen. So ungefähr präsentiert sich die Projektidee für das Fahrzeugkontrollzentrum in Saint-Maurice (VS). Das Projekt ging aus einem Architekturwettbewerb hervor, den das Büro meier + associés aus Genf gewann. Übertragen in den Massstab eins zu eins, stellt die asphaltierte Ebene einen grossen Parkplatz für Lastwagen dar. Die «grünen Blumen», die den Asphalt durchdringen, sollen als Naturflächen die Versickerung des Meteorwassers sicher stellen, und unter dem grossen Dach befinden sich die diversen Räumlichkeiten des Kontrollzentrums. Das Raumprogramm war breit gefächert: Ein Kontrollzentrum für Lastwagen, die auf dem Walliser Strassennetz verkehren, sowie Abstellplätze, auf denen diese Fahrzeuge im Falle von Unwetter in den Alpen warten können. Ausserdem waren eine Halle für periodische Kontrollen der leichten und schweren Fahrzeuge für das Unterwallis sowie ein regionaler Polizeiposten verlangt. Im Schnitt macht das Gebäude den auf dem Gelände vorhandenen Höhenunterschied zum Thema, das auch mit der Raumaufteilung im Innern wieder aufgenommen wird. Im Nordwesten, im höher gelegenen Teil, befindet sich der Eingang zu den Büros des regionalen Fahrzeugkontrollzentrums. Von diesem Bereich aus überschaut man die über zwei Geschosse reichende Kontrollhalle, die eine Spannweite von 21,5 Metern aufweist und im Süden von den Räumlichkeiten der Polizei begrenzt wird.
Ein Präzisionspuzzle
Das Stahlskelett des Gebäudes beeindruckt mit seinen imposanten Dimensionen. Besonders faszinierend war das Dach, dessen Träger der Primärkonstruktion eine maximale Höhe von 1700 Millimetern und eine Länge von etwas mehr als 60 Metern aufweisen, während der Bauphase. Für das Stahlbauunternehmen bedeutete der Transport dieser Träger eine grosse logistische Herausforderung. Sie wurden in der Werkstatt in je zwei ungefähr 30 Meter langen Teilen vorfabriziert.
Das Tragsystem besteht aus ausbetonierten Stahlstützen, Zwischendecken aus Beton sowie aus geschweissten Blechträgern von variabler Höhe. Um die Erdbebensicherheit des Tragwerks zu gewährleisten, waren zwei Aussteifungsebenen notwendig. Die eine übernimmt die einwirkenden Kräfte der Pfetten auf der Ebene des Dachblechs, welches das Substrat der Dachbegrünung trägt, die andere, im unteren Bereich der Dachträger, kanalisiert die Belastungen der durchlaufenden Balken und leitet sie in die vertikalen Tragelemente ein. Frédéric Rossoz von der Firma Sottas betont denn auch: «Wir haben viel Zeit für die Planung aufgewendet, denn nicht nur das Tragwerk war komplex, zusätzlich mussten wir die Leitungen der technischen Installationen in die Trägerebene einbauen.» Tatsächlich sind in den Stegen der Träger Löcher mit verschiedenen Durchmessern, die genau auf die Leitungsführung der Haustechnik abgestimmt sind.
Für den Ingenieur bestand eine der grössten Herausforderungen darin, eine «einfache» Tragstruktur zu entwerfen, welche die komplexen geometrischen Ansprüche erfüllt und in der konstruktiven Ausbildung die verschiedenen architektonischen Aspekte berücksichtigt. Äusserst anspruchsvoll war es auch, mit ein und derselben Aussteifung im Dach sowohl die Stabilität der hohen Träger als auch die Erdbebensicherheit der Tragstruktur gewährleisten zu können.
Im Hinblick auf die geforderten Spannweiten, die Tragwerksform und die grossen Auskragungen drängte sich der Stahlbau für dieses Projekt auf.
Korrosionsschutz
Der Stahl wurde mit Sandstrahlen und zwei Anstrichen im Innern, bzw. drei Anstrichen im Bereich des Vordachs vor Korrosion geschützt. Die Werkstattschweissnähte bei den Verbindungsplatten der Hauptträger und den Kopfplatten der Aussteifungselementen sind QB geprüft. Das Tragwerk ist jedoch nur noch im Bereich des Vordachs sichtbar, da die inneren Oberflächen mit Metallkassetten verkleidet sind. Damit soll der industrielle Charakter des Gebäudes unterstrichen werden. Aussen wurden die Fassaden mit einer Haut aus verzinktem Streckmetall umhüllt.
Schwebende Grünfläche
Baubeginn war im März 2010 und Fertigstellung genau nach Plan im Dezember 2011. Die Montage des Stahlbaus dauerte neun Wochen, dazu kamen vier Wochen für das Verlegen der Dachbleche. Der Stahl-Glaskomplex mit seinem Dach, das wie ein Stück des natürlichen, nach oben verschobenen Bodens über der künstlichen Oberfläche schwebt, soll von der Autobahn aus als Aushängeschild der neuen Institution wahrgenommen werden.Steeldoc, Mo., 2012.10.15
15. Oktober 2012 Evelyn C. Frisch, Virgina Rabitsch