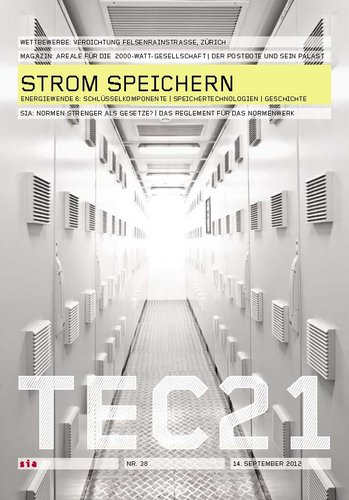Editorial
Rund 40 % der Schweizer Stromproduktion (25 TWh pro Jahr) stammen derzeit aus Kernkraftwerken.1 Die Energiestrategie des Bundes, deren Details in den nächsten Tagen veröffentlicht werden, sieht vor, im Zuge des Ausstiegs aus der Kernenergie den Grossteil davon bis 2050 durch Strom aus Fotovoltaik- bzw. Windanlagen (10.4 bzw. 4 TWh/a) zu ersetzen.[2] Wenn man sich vergegenwärtigt, dass Wind und Sonne in der Schweiz heute einen Bruchteil dieser Menge beisteuern – Fotovoltaik 0.083 TWh/a, Windturbinen 0.037 TWh/a –, wird das Ausmass dieses Umbaus der Stromversorgung deutlich.[1] Hinzu kommt, dass die Stromproduktion aus Wind und Sonne wetterbedingt und je nach Tages- und Jahreszeit stark schwankt. Je höher der Stromanteil aus diesen Quellen wird, desto stärker macht sich dieser Effekt bemerkbar. Es wird künftig dazu führen, dass zu Zeiten optimaler Leistung die Stromproduktion den -bedarf deutlich übersteigen kann («Schlüsselkomponente für die Energiewende»). Umgekehrt kann in Zeiten schwacher Produktion der Bedarf wesentlich höher sein. Um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, müssen Kraftwerke, deren Stromproduktion sich nach Bedarf regeln lässt – in der Schweiz vor allem Wasserkraft-Speicherwerke –, die Produktionslücken füllen. Für den Umgang mit Stromüberschüssen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können entweder in Regionen mit momentanem Strombedarf transportiert werden, was aber entsprechende Übertragungskapazitäten erfordert.
Deren Ausbau ist eine weitere Herausforderung bei der Umsetzung der Energiewende. Oder man kann versuchen, den Stromverbrauch zu beeinflussen, was aber ebenfalls aufwendig und nur begrenzt möglich ist (vgl. TEC21 12/2011). Die dritte Option ist die Speicherung des Stroms. Die Schweiz ist mit ihren Pumpspeicherkraftwerken hier in einer relativ komfortablen Situation. Trotz den geplanten Ausbauprojekten – TEC21 wird in einer der kommenden Ausgaben darauf eingehen – wird deren Speicherleistung aber nicht ausreichen. Je nach Standort der Fotovoltaik- oder Windanlage empfehlen sich zudem Speicher, die näher am Ort der Produktion bzw. des Verbrauchs liegen, um weite Transporte zu vermeiden. Forschung und Industrie arbeiten daher an alternativen Speicherlösungen, einer weiteren Schlüsselkomponente für die Energiewende. Viele der dafür infrage kommenden Technologien kennt man schon lange («Eine kurze Geschichte der Energiespeicherung»), entwickelt sie nun aber weiter («Speichertechnologien für das Stromnetz»). Soll die Energiewende in der Schweiz mehr sein als ein hehres Ziel, ist es nun vordringlich, diese Vielzahl an enormen Herausforderungen entschlossen anzugehen.
Claudia Carle
Anmerkungen:
[01] Bundesamt für Energie: Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2011. Bern, 2012
[02] Pascal Previdoli: Energiestrategie 2050. Bundesamt für Energie, Mai 2012
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Verdichtung Felsenrainstrasse, Zürich
11 MAGAZIN
Areale für die 2000-Watt-Gesellschaft | Der Postbote und sein Palast | Kurzmeldungen
20 SCHLÜSSELKOMPONENTE FÜR DIE ENERGIEWENDE
Stefan Linder
Je höher der Anteil von Wind- und Sonnenenergie an der Stromversorgung wird, umso wichtiger werden Energiespeicher, um ihre stark schwankende Stromproduktion möglichst vollständig nutzen zu können.
24 SPEICHERTECHNOLOGIEN FÜR DAS STROMNETZ
Andreas Ulbig
Für die kurz- oder längerfristige Stromspeicherung stehen eine ganze Reihe verschiedener Technologien zur Verfügung, die sich hinsichtlich Standortansprüchen, Kosten, Wirkungsgraden und Entwicklungsreife unterscheiden.
27 EINE KURZE GESCHICHTE DER ENERGIESPEICHERUNG
Norbert Lang
Schon vor Jahrhunderten nutzten die Menschen einfache Energiespeicher. Bis in die heutige Zeit sucht man für bekannte Speicherarten immer wieder neue Anwendungsmöglichkeiten.
31 SIA
Rhetorik statt Powerpoint | Normen strenger als Gesetze? | Kurzmitteilungen | Das Reglement für das Normenwerk
35 MESSEN
Herbstseminar Bau- und Energiemesse
37 FIRMEN | PRODUKTE | FCSI | IWB | Flumroc
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Speichertechnologien für das Stromnetz
Der Ausbau der Stromerzeugung mit Windturbinen und Fotovoltaik erfordert grössere Speichermöglichkeiten, um die schwankende Stromproduktion mit dem Strombedarf in Einklang zu bringen. Für die kurz- oder längerfristige Speicherung stehen eine ganze Reihe verschiedener Technologien zur Verfügung, die sich hinsichtlich Standortansprüchen, Kosten, Wirkungsgraden und Entwicklungsreife unterscheiden.
Sowohl für die kurzfristige Pufferung von Stromerzeugungs- und Lastspitzen über wenige Minuten bis hin zu mehreren Stunden als auch für die mittel- und längerfristige Zwischenspeicherung von Energie über mehrere Tage bis Monate existieren verschiedene Speichertechnologien. Die Spanne reicht von mechanischen Speichern, in denen Energie in Form von kinetischer oder potenzieller Energie gespeichert wird, über thermische Speicher, in denen Energie mittels thermodynamischer Wärme- und Kälteprozesse in Form von thermischer Energie gespeichert wird, bis hin zu elektrochemischen Speichern, bei denen Energie in Form von chemischen Bindungen gespeichert wird. Ebenso gibt es auch Speichertechnologien, in denen Mischformen realisiert sind. Im Folgenden werden die derzeit relevantesten Technologien für die Speicherung von Strom aus erneuerbaren Quellen vorgestellt.
Mechanische Speicher
Pumpspeicher und Speicherseen: Die mit grossem Abstand am meisten genutzte Speichertechnologien für das Stromnetz (>99 % der weltweit genutzten Speicherkapazität) sind Pumpspeicher und Speicherseen. Pumpspeicher werden normalerweise zur kurzfristigen Energiespeicherung (wenige Minuten bis viele Stunden) verwendet und haben einen Wirkungsgrad von etwa 80–85 %. Speicherseen mit ihrer teilweise riesigen Speicherkapazität können zusätzlich für den mittelfristigen Energieausgleich über mehrere Tage und Wochen und auch als saisonale Speicher über mehrere Monate verwendet werden. Die Schweizer Speicherseen können mit ihrer Speicherkapazität von ca. 9 TWh mehr als 10 % des jährlichen Stromverbrauchs zwischenspeichern (ca. 60 TWh). Das vorhandene, stark von der Geografie abhängige Potenzial für Pumpspeicher und Speicherseen wird in den meisten Ländern bereits zum grösseren Teil genutzt. Das Ausbaupotenzial ist aus diesem Grund sowie durch Umweltauflagen weltweit begrenzt.
Schwungräder: Ein solches Speichersystem wird geladen, indem beim Beschleunigen eines Schwungrades durch einen Elektromotor elektrische Energie in Rotationsenergie umgewandelt wird. Beim Entladen wird das Schwungrad durch den Generator gebremst und kinetische wieder in elektrische Energie zurückgewandelt. Vorteile von Schwungrädern sind die sehr schnelle Zugriffszeit (im Millisekundenbereich), keine Probleme bei einer Tiefenentladung, die bei Batterien zu einer vorschnellen Alterung führt, und der hohe Wirkungsgrad (>97%) beim Einsatz als Kurzzeitspeicher für wenige Minuten. Zudem können sie an nahezu jedem Standort installiert werden. Die Lebensdauer ist mit über 100 000 Speicherzyklen sehr hoch. Der wichtigste technische Nachteil ist, dass bei Speicherzyklen, die länger als ein paar Minuten dauern, die Reibungsverluste durch das Rotorlager sehr schnell ansteigen. Beim 2011 in Stephentown im US-Gliedstaat New York realisierten Projekt (20 MWel, 5 MWh) beträgt der Verlust nach einer Stunde Speicherzeit ca. 50 % (Abb. 1 und 2).
Druckluftspeicher: In einem Druckluftspeicher (Compressed Air Energy Storage [CAES]) wird komprimierte Luft als Speichermedium verwendet. Beim Ladevorgang verdichtet ein elektrischer Kompressor Umgebungsluft auf einen Druck von ca. 50 – 75 bar. Die dabei entstehende Abwärme wird je nach Art des Druckluftspeichers entweder in einem zusätzlichen Wärmespeicher gespeichert oder ungenutzt an die Umgebung abgegeben. Die abgekühlte Druckluft wird in einem grossen unterirdischen Speicher, z. B. einer luftdichten Salzkaverne, eingelagert. Beim Entladevorgang treibt die herausströmende Druckluft eine Turbine an und erzeugt dadurch Strom. Da sich Druckluft beim Entspannen sehr stark abkühlt, muss diese vorher noch erhitzt werden, entweder durch den noch heissen Wärmespeicher, durch das Verbrennen von Erdgas oder durch beides. Weltweit gibt es bisher erst zwei Druckluftspeicher, allerdings sind beide schon jahrzehntelang in Betrieb. Die erste Anlage (321 MWel, 640 MWh) wurde 1978 ohne Wärmespeicher und daher nur mit einem Wirkungsgrad von 40 % in Huntorf in Niedersachsen, Deutschland, erbaut (vgl. TEC21 42-43/2007). Ein zweites Kraftwerk (110 MWel, 2860 MWh) ist seit 1991 im US-Gliedstaat Alabama in Betrieb und besitzt zumindest einen kleinen Wärmespeicher, wodurch die Effizienz auf 54 % ansteigt. Die nächste Generation, sogenannte adiabate Druckluftspeicher, soll deutlich grössere Wärmespeicher besitzen, die das Erhitzen der Druckluft durch Erdgas bei einem normalen Speicherzyklus überflüssig machen. Das Ziel ist es, eine Speichereffizienz von 75 bis 85 % zu erreichen. Diese nimmt bei längerer Speicherdauer (> 1 Tag) allerdings ebenfalls deutlich ab. Die erste Anlage im Industriemassstab (90 MWel, 360 MWh) soll 2013 in Stassfurt in Sachsen-Anhalt, Deutschland, gebaut werden. Geeignete Standorte liegen in Europa vor allem nahe der Nordseeküste, wo es sowohl grosse unterirdische Kavernen als auch viele Windparks gibt.
Elektrochemische Speicher
Batterien: Es existieren zahlreiche Batterietechnologien, die für die Zwischenspeicherung von Strom aus Wind- und PV-Anlagen geeignet sind. Unterschieden wird zwischen Batteriesystemen mit internem Energiespeicher, wie die bekannten Lithium-Ionen-Batterien, und solchen mit externem Speicher, sogenannten Flussbatterien wie z. B. Redox-Flow-Batterien. Bei letzteren wird die Elektrolytflüssigkeit, das eigentliche Energiespeichermedium, zwischen zum Teil hausgrossen Tanks und dem Energiekonverter hin- und hergepumpt. Als Elektrodenmaterialien werden u.a. Zink oder Vanadium eingesetzt. Der Gesamtwirkungsgrad von Flussbatterien kann bis zu 75 % betragen. Weltweit sind zahlreiche Flussbatterien, meistens Vanadium-Redox-(VR)-Batteriezellen, im Einsatz. Die beiden grössten VR-Batteriesysteme werden in Japan (4 MW, 6 MWh), als Energiepuffer für einen Windpark, und im US-Gliedstaat Kalifornien (0.6 MW, 3.6 MWh), zur Reduktion der teuren Spitzenlast einer Industrieanlage, verwendet. Die Vorteile von modernen Batterietechnologien mit internem Energiespeicher, wie Lithium-Ionen und anderen, liegen in den hohen Wirkungsgraden (>80 – 85 %), in der sehr schnellen Reaktionszeit im Millisekundenbereich und damit im flexiblen Einsatz in Netzanwendungen. Die Energiespeicherkapazität aller Arten von Batteriesystemen ist aber klein im Vergleich zu Druckluft- und Pumpspeichern. Der grösste Nachteil sind die immer noch sehr hohen Investitionskosten von Batterien im Vergleich zu Pumpspeichern. In den letzten zwei Jahren sind die Batteriepreise allerdings deutlich gesunken. Die grösste Lithium-Ionen-Batterie der Schweiz (1 MWel, 500 kWh), ein Kooperationsprojekt der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) und von ABB Schweiz, ist seit Frühjahr 2012 in Dietikon ZH im Einsatz (vgl. Titelbild). Zeitgleich wächst schweizweit die Zahl an «Plug-in»-Elektro-/Elektrohybrid-Autos, die direkt am Stromnetz aufgeladen werden können. Die aggregierte Batteriekapazität von Elektroautoflotten ist neben stationären Batteriesystemen eine weitere für den Netzbetrieb interessante Speicherquelle.
Wasserstoffelektrolyse: Bei der Elektrolyse wird Wasser (H2O) durch Gleichstrom in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) zerlegt. Der grosse Vorteil von Wasserstoff ist seine hohe Energiedichte. Daher können durch Elektrolyse sehr grosse Strommengen in chemische Energieträger umgewandelt werden, wodurch sie neben Speicherseen eine der wenigen technischen Optionen ist, mit der die saisonalen Produktionsschwankungen von erneuerbaren Energiequellen effektiv ausgeglichen werden können. Der Gesamtwirkungsgrad liegt allerdings im besten Fall – bei Elektrolyse und anschliessender Stromerzeugung in einer Brennstoffzelle oder einem Gaskombikraftwerk – bei nur 40 – 45 %. Ausserdem ist die grossmassstäbliche Speicherung von Wasserstoff technisch nicht ganz einfach und somit teuer. Eine mögliche Zwischenlösung wäre die Beimischung zum Erdgas: Ein Wasserstoff-Anteil von 5 – 10 % im Erdgasnetz ist technisch möglich.
Methanisierung von Wasserstoff: Um langfristig grosse Strommengen chemisch zwischenspeichern zu können, ist ein weiterer Prozessschritt denkbar: die Methanisierung von Wasserstoff zu Methan (CH4) (Abb. 5). Dies hat den Vorteil, dass das bestehende Erdgasnetz inklusive grosser, unterirdischer Gasspeicherkavernen problemlos genutzt werden kann, denn Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas. Die problematische Wasserstoffspeicherung wäre damit elegant umgangen. Der Gesamtwirkungsgrad sinkt gegenüber der einfachen Wasserstoffelektrolyse allerdings auch im besten Fall (grosstechnische Umsetzung mit bestem technischen Wirkungsgrad) auf ca. 30–40 %. Da in vielen Ländern die Potenziale von Pumpspeichern und Speicherseen begrenzt sind, haben Wasserstoffelektrolyse und Methanisierung – oft als «Power-to-Gas» bezeichnet – als Speicherprozesse grosses Potenzial. In Deutschland beträgt die Speicherkapazität von Pumpspeichern zum Beispiel nur ca. 0.04 TWh. Die Speicherkapazität des Erdgasnetzes und der Erdgasspeicher ist mit ca. 200 TWh mehrere Grössenordnungen höher und beträgt ungefähr ein Drittel des jährlichen Stromverbrauchs (ca. 550 TWh). Die saisonale Zwischenspeicherung von PV-Strom aus dem Sommer- in das Winterhalbjahr erscheint so technisch machbar. Eine erste Testanlage (25 kWel) wird seit 2009 am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in Stuttgart betrieben. Das CO2 für den Prozess wird aus der Luft entnommen. In einer zehnmal grösseren industriellen Testanlage soll ab Ende 2012 das CO2 direkt aus industriellen Prozessen gewonnen werden.
Thermische Speicher
Elektrothermische Speicher: Eine noch sehr neue Idee ist die Nutzung von elektrothermischen Speichern. Hierbei werden zwei Wärmespeicher, zum Beispiel grosse Wassertanks, miteinander verbunden. In der Ladephase wird in einem Kraft-Wärme-Prozess durch eine Wärmepumpe künstlich ein Temperaturunterschied zwischen den beiden Wärmespeichern erzeugt. In der Entladephase wird im umgedrehten Wärme-Kraft-Prozess durch das Temperaturgefälle zwischen den Wärmespeichern mechanische Kraft und schliesslich elektrischer Strom produziert. Der grosse Vorteil gegenüber anderen grosstechnischen Speichern ist, dass elektrothermische Speicher an fast jedem beliebigen Standort gebaut werden können. Bisher existieren solche Speichersysteme nur in Form von technischen Konzepten und Patenten. Erste Prototypentwicklungen finden zurzeit u.a. bei ABB Schweiz statt. Als Ziel werden Gesamtwirkungsgrade von 50 – 75 % angestrebt.
Anmerkungen:
[01] Internationale Energieagentur (IEA): Energy Technology Perspectives 2012. Paris, 2012
[02] M. Sterner, C. Pape: Towards 100 %: Integration of RE, simulation, scenarios and storage by linking power and gas grids. Vortrag EREF, Brussels, 9.2.2011TEC21, Fr., 2012.09.14
14. September 2012 Andreas Ulbig