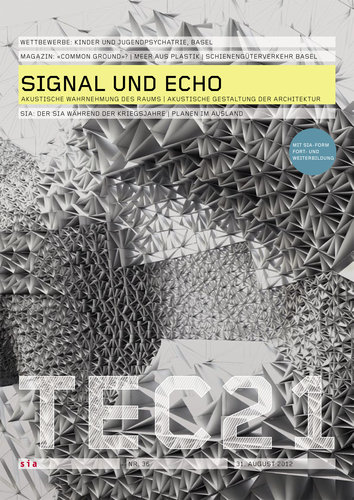Editorial
«Öffnet euch, ihr beiden Ohren […].» Der Weckruf aus Johann Sebastian Bachs Kantate «Er rufet seinen Schafen mit Namen»[1] ist Programm: Es geht in diesem Heft um das räumliche Hören, mit beiden Ohren. In unserer Akustikreihe sind wir bisher der Ausbreitung des Schalls in Räumen (TEC21 11/2012) und musikalischen Formen des Schalls in dafür geschaffenen Umgebungen (TEC21 20/2012) nachgegangen. Der Weg des Schalls von der Quelle zum Menschen lässt sich mit den Werkzeugen der Physik beschreiben und verstehen. Die Akustik optimiert diesen Weg mit physikalischen und architektonischen Massnahmen. Jetzt betrachten wir die Perzeption des Schalls,2 die Transformation von physikalisch einfach zu beschreibenden Luftdruckschwankungen in die sinnlichen Erlebnisse, die das Hören von Musik vermitteln kann.
Was geht beim «Hören», das das Ziel jeder akustischen Darbietung ist, im Menschen mit offenen Ohren vor?
Der Elektroakustiker Jürgen Strauss zeigt, dass eine rein medizinische Beschreibung, die auf das mechanische Zusammenwirken von Trommelfell, Hammer, Amboss bis zu den Nervenenden und Hirnarealen fokussiert, zu kurz greift – Hören ist mehr als Mechanik, mehr als Neurologie, das Gehör ist kein eindimensionales Sinnesorgan. Es vermittelt schon in einem sehr frühen kindlichen Entwicklungsstadium Informationen über Ort, Raum und Umgebung, mithin also die Grundlagen dessen, was der Mensch später als «Architektur» erlebt. «Hören» bedeutet beim Menschen die auditive Wahrnehmung seiner Umgebung, die Gewinnung von je nach den Umständen gar lebenswichtigen räumlichen Informationen auf auditivem Weg. Deshalb ist der Aufenthalt in einem schalltoten Raum für Menschen unangenehm, kann das Fehlen räumlicher Orientierung zu panischen Reaktionen führen.
Ein sinnliches architektonisch-räumlich-akustisches Erlebnis verspricht der projektierte Bau des Museum of Modern Art (MomA) in Warschau von Christian Kerez. Das Beschallungssystem von Strauss Acoustics stellt die Sprachverständlichkeit im gewaltigen und halligen Volumen der «Huge Hall» sicher. Dank seinem akustischen Potenzial wird das Haus zu einem monumentalen Musikinstrument, das von Orgeldonner bis zum Zirpen einer Grille jeden Klang präzise wiedergeben kann. Und wenn die Elektronik nicht aktiviert ist, wird man «still und gespannt hineinhören in die Tiefe der niemals ganz schweigenden akustischen Raumantwort».
Rahel Hartmann Schweizer, Aldo Rota
Anmerkungen:
[01] Kantate «Er rufet seinen Schafen mit Namen», Bach-Werkverzeichnis 175, 6. Aria B, z.B. auf www.bach-cantatas.com/BWV175.htm
[02] Auch die technische Erzeugung von Schall werden wir in weiteren Folgen behandeln
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Basel
10 MAGAZIN
Ist es «Common Ground»? | Meer aus Plastik | Schienengüterverkehr Basel
16 AKUSTISCHE WAHRNEHMUNG DES RAUMS
Jürgen Strauss
Sprachverständlichkeit, Musikübertragung und Lärmbekämpfung sind in der Raumakustik vergleichsweise gut bewältigt. Das gestalterische Potenzial der Eigenheiten von Lokalisation, Raumeindruck und Umhüllung hingegen ist längst nicht erschöpft.
22 AKUSTISCHE GESTALTUNG DER ARCHITEKTUR
Jürgen Strauss
Christian Kerez’ Projekt für den Bau des Museum of Modern Art (MomA) in Warschau ist ein architektonisch aussergewöhnlicher Wurf. Denn es verbindet visuelle und akustische Gestaltung in kongenialer Weise.
31 SIA
Fort- und Weiterbildung | Der SIA während der Kriegsjahre | Planen im Ausland
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Akustische Wahrnehmung des Raums
Wann der Mensch die Fähigkeit ausbildet, die Quelle eines Schallereignisses zu lokalisieren, hat die Wissenschaft geklärt – nicht aber die komplexen Prozesse, die das Zusammenspiel der auditiven Wahrnehmung mit den anderen Sinnen regeln – wiewohl sich immerhin Analogien zwischen akustischer und visueller Wahrnehmung ausmachen lassen. Doch während Phänomene optischer Wahrnehmung in den visuellen Künsten ausgiebig genutzt werden, ist die sinnliche Dimension des auditiven Erlebens noch zu wenig erschlossen. Im Gegensatz zu funktionalen Aspekten – Sprachverständlichkeit, Musikübertragung und Lärmbekämpfung –, die in der Raumakustik vergleichsweise gut bewältigt sind, ist das gestalterische Potenzial der Eigenheiten von Lokalisation, Raumeindruck und Umhüllung noch längst nicht erschöpft.
Es ist weder für das Gattungswesen Mensch noch für den individuellen Entwicklungsgang als geklärt zu betrachten, wie und in welcher Reihenfolge die Sinne entstanden sind bzw. erwachen, wie sie in ein Zusammenspiel treten und so selbst erhaltendes Leben ermöglichen. Gewiss erscheint jedoch, dass die Gestalt und die Leistungsfähigkeit der wahrnehmenden Körper das Resultat eines evolutionären Anpassungs- und Abstimmungsvorgangs sind, der die Organismen mit ihrer Umwelt sinnlich verbindet. Die Tatsache unserer Existenz ist Beleg für den Umstand, dass uns die Sinne offenbar sinnvolle, d. h. im Hinblick auf Orientierung und Handlungsfähigkeit nützliche Interpretationen der Natur bzw. der Umwelt zur Verfügung stellen – andernfalls wären wir ausgestorben.
Für unseren Zusammenhang von Architektur und akustischer Gestaltung ist ein Phänomenbereich sinnlicher Erkenntnisse der Umwelt von besonderer Bedeutung: auditive Empfindung von Raum.
Dem muss hinzugefügt werden, dass die auditive Empfindung von Raum nicht unabhängig von den Leistungen der anderen Sinne, insbesondere des Seh- und Tastsinnes, erfolgt und verstanden werden kann. Ebenfalls in diesen Problembereich des Zusammenspiels der Sinne gehört die Frage, ob sich das Empfinden von Raum im Hinblick auf den tatsächlichen Vollzug des sinnlichen Geschehens von der Empfindung von Zeit trennen lässt, denn es sind gerade bei der auditiven Empfindung von Raum wesentlich zeitliche Abfolgen von Schallreflexionen, die zu Raumeindruck führen.
Lokalisation, Raumeindruck und Umhüllung
Zwei Gegebenheiten werden im Folgenden thematisiert: erstens, dass jede Architektur durch den Einsatz geformter Materialien Luft begrenzt, Luftschälle reflektiert oder absorbiert und damit eine ortspezifische Raumakustik konstituiert; und zweitens, dass Schallfelder am Kopf von Hörenden reflektiert, gebeugt und absorbiert werden, sodass für beide Ohren unterschiedliche Hörreize entstehen, die der Wahrnehmung als Grundlage räumlicher Interpretationen dienen. Mit der physikalisch-technisch orientierten Raumakustik und der Psychoakustik als besonderem Feld der empirischen Psychologie stehen zwei Wissenschaften zur Verfügung, die die genannten Aspekte vielfältig untersuchen. Es ist wohl den spezifisch funktional-nachrichtentechnischen Aspekten der Raum- und Elektroakustik geschuldet – Sprachverständlichkeit, Musikübertragung, Lärmbekämpfung –, dass bisher die genuin architektonisch erscheinenden Phänomene der Akustik von Räumen weniger bearbeitet und für die Architektur kaum zugänglich gemacht wurden: Lokalisation, Raumeindruck und Umhüllung.[1]
Räumliches Hören
Jens Blauert hat 1974 mit seinen wegweisenden psychoakustischen Hörexperimenten «Räum- liches Hören» weitgehend erschlossen und terminologisch gefasst.[2] Die Abbildung 1 zeigt den Versuchsraum als schalltoten Raum, dessen Akustik dem des freien Feldes angenähert ist, d. h., keine oder nur sehr gedämpfte Schallreflexionen werden von den Wänden zurückgeworfen. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass nur die auf einer Halbkugel angeordneten und auf den Hörplatz ausgerichteten Lautsprecher das Schallfeld bestimmen.
Mit dieser Versuchsanordnung – sie umfasst in ihrer technischen Anlage die elektroakustischen Wiedergabeverfahren von Mono, Stereofonie und Surround Sound – lassen sich nun einzelne oder mehrere Töne oder Klangfolgen aus unterschiedlichen Richtungen gleichzeitig oder nacheinander einspielen. In dieser Kombination von geometrisch, zeitlich und auch spektral bestimmten Klängen (Muster), die den Hörprobanden an den Kopf gestrahlt werden und beide Ohren (binaural) reizen, liegt nun der Schlüssel zu den Wahrnehmungsphänomenen der Lokalisation, des Raumeindruckes und der Umhüllungsempfindung.
Es hat sich gezeigt, dass in den sogenannten interauralen Pegel- und Zeitdifferenzen (Kopf- und Ohrenform) und den Korrelationen (zentrales Nervensystem) zwischen diesen differenten Signalen die grundlegenden physikalischen und physiologisch-psychologischen Grössen und Prozesse für räumliches Hören gefunden sind. Als Lokalisation wird dabei die Fähigkeit bezeichnet, die uns Richtung und Distanz einer Schallquelle wahrnehmen lässt; als Raumeindruck erscheint die Wahrnehmung von Grösse und Beschaffenheit eines Raumes und als Umhüllung wird die Wahrnehmung beschrieben, die uns als aussen stehende Zuhörer oder als involvierte Teilnehmer eines klanglichen Geschehens ausweist. Damit sind akustische Dimensionen von Raum benannt, die in der Architektur wesentlich sind, entscheiden sie doch mit darüber, wie wir uns in einem Raum orientieren und bewegen können, ob und wie wir wissen, wo wir sind, und wie wir uns assoziieren oder dissoziieren. Vor diesem Hintergrund zeigt sich das Verhältnis von Architektur und akustischer Gestaltung als eines der Immersion[3] – es werden räumliche Eintauch- und Beteiligungsverhältnisse gestaltet.
Der Präzedenzeffekt
Die folgenden Zitate aus «Räumliches Hören» von Jens Blauert beschreiben mit dem Präzedenzeffekt (Gesetz der ersten Wellenfront) ein zentrales Phänomen unserer sinnlichen Fähigkeit zur Lokalisation von Schallquellen: Ein zeitlich primärer Schall wird dabei von einem zeitlich sekundären Duplikat (geometrische Spiegelreflexion) durch Gedächtnis- und Vergleichsleistungen unterschieden und zu einem orientierenden Musterfall, auf den sich die Aufmerksamkeit dann vorrangig richtet.
«Die Fähigkeit, sich eine ‹Vorstellung› von dem Schallfeld in Räumen zu machen (einen ‹Raumeindruck› zu entwickeln […]), und damit die empfangenen Rückwurfkonfigurationen sinnvoll interpretieren zu können, scheint eine Fähigkeit zu sein, die sich im Leben eines Individuums recht früh ausbildet. Neugeborene reagieren auf Schallquellen mit einer Hinwendebewegung des Kopfes auf die Quelle zu. Sie tun dies aber nicht, wenn eine Folge von Primärschall und Rückwürfen dargeboten wird. Die Fähigkeit, die Richtung der Primärschallquelle aus denen der Rückwürfe (d. h. Spiegelschallquellen) hervorzuheben, wird […] bei Menschen erst ab der 16. Lebenswoche entwickelt, bei Hunden ab der sechsten […].
Obwohl der Präzedenzeffekt offensichtlich durch die Funktion höherer Stufen des zentralen Nervensystems mitbestimmt wird, bedarf es nicht unbedingt besonderer intellektueller Anstrengungen, damit er wirksam wird. Er wird sozusagen bereits ‹intuitiv› wirksam.»[4] Im Weiteren führt Blauert aus, dass auch Rückwirkungen vom zentralen Nervensystem auf das periphere auditorische System bedacht werden müssen. Es zeigen sich eine Reihe von sensorischen Anpassungsleistungen, die dem jeweiligen Fokus der Aufmerksamkeit folgen: «Die Auswertung und Entscheidung darüber, ob bestimmte Schallanteile hervorgehoben oder vernachlässigt werden sollen, wird nicht notwendigerweise als bewusster oder willkürlich gesteuerter Prozess erlebt. Es kann durchaus eines intensiven Trainings bedürfen, damit Versuchspersonen ein Echo in Situationen wieder heraushören, in denen dieses normalerweise ‹automatisch› unterdrückt wird.»[5]
Verwandtschaft zwischen binokular und binaural Bezug nehmend auf diese auditiven Befunde, bildet Blauert folgende Analogie zur visuellen, zur binokularen Wahrnehmung: «Vergleicht man dies mit dem visuellen System, so mag folgende Analogie zutreffen: Willkürliche Kopf- und Augenbewegungen in Zusammenhang mit Sehen sind willkürlichen Peilbewegungen des Kopfes beim Hören vergleichbar. Letztere liefern wichtige Information für die auditorischen Ortungsprozesse […] und insofern sicherlich auch für den Präzedenzeffekt. Der Präzedenzeffekt selber kann jedoch wahrscheinlich besser mit der Wahrnehmung stereoskopischer Bilder durch eine Stereobrille verglichen werden. Dort gilt bekanntlich, dass wenn man das Stereobild erst einmal aufgefasst hat, es schwer ist, es willkürlich wieder zu unterdrücken.»[6] Die Hörwelt von blinden Menschen, die sich teilweise durch Wahrnehmung der akustischen Raumantwort auf ein selbst erzeugtes Klackgeräusch hin orientieren, aber auch die fantastisch anmutenden Fähigkeiten zur akustischen Echo-Lokalisation von Fledermäusen und die differenzierten Beschreibungen von Klangbildern und Klangräumen durch Tonmeister – sie alle rekurrieren auf räumliches Hören und zeigen, dass die Analogiebildung zwischen visueller und akustischer Wahrnehmung auf Grundlage binokularer bzw. binauraler Seh- bzw. Hörprozesse weitreichend durchgeführt werden kann.
Zwei Beispiele von Hörsituationen sollen im Weiteren kulturelle Potenziale akustischer Gestaltung im Zusammenhang mit Architektur, Raumakustik, Sprache und Musik skizzieren.
Sprachkulturraum
Etienne Bonnot de Condillac stellt in den Essais sur l’origine des connaissances humaines (1746) fest: «Die Prosodie [in der antiken Grammatik die Lehre von den Wortakzenten, Anm. d. Aut.] der Alten liefert auch die Begründung für einen Umstand, den bisher niemand erklärt hat. Es handelt sich dabei darum, in Erfahrung zu bringen, wieso die römischen Redner, die ihre Ansprachen auf dem Forum hielten, vom ganzen Volk gehört werden konnten. Der Klang unserer Stimme erreicht mühelos die äussersten Ecken eines grossen Platzes; die ganze Schwierigkeit besteht darin, dass die einzelnen Laute nicht miteinander verwechselt werden; doch ist dieses Problem umso kleiner, je deutlicher sich die Silben der einzelnen Wörter durch die Eigenheiten der Prosodie einer Sprache voneinander unterscheiden. Im Lateinischen unterscheiden sie sich durch die Qualität der Laute, durch den Akzent, der unabhängig vom Sinn verlangte, dass sich die Stimme hob und senkte, und durch die verschiedene Quantität. Uns hingegen fehlt der Akzent, in unserer Sprache ist die Quantität nicht unterschieden und viele unserer Silben sind überhaupt stumm. Ein Römer konnte folglich auf einem Platze gehört werden, wo ein Franzose nur schwerlich zu verstehen wäre oder vielleicht gar nicht.»[7]
Das von Condillac beschriebene Verhältnis von Prosodie, Verständlichkeit von Sprache und Hördistanz ist bemerkenswert, denn es legt einen weiten kulturellen Zusammenhang, ein Zusammenspiel von Sprache und Platzbau, nahe, das sich auf raumakustische Verhältnisse bezieht und Gruppenbildungen in sozialen und politischen Prozessen reflektiert und initiiert. Wie und wo können wie viele Personen gleichzeitig verständlich angesprochen werden? Diese Frage weist neben den stimmlichen und sprachlichen Aspekten auf einen ortsbezogenen Kern, der in der architektonischen Formgebung und Materialisierung des Sprech- und Hörraumes besteht und die Raumakustik der Hörsituation bestimmt.
Die ganze Schwierigkeit der Hörsituation besteht «[…] darin, dass die einzelnen Laute nicht miteinander verwechselt werden […]». Die räumliche Grenze, an der diese Verwechslung von Lauten erscheint, wird durch die Verhältnisse von Direktschall und Reflexionen bestimmt. Mit zunehmender Hördistanz nimmt die Lautstärke des Direktschalls ab, und die Klangfarbe der Stimme wird durch Dämpfungseigenschaften der Luft dunkler, sodass Akzente und Verständlichkeit zunehmend verloren gehen, und es sind die Schallreflexionen von Gebäuden, die die grossen Plätze (Foren) einfassen, die mitunter als Echos oder Flatterechos erscheinen und so eine räumlich-architektonisch bedingte «Verwechslung» (Condillac) von Lauten bewirken.[8]
Musik, Raum und affektive Bindung
«Platzieren Sie eine kleine Zahl von zusammenpassenden Personen, die etwas musikalische Kenntnis haben, in einem Salon mittlerer Grösse, ohne viele Möbel und ohne Teppiche. Führen Sie vor diesen Leuten ein echtes Kunstwerk eines echten, wahrhaft inspirierten Komponisten auf, […] ein einfaches Klaviertrio, z. B. das von Beethoven. Was geschieht? Die Zuhörer fühlen in sich mehr und mehr eine ungewohnte Verwirrung, sie empfinden eine tiefe intensive Lust, die sie bald heftig bewegt, bald in wunderbare Ruhe, bald in echte Ekstase versetzt. Mitten im Andante, bei der dritten oder vierten Wiederkehr des erhabenen und so leidenschaftlich religiösen Themas kann es einem Zuhörer passieren, dass er seine Tränen nicht mehr zurückzuhalten vermag, und wenn er ihnen einen Augenblick freien Lauf lässt, steigert er sich vielleicht – ich habe das selber miterlebt – in heftiges, wütendes, explosives Weinen. Das ist musikalische Wirkung! […] Und jetzt stellen Sie sich vor, dass mitten in diesem von denselben Musikern gespielten Satz der Salon allmählich grösser wird und die Zuhörer von den Ausführenden wegrücken. Unser Salon ist jetzt wie ein gewöhnliches Theater. Unser Zuhörer, den die Erregung bereits zu erfassen begann, wird wieder gelassen. Er hört immer noch, aber er schwingt kaum mehr mit. Er bewundert das Werk, aber durch den Verstand, nicht mehr mit dem Gefühl. Der Salon wird noch grösser, der Hörer rückt noch weiter vom Klangfeuerherd weg, so als spielten die drei mitten auf der Bühne, und er sässe in einer Mittelloge im ersten Rang. Er hört immer noch, kein Ton entgeht ihm, aber von der musikalischen Strömung wird er nicht mehr erreicht. Sie gelangt nicht mehr bis zu ihm hin; seine Verwirrung ist verflogen, er wird wieder kalt, er empfindet geradezu eine Art Beklemmung, die umso unangenehmer wird, je mehr er sich anstrengt, den Faden des musikalischen Diskurses nicht zu verlieren. Aber seine Anstrengung ist vergeblich, ihn lähmt Gefühllosigkeit, es wird ihm langweilig, der grosse Meister ermüdet ihn, wird ihm lästig, das Meisterwerk ein lächerliches Geräusch, der Riese ein Zwerg, die Kunst eine Enttäuschung. Er wird ungeduldig und hört nicht mehr zu.»[9]
Die Besonderheit der Beschreibung affektiver Bindung des Publikums, die Hector Berlioz hier anschaulich darlegt, ergibt sich dadurch, dass er im Gegensatz zur damals populären romantischen Musikauffassung – deren kunstreligiöser Sprache er sich bedient – nicht einen metaphysischen Inspirationszusammenhang von Komponist, Musiker und Zuhörerinnen beschwört, sondern einen physischen, raumakustisch bedingten Aspekt geltend macht: Die Musik muss hinreichend dynamisch, hinreichend laut und leise hörbar werden, um rühren zu können, was sie nur innerhalb einer begrenzten Abhördistanz zu leisten vermag. Das architektonisch-raumakustische Hördrama von Berlioz beschreibt implizit Veränderungen der Verhältnisse von Direktschall und Reflexionen. Von einem Salon «[…] ohne viele Möbel und Teppiche […]» hin zu einem Theater: «[…] der Hörer rückt noch weiter vom Klangfeuerherd weg, […] und er sässe in einer Mittelloge im ersten Rang». Das bedeutet, dass der Hörer aus einer Situation intensiven Direktschalls und starker Reflexionen (wenig Absorption durch Teppiche und Möbel) in eine Lage mit geringem Direktschall und geringen Reflexionen gerät, die ihn affektiv teilnahmslos werden, die ihn erkalten lässt.
Die Beispiele zu Hörsituationen der Sprache und Musik machen deutlich, dass die architektonisch-raumakustischen Gegebenheiten auf ästhetische und soziale Teilnahmeverhältnisse einwirken. Dabei zeigen sich die auditiven Wahrnehmungsphänomene der Lokalisation, des Raumeindruckes und der Umhüllung als Dimensionen der Immersion im Alltag und als künstlerischer Gestaltungsspielraum insbesondere der Architektur, der Musik und des Films.
Anmerkungen:
[01] Lokalisation, Raumeindruck und Umhüllung sind Termini der Raum- und Psychoakustik. Neben Jens Blauert (siehe Anm. 2) sei hier auch auf eine aktuelle Studie zu diesen Phänomenen verwiesen:
Cerda, Salvador, Alicia Gimenez, Rosa M. Cibrian, An Objective Scheme for Ranking Halls and Obtaining Criteria for Improvements and Design, AES Journal, Bd. 60, Nr. 6, Juni 2012
[02] Blauert, Jens, Räumliches Hören, Stuttgart, 1974
[03] Immersion: ein Begriff insbesondere der Medientheorie. Vgl. Curtis, Robin, Christiane Voss, Theorien ästhetischer Immersion, Montage AV – Zeitschrift für Theorie und Geschichte der audio-visuellen Kommunikation, Bd. 17/2, Berlin, 2008
[04] Blauert, Jens, Räumliches Hören, 2. Nachschrift, Stuttgart, 1982, S. 59
[05] Ebd. (wie Anm. 4)
[06] Ebd. (wie Anm. 4)
[07] De Condillac, Etienne Bonnot, Versuch über den Ursprung der menschlichen Erkenntnis, Würzburg, 2006, S. 191
[08] Ein Flatterecho ist eine periodische Folge eines Echos, die dadurch zustande kommt, dass ein Schallsignal sich auf einem Weg ausbreitet, der über zwei oder mehr stark reflektierende Flächen zum Ausgangspunkt zurückführt
[09] «Placez un petit nombre de personnes, bien organisées et douées de quelque connaissance de la musique, dans un salon de médiocre grandeur, point trop meublé ni tapissé; exécutez dignement devant elles quelque vrai chef-d’œuvre, d’un vrai compositeur, vraiment inspiré, une œuvre bien pure de ces insupportables beautés de convention que prônent les pédagogues et les enthousiastes de parti pris, un simple trio pour piano, violon et basse, le trio en si bémol de Beethoven, par exemple; que va-t-il se passer? Les auditeurs vont se sentir peu à peu remplis d’un trouble inaccoutumé, ils éprouveront une
jouissance intense, profonde, qui tantôt les agitera vivement, tantôt les plongera dans un calme délicieux, dans une véritable extase. Au milieu de l’andante, au troisième ou quatrième retour de ce thème sublime et si passionnément religieux, il peut arriver à l’un d’eux de ne pouvoir contenir ses larmes, et s’il les
laisse un instant couler, il finira peut-être (j’ai vu le phénomène se produire) par pleurer avec violence, avec fureur, avec explosion. Voilà un effet musical! voilà un auditeur saisi, enivré par l’art des sons, un être élevé à une hauteur incommensurable au-dessus des régions ordinaires de la vie! Il adore la musique, celui-là; il ne sait comment exprimer ce qu’il ressent, son admiration est ineffable, et sa reconnaissance pour le grand poëte-compositeur qui vient de le ravir ainsi égale son admiration.
Maintenant, supposez qu’au milieu de ce même morceau, rendu par les mêmes virtuoses, le salon dans lequel on l’exécute puisse s’agrandir graduellement, et que par suite de cet agrandissement progressif du local, l’auditoire soit peu à peu éloigné des exécutants. Bien; voilà notre salon grand comme un théâtre ordinaire; notre auditeur, qui déjà l’instant d’auparavant sentait l’émotion le gagner, commence à reprendre son calme; il entend toujours, mais il ne vibre presque plus; il admire l’œuvre, mais par raisonnement et non plus par sentiment ni par suite d’un entraînement irrésistible. Le salon s’élargit encore, l’auditeur est éloigné de plus en plus du foyer musical. Il en est aussi loin qu’il le serait, si les trois concertants étaient groupés au milieu de la scène de l’Opéra, et s’il était, lui, assis au balcon des premières loges de face. Il entend toujours, pas un son ne lui échappe, mais il n’est plus atteint par le fluide musical qui ne peut parvenir jusqu’à lui; son trouble s’est dissipé, il redevient froid, il éprouve même une sorte d’anxiété désagréable et d’autant plus pénible qu’il fait plus d’efforts d’attention pour ne pas perdre le fil du discours musical. Mais ses efforts sont vains, l’insensibilité les paralyse, l’ennui le gagne, le grand maître le fatigue, l’obsède, le chef-d’œuvre n’est plus pour lui qu’un petit bruit ridicule, le géant un nain, l’art une déception; il s’impatiente et n’écoute plus. Autre épreuve!» Berlioz, Hector, Sur l’état actuel de l’Art du chant dans les théâtres lyriques de France et d’Italie, et sur les causes qui l’ont amené; les grandes salles, les claqueurs, les instruments à percussion; in: À travers chants: Études musicales, adorations, boutades et critiques, Paris 1862, S. 89–104, hier S. 90 f., zit. nach: Lichtenhahn, Ernst, Musik und Raum. Gesellschaftliche und ästhetische Perspektiven zur Situation um 1800, in: Morawska-Büngeler, Marietta (Hg.), Musik und Raum. Vier Kongressbeiträge und ein Seminarbericht, Mainz 1989, S. 16 f.TEC21, Fr., 2012.08.31
31. August 2012 Jürgen Strauss
Akustische Gestaltung der Architektur
Das Projekt für den Bau des Museum of Modern Art (MomA) in Warschau, mit dem Christian Kerez 2007 den international ausgeschriebenen und von 109 Büros bestrittenen Wettbewerb gewann, ist nicht nur in visueller Hinsicht, sondern auch aus akustischer Warte ein architektonisch aussergewöhnlicher Wurf. Denn es wird für bestimmte Raumfolgen – von der U-Bahn-Station bis zu den Ausstellungshallen – visuelle und akustische Gestaltung vorgenommen.
Über eine steile, scheinbar in die Decke führende Treppe wird der grösste der Ausstellungsräume, die sogenannte «Huge Hall», erschlossen. Es öffnet sich ein Raum, dessen Dimensionen von ca. 130 m Länge, 30 m Breite und einer maximalen Höhe von 16 m augenblicklich an Kirchenräume denken lassen. Ein zweiter Blick auf den wellenförmigen Deckenbereich und seine Materialisierung als frei tragende Betonkonstruktion eröffnet dann aber auch Assoziationen, die diesen Ausstellungsraum moderner Kunst als industrielle Werkhalle erscheinen lassen. Mit dieser Spanne zwischen Kirche und Werkhalle ist ein zentraler Ort modernen Kunstgeschehens architektonisch gefasst.
Und mehr noch: Es ist auch eine gemeinsame akustische Signatur mit diesen Räumen verbunden, die allgemein bekannt ist: lange anhaltender Nachhall. Diese charakteristische Raumakustik, in der jedes Räuspern und jeder Gehschall zum Raum füllenden Ereignis wird, zwingt uns in Kirchen zu ruhigem und leisem Verhalten – wir wollen nicht stören –, und sie gestattet umgekehrt den voluminösen Klangeindruck einzelner Stimmen genauso wie die Inszenierung des überwältigenden Donners einer Stanzmaschine oder eines monotonen Chors von Drehautomaten.
Sprachverständlichkeit trotz langer Nachhallzeit
Die akustische Raumantwort der «Huge Hall» ist auch «huge» – es zeigt sich die Grösse des Raumes auch akustisch. Diese Kongruenz von grossem visuellem und akustischem Raumeindruck wollte der Architekt Christian Kerez erhalten. Der architektonischen Konzeption stand indes eine feuerpolizeiliche Vorschrift entgegen, der zufolge im Brandfall eine Durchsage in der gesamten «Huge Hall» von allen Besucherinnen gut, d. h. deutlich und leicht verstehbar sein muss. In der Praxis der Raumakustik wird diese Anforderung guter Sprachverständlichkeit durch Absorption von Schallreflexionen erfüllt. Dadurch reduziert sich die Nachhallzeit, und es verbleibt der informationshaltige direkte Schall der Sprechenden bzw. der übertragenden Lautsprecher. Aber mit der Reduktion der Nachhallzeit von ca. 10 s im nackten Betonzustand auf ca. 2–3 s mit absorbierenden Wandbeschichtungen ginge auch der spektakulär grosse akustische Raumeindruck verloren. Mit diesem Planungszustand unzufrieden, suchte Christian Kerez nach alternativen Lösungen.
Die Aufgabenstellung einer guten Sprachverständlichkeit unter der raumakustischen Bedingung einer langen Nachhallzeit ist in einem Anwendungsbereich der Elektroakustik seit Langem bekannt – der Kirchenbeschallung. Es bot sich deshalb an, eine Planung vorzunehmen, die sich auf bewährte Konzepte der Kirchenbeschallungstechnik bezog. So wurde eine gestaffelte Beschallung mit zwölf Linienquellen-Lautsprechern konzipiert, die den Berechnungen und Simulationen entsprechend an jedem Ort der «Huge Hall» einen ausreichenden «Speech Transmission Index» (STI) sicherstellt.[1]
Ganze Bandbreite des hörbaren Schalls
Wie aber ist es physikalisch und akustisch-technisch möglich, dieses Ziel zu erreichen, ohne die Nachhallzeit durch Absorption zu verkürzen? Durch eine gezielte vertikale Bündelung der aus den Linienquellen abgestrahlten Schallwellen, sodass das entstehende Schallfeld sich möglichst nur im Bereich der sitzenden oder stehenden Besucherinnen ausbreitet, d. h. auf einer Höhe von ca. 1 m bis 2 m über dem Boden. So werden die Boden- und Deckenschallreflexionen verhindert, bzw. reduziert, und mithin wird der potenziell lange Nachhall nicht oder nur wenig angeregt. Dadurch beginnt der direkt aus den Linienquellen gebündelt abgestrahlte Schall, dessen Druckverlauf die Information darstellt, den Höreindruck zu dominieren: Die Sprachverständlichkeit ist gegeben. Da jedes Schallfeld mit seiner Ausbreitung an Intensität verliert, muss über die ganze Länge von 130 m beidseits geometrisch regelmässig und zeitlich gestaffelt das Schallfeld fünfmal wieder verstärkt werden.
Die erwähnten Linienquellen-Lautsprecher (Abb. 6) werden aus einzelnen Lautsprechern aufgebaut, die aufgrund ihres kleinen Membrandurchmessers Schall idealtypisch in alle Richtungen gleichmässig abstrahlen (Punktquelle). Durch die Anordnung in einer vertikalen Reihe oder Linie beginnen sich die einzelnen kugelförmigen Schallfelder gegenseitig zu überlagern (Interferenz) und bilden so Zonen aus, in denen sich Schalldruckmaxima und Schalldruckminima zeigen.
In Anbetracht der umfangreichen technischen Aufwendungen für das zwölfkanalige Beschallungssystem – jede Linienquelle hat eine Länge von 3.5 m und wird in die Seitenwände integriert – und vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Bereich der (Video-) Klang- künste wurde das Nutzungsprofil des Beschallungssystems erweitert, sodass nicht nur das eingeschränkte Frequenzspektrum der Sprache, sondern die ganze Bandbreite des hörbaren Schalls übertragen werden soll, inklusive der Infraschälle herab bis 15 Hz. Mit dieser elektroakustischen Ausrüstung, die eine flexible, matrixbasierte Ansteuerung einzelner und mehrerer Linienquellen gestattet, wird in Verbindung mit der spektakulären Raumakustik ein einzigartiger Aufführungsort für aussergewöhnliche, womöglich für diesen Aufführungsort komponierte oder ortsbezogen arrangierte Musik und Performances angeboten.
Auch hier bietet sich nochmals die akustische Analogie von Museum und Kirche an: Das Beschallungssystem ist ein ortsgebundenes und nur durch künstlerisch angepassten Gebrauch sinnvoll zu verwendendes Musikinstrument – wie die Orgel. Nur, und das ist hier wesentlich, dieses architektonisch-raumakustische und elektroakustische Musikinstrument kann auch die Atmosphäre einer von Grillenzirpen erfüllten Nacht nachahmen oder das Stampfen und Dröhnen wie einer lauten Fabrikhalle.
Akustische Raumdramaturgie
Wer möchte nicht den Versuch machen und aus einem diffusen Meer von Stimmen im Foyer durch einen ruhigen Gang und über eine gedämpfte Treppe in die Weite der «Huge Hall» gelangen – eine Weite, in der das kleinste Geräusch gross werden kann? Und würden wir, dort angelangt, nicht wenigstens einmal Klatschen, Stampfen oder Schreien wollen vor Hörlust? Oder still und gespannt hineinhören in die Tiefe der niemals ganz schweigenden akustischen Raumantwort?
Anmerkung:
[01] Speech Transmission Index (STI), dt. Sprachübertragungsindex, ist ein Mass für die Sprachübertragungsqualität einer Übertragungsstrecke vom Sprecher zum Zuhörer. Als Übertragungsstrecke wird dabei eine akustische oder elektroakustische Sprachsignalübertragung verstanden. Die Masszahl STI beschreibt die zu erwartende Sprachverständlichkeit beim Zuhörer.TEC21, Fr., 2012.08.31
31. August 2012 Jürgen Strauss