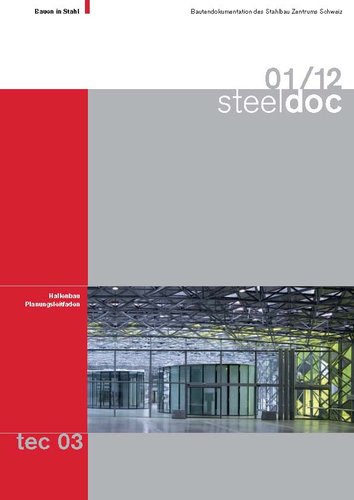Editorial
Das vorliegende technische Sonderheft von Steeldoc ist ein praktischer Planungsleitfaden für den Hallenbau. Der Hallenbau verdeutlicht exemplarisch die Vorteile der Stahlbauweise: flexibel, beliebig veränderbar und erweiterbar. Die Gestaltung von Hallenbauten richtet sich in erster Linie nach praktischen Parametern. Die Nutzung eines Gebäudes bedingt die Berücksichtigung von Lasten, Ausmassen und Produktionsabläufen oder Aktivitäten. Die Wahl der Tragstruktur hat also direkte Auswirkungen auf die Raumdimension, die Leitungsführung für technische Installationen und die langfristige Nutzbarkeit der Geschosse. Es werden deshalb meistens Struktur-Typen gewählt, die sich additiv oder modular erweitern lassen, was letztlich auch die Langlebigkeit des Gebäudes ausmacht.
Das Heft erläutert die häufigsten Arten von Hallentragwerken sowie deren Besonderheiten und Vorteile. Es bietet Hilfestellung bei der Planung und Realisierung von kostengünstigen und optimierten Hallenbauten. Eine Einführung geht auf die Planungsgrundsätze ein unter Berücksichtigung der gestalterischen Absicht, der Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Integration der Technik. Das Kapitel Tragstrukturen stellt die üblichen Hallentypologien vor wie Skelett, Rahmen, Bogen und räumliche Tragwerke. Ein weiterer Artikel ist der Gebäudehülle gewidmet sowie dem Brandschutz und Korrosionsschutz. Schliesslich wird auch auf die Kriterien der Systemintegration sowie der Nachhaltigkeit eingegangen.
Parallel zu dieser technischen Ausgabe von Steeldoc erscheint die Nummer 02/12 mit der Dokumentation von praktischen Beispielen. Wie immer geht die Dokumentation bis ins Detail, so dass sie praktische Anregung und Planungshilfe bietet.
Wir wünschen viel Vergnügen beim Studium der folgenden Seiten von Steeldoc.
Evelyn C. Frisch
Inhalt
01 Hallenkonstruktionen in Stahlskelettbauweise
Der Werkstoff Stahl
Bauen mit Stahl
Hallen aus Stahl als architektonische Aufgabe
Wirtschaftlichkeit
Flexibilität
Integrierte Planung
Gestaltung
02 Tragstrukturen
Übersicht
Binder und Stützen
Rahmen
Bogen
Räumliche Tragwerke
03 Gebäudehülle
Wärmeschutz
Feuchteschutz
Schallschutz
Bausysteme für Dach und Wand
Belichtung
Belüftung
04 Brandschutz
Rauch- und Wärmeabzug
Flucht- und Rettungswege
Zugänglichkeit
Brandabschnitte
Feuerlöscheinrichtungen
Baulicher Brandschutz
05 Korrosionsschutz
Korrosionsschutz nach Mass
Beschichtungen
Metallische Überzüge
Beschichtungen auf feuerverzinkten Bauteilen
(Duplex-Systeme)
06 Integration der Systeme
Tragwerk
Hüllkonstruktion
Technisher Ausbau
Integrationskonzepte
07 Nachhaltigkeit
Wirtschaftlichkeit
Ökologische Qualität
Soziale Aspekte
Tipps zur Planung nachhaltiger Hallen
Binder und Stützen
Trageigenschaften
Innerhalb der hier vorgestellten Bauweisen zur Konstruktion einer Halle stellt das System aus Stütz en, Bindern und Pfetten und zusätzlichen aussteifenden Verbänden einen Baukasten dar, der vielfältige Variationsmöglichkeiten erlaubt und an grosse und kleine Spannweiten und unterschiedliche Funktionen anpassbar ist.
Im Hinblick auf den Momentenverlauf stellt das System «Träger auf zwei Stützen» den ungünstigsten Fall dar. Diese Trägeranordnung führt zu einem maximalen Moment in Feldmitte und damit zu grossen Schnittkräften und Verformungen, die durch einen entsprechenden Materialeinsatz kompensiert werden müssen. Träger mit Kragarmen, Zweifeldträger und Durchlaufträger hingegen bewirken ein geringeres Feldmoment und eine günstigere Verteilung der (inneren) Kräfte. Dies gilt besonders für die Pfetten. Daher werden die Pfetten meist als Durchlaufträger aus geführt und liegen dabei auf den Bindern auf. Die aus der Hülle resultierenden Horizontalkräfte (Wind) werden über eine Unterkonstruktion aus Pfosten und Riegeln in die Tragkonstruktion eingeleitet. Horizontalverbände in der Dachebene nehmen die Kräfte auf und leiten sie über die Binder in Vertikalverbände ein. Die Vertikalverbände befinden sich in den Wandebenen und dienen zur Ableitung der Kräfte zum Stützenfusspunkt. Es ist nicht notwendig, jedes Feld mit einem aussteifenden Verband zu versehen. Zur Ableitung der Längskräfte genügt bei kleinen Hallen meist ein Verbandsfeld, das etwa in Hallenmitte angeordnet sein sollte. Für grössere Hallen sind dafür mindestens zwei Verbandsfelder notwendig.
Stützenformen
Der Stützenquerschnitt wird durch die Art der Beanspruchung geprägt. Reine Pendelstützen ohne Zwischenhalterungen (normalkraftbeansprucht) sollten wegen der allseitig gleichen Knickbeanspruchung aus statischen Gründen in beiden Achsen annähernd gleiche Steifigkeit aufweisen. Bei eingespannten Stützen und Stützen mit Zwischenhalterungen oder mit Kranbahnlasten wird das Profil entsprechend der maximal belasteten Profilachse gewählt.
Eingespannte Stützen sollten nur dann gewählt werden, wenn eine Lösung mit Vertikalverbänden nicht möglich, die Knicklänge gering ist und viele Stütz en zur Horizontallastabtragung aktiviert werden können. Die Einspannung kann über Köcherfundamente oder Ankerbarren erfolgen. Die Ausbildung der Binderanschlüsse und der Fussplatten sollte so erfolgen, dass Aussteifungsrippen möglichst vermieden werden.
Binderformen
Binder sind ebene biegebeanspruchte Tragelemente. Für die Biegebeanspruchbarkeit eines Trägers sind jene Querschnittsbereiche massgebend, die in der Biegeebene möglichst weit von der Schwerachse entfernt liegen. Die Momententragfähigkeit hängt deshalb von der Querschnittsform des Trägers ab. Daher hat der Querschnitt eines Doppel-T-Profils eine für die Biegebeanspruchung optimale Massenverteilung. Im Stahlbau ist diese Querschnittsform synonym für einen Biegeträger. Mit zunehmender Spannweite ist es sinnvoll, den Querschnitt des Tragprofils der Beanspruchung noch besser anzupassen. Bei einem Lochstegträger oder Wabenträger, der durch Auftrennen und Wiederzusammensetzen eines Doppel-T-Profils hergestellt wird, ist die Massenverteilung wesentlich günstiger als beim Ausgangsprofil.
Geschweisste Blechträger mit dünnen Stegen bieten hier oftmals eine wirtschaftliche Alternative. In Fachwerkträgern werden die Gurtprofile durch Füllstäbe auf Abstand gehalten. An den Knotenpunkten greifen idealerweise nur Zug- und Druckkräfte an.
Beim Vierendeelträger sind zwischen den Gurtprofilen nur senkrechte Pfosten angeordnet, wodurch die einzelnen Tragglieder biegebeansprucht sind. Vierendeelträger erfordern deshalb immer einen höheren Materialeinsatz als ein vergleichbarer Fachwerkträger.
Sie haben jedoch den Vorteil grosser, ungestörter Öffnungen. Voraussetzung für wirtschaftliches Konstruieren ist eine möglichst einfache konstruktive Ausbildung der Knotenpunkte. Die Ausbildung von echten Gelenken ist nicht üblich. Durch Schraub- und Schweissverbindungen entstehen mehr oder weniger steife Verbindungen. Die dadurch entstehenden Nebenspannungen bleiben jedoch bei der Dimensionierung eines Fachwerkträgers unberücksichtigt.Steeldoc, Mi., 2012.08.29
29. August 2012 Evelyn C. Frisch, Virgina Rabitsch
Brandschutz
Unter Brandschutz versteht man alle Massnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorbeugen und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. An erster Stelle steht dabei der Personenschutz. Er umfasst im einzelnen folgende Massnahmen:
Rauch- und Wärmeabzug
Neben dem Feuer darf insbesondere die Gefährdung durch Rauch nicht unterschätzt werden. Im Brandfall fordert dieser die meisten Todesopfer und verursacht zudem oft erhebliche Sach- und Betriebsunterbrechungsschäden. Für den Personenschutz können deshalb Massnahmen, die einer raschen Abführung der Rauchgase dienen, entscheidend sein. Dafür sind im Dach- oder Wandbereich der Halle Rauchabzugsvorrichtungen vorzusehen, die sich im Brandfall selbsttätig öffnen. Sie sollen gleichmässig über die Hallengrundfläche verteilt sein. Des Weiteren begrenzen Rauch- und Wärmeschürzen im Decken- und Dachraum die Ausbreitung von heissen Brandgasen und gewährleisten für eine definierte Zeitdauer eine ausreichend rauchfreie Schicht über dem Boden.
Fluchtwege und Rettungswege
Fluchtwege dienen im Brandfall dem raschen und sicheren Austritt von jedem Punkt in der Halle bis ins F reie oder in einen gesicherten Bereich. Anzahl, Anordnung, Form und Bemessung der Fluchtwege richten sich nach behördlichen Vorschriften.
Zugänglichkeit
Zum Personenschutz zählen auch diejenigen Massnahmen und Vorrichtungen, die das Eindringen von Rettungspersonal in das Gebäude betreffen. Dazu gehören die Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr ebenso wie die Fluchtwege als Einstiege sowie weitere Öffnungen, die das Eindringen in das Gebäude ermöglichen.
Brandabschnitte
Um den durch einen Brand entstehenden Schaden zu begrenzen, werden Brandabschnitte ausgebildet. Die Grösse der Brandabschnitte ist behördlich geregelt. Sondermass nahmen, wie der Einbau einer Sprinkleranlage, ermöglichen die Ausbildung grösserer Brandabschnitte.
Feuerlöscheinrichtungen
Brandmeldeanlagen dienen einem möglichst raschen, effizienten Feuerwehreinsatz. Für die Feuerwehr zugängliche Hydranten und Wasserreservoirs bilden die Voraussetzung einer effektiven Brandbekämpfung. Zu den automatisch wirksamen Feuerlöscheinrichtungen zählen u.a. Sprinkleranlagen.
Baulicher Brandschutz
Wände, Fachwerke, Binder und Stützen bilden die tragende und aussteifende Konstruktion eines Gebäudes. Diese muss auch während eines Brandes für die Zeitdauer der Lösch- und Rettungsmassnahmen ihre Standsicherheit behalten, um das Risiko von Verletzungen für die Rettungskräfte so gering wie möglich zu halten.
Der gängigste bauliche Brandschutz ist die Verkleidung, die entweder direkt oder unter Bildung von Hohlräumen (z. B. für Installationen) auf die Stahlteile angebracht wird. Verbundkonstruktionen, bei denen die Stützen und Träger teilweise oder gar vollständig ausbetoniert werden, sind eine weitere sinnvolle und verbreitete Brandschutzmassnahme. Dabei sind die Stahlstützen häufig von einem Stahlmantel umgeben, welcher beim Betonieren als Schalung dient. Der Hüllbeton schützt das innere Stahlprofil vor übermässiger Wärmeeinwirkung und kann selber noch eine tragende Funktion übernehmen. Wird umgekehrt eine Stahlrohrstütze mit Beton gefüllt, erfolgt unter Brandeinwirkung eine Lastumlagerung, sodass fortan der Betonkern die tragende Funktion übernimmt.Steeldoc, Mi., 2012.08.29
29. August 2012 Evelyn C. Frisch, Virgina Rabitsch