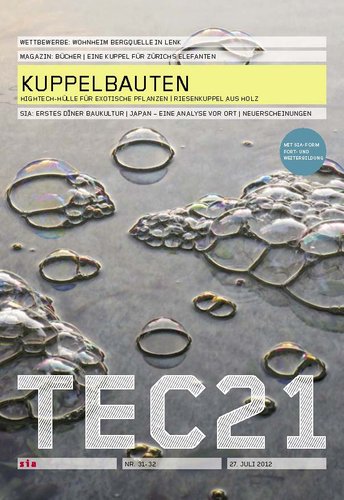Editorial
Kuppelbauten beeindrucken seit Jahrtausenden. Konstruktionen wie das Pantheon in Rom, die Hagia Sophia in Istanbul oder Brunelleschis Kuppel für den Dom von Florenz sind eindrückliche Zeugen der Baugeschichte. Ursprünglich aus Stein, wurden sie mit fortschreitender Entwicklung der Bautechnik bald auch aus Holz und später, mit der Entwicklung von Eisen und Stahl, auch aus diesen Baustoffen gefertigt. Durch die Materialinnovationen des Industriezeitalters waren nicht nur grössere Spannweiten möglich, auch die Konstruktionen wurden schlanker. Durch den Einsatz von Glas entstanden so die Gewächshauskonstruktionen Loudons im 19. Jahrhundert. Die grosszügigen, lichten Hallen wurden bald zum Sinnbild der englischen Gewächshausarchitektur. Später wurden auch im übrigen Europa solitäre Kuppelkonstruktionen als gestalterisches Element in die Gesamtkomposition von Parkanlagen integriert, so auch die Kuppeln der Schaugewächshäuser des Botanischen Gartens in Zürich. Auch wenn diese erst in den 1970er-Jahren entstanden sind, beziehen sie sich doch auf die ursprüngliche innerstädtische Anlage am Bollwerk «zur Katz» von 1833. Die auf einer einfachen Kreisgeometrie beruhende Konstruktion der Kuppeln und ihr Aufbau aus industriell gefertigten, eindimensional gebogenen Aluminiumrohren und Stahlgussknoten verraten jedoch, dass sie jüngeren Datums sind. Der bauliche Zustand und der hohe Energiebedarf machten nun eine aufwendige und massgeschneiderte Instandsetzung erforderlich («Hightech-Hülle für exotische Pflanzen»).
Im Gegensatz zu den einfachen Kreisgeometrien ist das geodätische Konstruktionsprinzip Richard Buckminster Fullers auf polygonalen Geometrien aufgebaut. Fuller entwickelte mit seinen geodätischen Kuppeln in den 1950er-Jahren ein materialsparendes und serielles Bauprinzip für grosse Kuppeln und Hüllen in Leichtbauweise. Der Durchbruch gelang ihm 1953, als das Unternehmen Ford eine geodätische Kuppel aus zweilagigen Aluminiumstäben mit Kunststoffeindeckungen konstruierte. Seither wurden geodätische Kuppeln für verschiedene Zwecke erstellt, die wohl bekannteste ist die Kuppelkonstruktion für die Expo in Montreal 1967.
In der neuen Salzlagerhalle der Rheinsalinen «Saldome 2» in Rheinfelden, der bisher grössten Holzkuppel Europas, wurden Fullers Konstruktionsprinzipien in Holz übersetzt und weiterentwickelt («Riesenkuppel aus Holz»). Holz ist im Gegensatz zu Metallen und Stahlbeton in Gegenwart von Natriumchlorid korrosionsbeständig und deshalb als Baustoff für Salzlager etabliert. Bedauerlich ist, dass die eindrückliche Holztragkonstruktion des Saldome durch eine Aussenschale überdeckt wird und sich nur den wenigen Benutzern des Doms erschliessen wird.
Andrea Wiegelmann, Aldo Rota