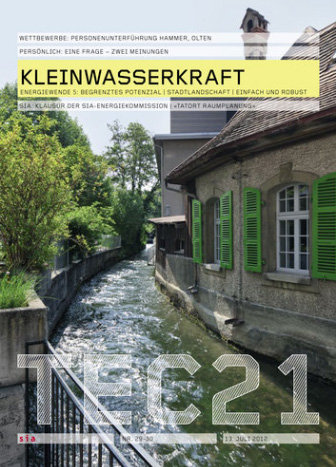Editorial
Die Elektrizitätsgewinnung aus Wasserkraft hat hierzulande seit je einen hohen Stellenwert. Als Gebirgsland verfügt die Schweiz über reichlich Wasserressourcen. Das erste elektrische Licht erstrahlte jedoch nicht in einer Stadt, sondern in einem St. Moritzer Hotel. 1878 besuchte der Hotelier Johannes Badrutt die Weltausstellung in Paris, wo er eine neue, mit elektrischer Energie betriebene Beleuchtungsanlage sah. Noch im selben Jahr baute er neben dem Kulm Hotel ein kleines Kraftwerk, das durch einen Bach angetrieben wurde. Mit dem Strom betrieb er die elektrischen Lampen im Speisesaal und einen Kandelaber auf dem Platz vor dem Hotel.
Doch die Menschen haben die Wasserkraft schon lange vor der Erfindung der Glühbirne genutzt. Sie bildete den eigentlichen Motor für das Gewerbe und die frühe Industrialisierung. Handwerksbetriebe und Fabriken entstanden an jenen Orten, wo sich aus Bächen und Flüssen Energie gewinnen liess.
Ein interessantes Beispiel dafür ist Burgdorf. Entlang des städtischen Kanalsystems, das sein Wasser zum grössten Teil aus der Emme bezieht, siedelten sich ab dem 13. Jahrhundert Mühlen, Gewerbebetriebe und Fabriken an («Stadtlandschaft dank Wasserkraft»). Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Wasserräder durch Turbinen und Generatoren ersetzt. Auf Burgdorfer Stadtgebiet sind neun Kleinwasserkraftwerke erhalten geblieben. Dank der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV), einem Förderinstrument für die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien, können die Kleinwasserkraftwerke modernisiert werden.
In Burgdorf hat man die Bedeutung der Kanäle auch für die Stadtentwicklung erkannt. Die Wasserläufe tragen zur Lebensqualität bei, indem sie attraktive Begegnungs- und Erholungsräume schaffen.
Ein moderater Ausbau der Wasserkraft gehört zu den Zielen der bundesrätlichen Energiepolitik. Mit der KEV wird die Kleinwasserkraft seit 2009 gefördert. In zusätzlichen Kilowattstunden betrachtet, ist ihr Beitrag eher bescheiden – insbesondere, wenn man die Strommenge vor Augen hat, die es durch den Ausstieg aus der Atomkraft zu ersetzen gilt («Begrenztes Potenzial»). Es geht aber vor allem auch darum, die eigenen Potenziale auszuschöpfen. Doch zu welchem Preis? Die Umweltorganisationen wehren sich dagegen, dass nun auch noch die letzten unberührten Gewässer genutzt werden sollen (vgl. S. 13). Ihren Befürchtungen ist mit einer glaubwürdigen Planung Rechnung zu tragen.
Zudem entwickelt sich die Technik für die Nutzung der Kleinwasserkraft weiter («Einfache, robuste Technik»). Das Ziel sind effiziente Anlagen, die möglichst umweltverträglich sind. Pioniergeist ist heute ebenso gefragt wie Ende des 19. Jahrhunderts bei der Lancierung der ersten elektrisch betriebenen Lampen in St. Moritz.
Lukas Denzler, Aldo Rota
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Personenunterführung Hammer, Olten
13 PERSÖNLICH
Eine Frage – zwei Meinungen
16 BEGRENZTES POTENTIAL
Lukas Denzler
Der Ausbau der Wasserkraft polarisiert. Ohne eine umfassende Planung, die alle Interessen berücksichtigt, kann das vorhandene Potenzial nicht ausgeschöpft werden.
18 STADTLANDSCHAFT DANK WASSERKRAFT
Lukas Denzler
Burgdorf zeichnet sich durch ein weitverzweigtes Kanalsystem aus. Die Kleinwasserkraftwerke sind Zeugen der Industrialisierung. Die Kraftwerksgenossenschaft möchte sie weiter betreiben, wovon auch die Bewohner von Burgdorf profitieren.
22 EINFACHE, ROBUSTE TECHNIK
Gian-Andri Tannò
Kleinwasserkraftwerke sind Unikate. Um den heutigen Anforderungen zu genügen, muss die Technik der Anlagen ständig weiterentwickelt werden.
27 SIA
Sitzung der ZOK 2 / 2012 | Klausur der SIA-Energiekommission | «Tatort Raumplanung»
31 MESSEN
Bau- und Energie-Messe 2012
33 FIRMEN
Schöck Bauteile | Colores | Priora
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Ausbegrenztes Potenzial
Geht es nach dem Willen des Bundesrates, soll im Rahmen der Energiewende bis 2050 die Stromproduktion aus Wasserkraft um bis zu 10 % gesteigert werden. Der zusätzliche Strom soll je etwa zur Hälfte aus Gross- und Kleinwasserkraftwerken stammen. Dagegen regt sich Widerstand, denn bereits heute werden etwa 90 % der Gewässer für die Wasserkraft genutzt.
Mit einer mittleren Jahresproduktion von rund 36 TWh ist die Wasserkraft der wichtigste Pfeiler der Schweizer Stromerzeugung. Dies entspricht 56 % der inländischen Stromproduktion. Nach dem Entscheid von Bundesrat und Parlament, mittelfristig aus der Atomenergie auszusteigen, erhält sie eine noch grössere Bedeutung. Ein weiterer Ausbau der Wasserkraft, insbesondere die Nutzung von noch unberührten Gewässern, stösst bei den Umweltverbänden jedoch auf Widerstand.
Ausbaupotenzial nach unten korrigiert
Im Juni 2011 ging der Bundesrat noch von einem Ausbau der Stromproduktion aus Laufund Speicherkraftwerken bis 2050 um insgesamt 4 TWh / Jahr aus (ohne Pumpspeicherkraftwerke).[1] Inzwischen wurde das angenommene Potenzial zusammen mit den Kantonen und Interessenvertretern überprüft und nach unten korrigiert.[2] Das Bundesamt für Energie (BFE) beziffert das zusätzliche Wasserkraftpotenzial bis 2050 unter heutigen Nutzungsbedingungen lediglich noch mit 1.53 TWh / Jahr. Unter optimierten Nutzungsbedingungen, die laut BFE insbesondere verbesserte wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen umfassen, könnte die Wasserkraftnutzung um 3.16 TWh / Jahr ausgebaut werden (vgl. Tabelle). Bei der Kleinwasserkraft wird der Ausbau auf 1.29 bis 1.6 TWh geschätzt.[3] Um das Potenzial der Kleinwasserkraft genauer als bisher zu ermitteln, führte das BFE eine Umfrage bei den Kantonen durch. Die zuständigen kantonalen Ämter hatten die Realisierungschancen der für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) angemeldeten Projekte zu beurteilen. Erst die KEV-Beiträge machten die Kleinwasserkraft wieder konkurrenzfähig. So werden Projekte geplant, die früher aus finanziellen Überlegungen kein Thema waren. Gemäss der Stiftung «Kostendeckende Einspeisevergütung» betrug der durchschnittliche Vergütungssatz bei der Kleinwasserkraft im Jahr 2010 16.5 Rp. / kWh[4]; die maximale Vergütung liegt bei 35 Rp. / kWh. Die Umweltverbände befürchten wegen der Förderung nun eine Flut von Projekten und stellen deshalb die KEV für Kleinwasserkraft grundsätzlich infrage.
Umfassende Planung ist unerlässlich
Die KEV ersetzt jedoch keine der für Kleinwasserkraftwerke erforderlichen kantonalen und kommunalen Bewilligungen. Für den Bau neuer Anlagen ist ein raumplanerischer Ansatz zentral. Bereits genutzte Gewässerabschnitte müssen Priorität haben, während noch naturnahe Wasserläufe zu schützen sind. In diese Richtung zielt denn auch die 2011 vom Bund herausgegebene Empfehlung zur Erarbeitung kantonaler Schutz- und Nutzungsstrategien im Bereich der Kleinwasserkraft.[5] Vorgeschlagen wird unter anderem, die Planung der Kleinwasserkraft in die kantonalen Richtpläne aufzunehmen. Als Vorbild gilt hier der Kanton Bern, der 2010 eine Wasserstrategie erlassen und damit nun ein Instrument zur Verfügung hat, um einerseits die Wasserkraft zu fördern, andererseits aber auch Landschaft und Natur zu schützen. Aus der systematischen Abwägung von Schutz- und Nutzungsinteressen ist als wichtigstes Ergebnis eine Gewässerkarte zur Wasserkraftnutzung hervorgegangen, die ein Massnahmenblatt des kantonalen Richtplanes ist (Tec21 5-6 / 2012). Eine umfassende Planung der Wasserkraft ist auch aus einem anderen Grund unabdingbar. Das 2011 in Kraft getretene revidierte Gewässerschutzgesetz sieht vor, die negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung auf die Gewässer zu reduzieren. Im Vordergrund stehen dabei geringere durch Schwall / Sunk verursachte Wasserspiegeländerungen sowie die Verbesserung des Geschiebehaushaltes und der Fischgängigkeit. Bei Letzterem fokussiert das Interesse zunehmend auf den Fischabstieg, wofür es noch keine befriedigenden Lösungen gibt. Ebenso wurde das Ziel formuliert, 4000 km Fliessgewässer innerhalb der nächsten 80 Jahre zu revitalisieren. Der Bund stellt den Kantonen von 2012 bis 2015 dafür erstmals 142 Mio. Fr. zur Verfügung. Die Kantone sind verpflichtet, Revitalisierungen von Gewässern strategisch zu planen, Schwerpunkte für ökologische Aufwertungen zu definieren und einen Zeitplan für die Umsetzung festzulegen. Der Erfolg dieser Bemühungen ist aber infrage gestellt, wenn keine Koordination mit dem angestrebten Ausbau der Wasserkraft erfolgt.
Chancen bei Kraftwerkserneuerungen nutzen
Mit der Erneuerung von Wasserkraftwerken lassen sich oft auch ökologische Verbesserungen erzielen. Ein Beispiel dafür ist das Kraftwerk Mühlau in Bazenheid im unteren Toggenburg (Abb. 1). Das alte Kraftwerk mit einem Oberwasserkanal und einer Restwasserstrecke wurde 2010 von der Regionalwerk Toggenburg AG durch ein neues Flusskraftwerk ersetzt, das dreimal so viel Strom wie das alte produziert (TEC21 15-16 / 2012). Das Wehr bildet zwar weiterhin ein Hindernis im Fluss; doch eine Fischtreppe ermöglicht den Fischen, flussaufwärts zu schwimmen. Der nicht mehr benötigte Oberwasserkanal wurde nicht einfach zugeschüttet, sondern in ein wertvolles Biotop umgewandelt, und bei Hochwasser wird bewusst Wasser zurückgestaut, um die oberhalb des Kraftwerks liegenden Auenflächen zu fluten. Solche ökologische Aufwertungen sind nur möglich, wenn Naturschutzfachleute von Anfang an beteiligt sind. Wie erfolgreich die ökologischen Ausgleichmassnahmen beim Kraftwerk Mühlau sind, wird in den kommenden Jahren mit einem Monitoring überprüft.
Kleinwasserkraft alleine genügt nicht
Die Stromproduktion aus Kleinwasserkraft liesse sich zweifellos noch etwas erhöhen. Auch neue Anlagen sind eine Option, wenn sie sich gut in die Landschaft integrieren und nicht in bisher unberührte Gewässer zu stehen kommen. Dank neuen Technologien besteht die Hoffnung, dass sich die Auswirkungen auf die Wasserlebewesen weiter reduzieren lassen. Gerade auch im Siedlungsgebiet wären Kleinwasserkraftwerke möglich. So hat beispielsweise bei einem Wettbewerb für eine Gebietsentwicklung in Uster ein Projekt gewonnen, weil es unter anderem am Aabach ein kleines Wasserkraftwerk vorschlug (TEC21 39/2011).
Hält man sich jedoch den weiteren Anstieg der Nachfrage nach Elektrizität und die 25 TWh Atomstrom, die es zu ersetzen gilt, vor Augen, so genügt der Beitrag der Kleinwasserkraft bei weitem nicht. Damit die Energiewende gelingt, sind wir auf sämtliche erneuerbaren Energiequellen angewiesen.
Anmerkungen:
[01] Bundesamt für Energie: Energieperspektiven 2050 – Abschätzung des Ausbaupotenzials der Wasserkraftnutzung unter neuen Rahmenbedingungen. Faktenblatt vom 20. Juni 2011
[02] Bundesamt für Energie: Wasserkraftpotenzial der Schweiz – Abschätzung des Ausbaupotenzials der Wasserkraftnutzung im Rahmen der Energiestrategie 2050, 2012
[03] Aus Sicht der Umweltverbände beschränkt sich das Potenzial der zusätzlichen Stromproduktion aus Kleinwasserkraft auf 0.7 bis 1 TWh / Jahr; der Schweizerische Wasserwirtschaftsverband beziffert es auf 1 bis 2 TWh / Jahr, die Experten der EPFL auf 1 bis 1.4 TWh /Jahr (Angaben aus Fn. 2)
[04] Stiftung Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV): Geschäftsbericht 2010 Die durchschnittlichen Vergütungssätze betrugen 2010 bei Windkraft 18.6, bei Biomasse 20.6 und bei Fotovoltaikanlagen 68.1 Rp. / kWh. Aufgrund der gesunkenen Kosten für Fotovoltaikmodule wurden per 1. März 2010 die Vergütungssätze für Fotovoltaik um 18 % gesenkt
[05] BAFU, BFE, ARE (Hrsg.): Empfehlung zur Erarbeitung kantonaler Schutz- und Nutzungsstrategien im Bereich Kleinwasserkraftwerke, 2011
[06] EnergieSchweiz – Programm Kleinwasserkraftwerke: Newsletter Nr. 11, 1 / 2010TEC21, Fr., 2012.07.13
13. Juli 2012 Lukas Denzler
Stadtlandschaft dank Wasserkraft
Wer in Burgdorf den Kanälen folgt, begibt sich auf eine historische Entdeckungsreise. Am weitverzweigten Kanalsystem befinden sich neun Kraftwerke, die zurzeit gut 3 % des Burgdorfer Strombedarfs decken. Die Genossenschaft der Kraftwerksbesitzer möchte diese weiter betreiben und hat einige Anlagen bereits modernisiert. Für Burgdorf stellen die Wasserläufe zudem eine einmalige Chance für die Gestaltung der städtischen Räume dar.
Manchmal kann sich eine Idee nicht durchsetzen, weil sie zu früh kommt. 1989 sass Hans Ulrich Flückiger im Stadtparlament von Burgdorf. Um die Chancen von Strom aus Fotovoltaik auf dem Markt zu verbessern, schlug der Unternehmer eine kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) vor. In Burgdorf stiess er damit auf offene Ohren. Das System wurde als Burgdorfer Modell bekannt, setzte sich in der Schweiz vorerst aber nicht durch. Zur selben Zeit entstanden in Deutschland ähnliche Konzepte. Zwischen den Vordenkern aus Burgdorf und den deutschen Solarpionieren gab es in den 1990er-Jahren einen regen Austausch. Den eigentlichen Durchbruch bildete schliesslich das 2000 in Deutschland beschlossene Erneuerbare- Energien-Gesetz, das die Einspeisung und Vergütung von Strom aus erneuerbaren Quellen regelt.
In der Schweiz setzte sich das Modell der KEV auf Gesetzesebene erst 2009 durch. Gefördert wird seither Strom aus Solarzellen, aber auch aus Biomasse-, Wind-, Geothermie- und Kleinwasserkraftwerken. Und von Letzterem profitiert nun auch Flückiger. Nachdem sich der Unternehmer und Elektroingenieur vor zehn Jahren aus dem aktiven Berufsleben zurückgezogen hatte, übernahm er 2006 ein Kleinwasserkraftwerk am Burgdorfer Gewerbekanal. Das Werk war noch in Betrieb und gehörte der Stanipac AG (früher Stanniol- und Flaschenkapselfabrik), die heute PET-Folien und Verpackungen herstellt. Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte der mechanische Antrieb der Fabrikmaschinen noch über eine direkte Kraftübertragung (Transmission). Nach der Elektrifizierung lieferte ein Generator mit einer Leistung von 30 kW einen Teil des für die Maschinen benötigten Stroms, der Rest wurde aus dem öffentlichen Netz bezogen. 1929 wurde das Kraftwerk erneuert und die Leistung auf 85 kW gesteigert.
Fast doppelt so viel Strom dank Erneuerung
Weil nach 80 Jahren wieder eine Sanierung der Anlage bevorstand, beschloss die Stanipac AG, das Kraftwerk zu verkaufen. Flückiger liess ein Projekt ausarbeiten, das den Einbau einer neuen Turbine sowie die Erneuerung des Oberwasserkanals inklusive der Erhöhung der Dämme vorsah. Dadurch erhöhte sich das nutzbare Gefälle um 0.6 m auf 3.8 m.
Die elektrische Leistung beträgt neu 166 kW, und die Produktion konnte von 550 000 auf 1 000 000 kWh Strom pro Jahr gesteigert werden (Abb. 2+3). Dank der KEV rechnen sich die Investitionen. Was einst in Burgdorf für die Fotovoltaik eingeführt worden war, ermöglicht nun die Erneuerung der Kleinwasserkraftwerke.
Auf Burgdorfer Stadtgebiet befinden sich heute neun Kleinwasserkraftwerke mit Leistungen zwischen 30 und 170 kW. Das Kraftwerk beim Bahnhof, das seit mehr als 25 Jahren keinen Strom mehr liefert, möchte Flückiger wieder in Betrieb nehmen. Die Kraftwerke nutzen das Wasser im weit verästelten Kanalsystem von Burgdorf. Dieses ist 4.8 km lang und weist ein Gefälle von 24 m auf. Laut Flückiger werden derzeit 18 m Fallhöhe für die Elektrizitätsgewinnung genutzt. Zurzeit produzieren die Kraftwerke jährlich etwa 3.3 Mio kWh Strom. Dies entspricht gut 3 % des Burgdorfer Elektrizitätsbedarfs.Eine Konzession für alle Kraftwerke Die Kleinkraftwerke sind alle in privater Hand, und die Besitzer der Kraftwerke sind in einer Genossenschaft zusammengeschlossen, deren Präsident Hans Ulrich Flückiger ist. Der Kanton Bern hat 2005 nicht den einzelnen Besitzern, sondern der Genossenschaft eine einzige neue Konzession erteilt. Diese darf eine Wassermenge von maximal 5 m³/s aus der Emme in das Kanalnetz einleiten. Sie ist für die Steuerung der Schleusen und damit die Verteilung des Wassers in den Kanälen verantwortlich.
Der Bau des Kanalsystems in Burgdorf ist auf den Energiebedarf des Gewerbes und der frühen Fabriken zurückzuführen. Die ältesten schriftlichen Zeugnisse von mit Wasserkraft betriebenen Mühlen stammen aus dem 13. Jahrhundert. Später kamen Webereien und Maschinen zur Metallverarbeitung hinzu. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Burgdorf etwa 35 Industriebetriebe, von denen die Hälfte eigene Wasserkraft nutzte.1 Zunächst erfolgte die Kraftübertragung über Riemen oder Wellen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Wasserräder durch Turbinen und Generatoren zur Stromerzeugung ersetzt.
Ein Stollen und ein Wasserkreuz
Das Wasser in den Kanälen stammte einerseits vom Oberburgbach, der durch verschiedene natürliche Bäche gespeist wird, und andererseits von der Emme. Wegen ihres Wildwassercharakters kam die Emme für die direkte Wasserkraftnutzung weniger infrage, weshalb man ihr Wasser in Kanäle leitete. Im 18. Jahrhundert wurde der Verlauf der Kanäle bezüglich ihres Gefälles optimiert. Damit möglichst wenig Höhe verloren ging, baute man 1723 sogar einen 65 m langen Stollen durch den Schlossfelsen (Abb. 5). Als natürliche Fortsetzung des Oberburgbaches diente die Kleine Emme primär als Hochwasserentlastung. Dadurch entstand ein Unikum: das Burgdorfer Wasserkreuz (Abb. 4). An dieser Stelle kreuzt sich der Kanal aus der Emme mit einem natürlichen Gewässer, dem Oberburgbach bzw. der Kleinen Emme (Abb. 1). Je nach Wasserführung des Oberburgbaches wird mehr oder weniger Wasser aus der Emme beigemischt. Oberstes Ziel war und ist es auch heute noch, eine konstante Wasserführung in den Kanälen zu gewährleisten, um die Kraftwerke optimal betreiben zu können. Verschiedene Hochwasserentlastungen sollen Überschwemmungen verhindern.
Unterhalb von Burgdorf unterquert der Kanal in einem 1898 angelegten Rohr, einem sogenannten Düker, die Emme. Auf der anderen Flussseite setzt sich das Kanalsystem nach Kirchberg fort, führt der Autobahn A1 entlang nach Gerlafingen und mündet im solothurnischen Luterbach in die Aare. Solche Kanalsysteme wie in Burgdorf gab es früher in vielen Städten. Viele wurden im 20. Jahrhundert aufgegeben. In Burgdorf ist das Kanalsystem aussergewöhnlich gut erhalten. Weil viele Kanäle in der ehemaligen Burgerallmend lagen, gehören diese noch heute der Burgergemeinde. Es waren in den letzten Jahrzehnten aber vor allem die Kraftwerksbetreiber, die das Kanalnetz unterhielten und ihre Anlagen weiter betrieben und zum Teil auch erneuerten.
Neue Wertschätzung für die Kanäle
In Burgdorf hat man den Wert der Gewässer auf Stadtgebiet erkannt. Ein Beleg dafür ist ein 2008 publiziertes Faltblatt, der drei Spaziergänge entlang der Gewässer beschreibt, darunter eine Technik-Tour zum Thema Wasserkraft.[2] Bereits 1978 liess die Stadt von einem Ingenieurbüro eine Studie über die Behandlung der Bachläufe und Kanäle erstellen.[3] Sie zeigte unter anderem deren Bedeutung für das Stadt- und Landschaftsbild sowie die Erholung auf. «Die Studie hat entscheidend zu einem neuen Bewusstsein beigetragen», sagt Fritz Keusen, der Leiter des Tiefbauamtes und von Stadtgrün in Burgdorf. Seither geniessen die Gewässer im Siedlungsgebiet wieder eine grössere Wertschätzung. Sie tragen insbesondere auch zur Lebensqualität bei (Titelbild des Heftes, Abb. 6+8).
Ein weiterer wichtiger Schritt war laut Keusen auch das neue Gesetz über den Gewässerunterhalt und Wasserbau des Kantons Bern von 1989. Fortan konnten keine Gewässer mehr überdeckt werden, und sämtliche Bauten in Gewässernähe waren durch den Kanton zu bewilligen. Mit dem Erlass gingen auch die Unterhaltspflichten für die Gewässer grundsätzlich von den Grundeigentümern auf die Gemeinden über. Beim Kanal in Burgdorf sei klar gewesen, dass dieser wie ein Fliessgewässer betrachtet werde, sagt Keusen. Lediglich für die überdeckten Abschnitte sind weiterhin die Grundeigentümer verantwortlich. Und für den Kanalunterhalt in unmittelbarer Nähe der Kraftwerke sind weiterhin deren Besitzer zuständig.
Wichtige Rolle des städtischen Elektrizitätswerkes
Einen Beitrag zur Erhaltung der Kleinwasserkraftwerke leistete auch das Elektrizitätswerk Burgdorf, das den von den Betrieben und Fabriken selber nicht benötigten Strom ins eigene Netz einspeiste. Laut der Studie von 1978 bezahlte es für diesen Strom gleich viel wie für den von den Bernischen Kraftwerken (BKW) bezogenen (7.2 – 7.3 Rp. / kWh). Einen solchen Preis zu bezahlen, war nicht üblich, denn bei den Burgdorfer Kraftwerken fiel der überschüssige Strom damals vor allem in der Nacht und an den Wochenenden an. Man betrachtete dies jedoch ausdrücklich als Förderung der noch existierenden Kleinwasserkraftwerke.[4] Damals besass das städtische Elektrizitätswerk selber noch ein Kraftwerk. Inzwischen ist es zu einem Energie- und Kommunikationsversorger der Region geworden und hat deshalb vor sechs Jahren das Kraftwerk an Fritz Uhlmann verkauft, der es seit seiner Pensionierung betreut.
Mit 35 kW Leistung ist es eines der kleinsten in Burgdorf (Titelbild S. 15). Automatische Steuerung des Kanalsystems Die Genossenschaft hat in letzter Zeit vermehrt in die Modernisierung des Kanalnetzes investiert. Derzeit werden jährlich etwa 3.3 Mio. kWh Strom produziert. Hans Ulrich Flückiger möchte die Stromerzeugung um 40 % steigern, dies entspräche dann rund 5 % des Burgdorfer Elektrizitätsbedarfs. Zwei wichtige Schritte konnten bereits realisiert werden. Die Kapazität des obersten Kanalabschnitts wurde erhöht, und seit drei Monaten ist eine neue automatische Steuerung für die Wasserregulierung in den Kanälen in Betrieb. Sonden messen die Pegelstände an verschiedenen Stellen im Kanalsystem. Erfasst werden auch die Wassermengen aus den natürlichen Kanalzuläufen. Aus den Messungen errechnet das Regelsystem die maximal mögliche Wasserentnahme aus der Emme, denn die Abflusskapazität des Kanalsystems beträgt lediglich etwas mehr als 5 m³/s.
Geht es nach Flückiger, soll als dritte Massnahme die Wassereinleitstelle an der Emme optimiert werden. Unter Einhaltung der festgelegten Restwassermengen von 2.2 m³/s würde es die Wasserführung der Emme erlauben, an durchschnittlich 250 Tagen im Jahr die konzessionierte Wassermenge von 5 m³/s auszuleiten. «Mit der jetzigen Entnahmestelle kann diese Menge aber lediglich an 50 bis 100 Tagen voll ausgeschöpft werden», sagt Flückiger. Damit mehr Wasser genutzt werden kann, wären technische Anpassungen an der Staustufe beim Einlaufwerk an der Emme notwendig. Dazu müssten nicht nur die Mitglieder der Kraftwerksgenossenschaft ihren Segen geben, sondern vor allem auch der Kanton Bern. Zudem stellen sich bei einer stärkeren Ausnutzung der Kapazität der Kanäle auch Sicherheitsfragen. Die Emme ist ein launisches Gewässer; das ist seit Jeremias Gotthelfs Erzählung «Die Wassernot im Emmental» allgemein bekannt. Ihr Wasserstand kann innerhalb kurzer Zeit um einen Meter ansteigen. Aus diesem Grund ist sicherzustellen, dass die Steuerung der Schleusen auch im Hochwasserfall zuverlässig funktioniert.
Chance für die Stadtentwicklung
Ein Netz von Kanälen bringt Leben in die Stadt und prägt ihr Gesicht. Hier schlummert ein riesiges Potenzial zu einer noch attraktiveren Gestaltung der städtischen Räume. Bei der Stadtplanung würden die Kanäle mit einbezogen, sagt Fritz Keusen. So etwa beim Quartier nördlich des Bahnhofs, das ein Entwicklungsschwerpunkt der Stadt ist. Auch das Wasserkreuz könnte mit einer gelungenen Aufwertung zu einem Wahrzeichen Burgdorfs werden. Erstaunlicherweise sind die Burgdorfer Kanäle in der Schweiz bisher nur wenig bekannt.
Anmerkungen:
[01] Otto Blaser: Kanalsystem in Burgdorf, 2000
[02] Baudirektion der Stadt Burgdorf: Fliessgewässer in Burgdorf – Drei Streifzüge, 2008. Das Faltblatt kann bei der Baudirektion Burgdorf bestellt werden: Tel. 034 429 42 11, baudirektion@burgdorf.ch
[03] Planungsbüro Ulrich Stucky: Behandlung der Bachläufe und Kanäle in der Richtplanung der Stadt Burgdorf. Studie im Auftrag des Stadtplanungsamtes der Stadt Burgdorf, 1978
[04] Der Produktionspreis für elektrische Energie in Kleinwasserkraftwerken wurde 1978 mit 8 Rp. / kWh angegeben. Darin sind allfällige Reparaturen oder Investitionen zur Erneuerung der Anlagen jedoch nicht eingerechnet. Im Bericht wird die Zukunft der Kleinwasserkraftwerke denn auch eher pessimistisch beurteiltTEC21, Fr., 2012.07.13
13. Juli 2012 Lukas Denzler