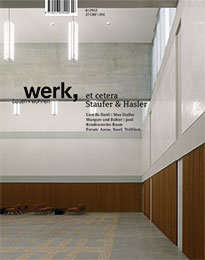Editorial
In der Wahrnehmung von Architektur hierzulande finden sich zweierlei öffentliche Bauten: solche, die das Gemeinwesen durch ihr tadelloses Funktionieren und bisweilen auch ausserhalb von Fachkreisen erkannte architektonische Qualität repräsentieren, und solche, die darüber hinaus für eine staatstragende Identität stehen. Zu nennen sind hier die Bauten des jungen Schweizerischen Bundesstaates aus dem 19. und 20. Jahrhundert: das Parlamentsgebäude von Hans Wilhelm Auer in Bern, gleich wie das Polytechnikum von Gottfried Semper und das Landesmuseum von Gustav Gull, beide in Zürich; das Bundesgericht in Lausanne von Louis-Ernest Prince und Jean Béguin und die Schweizerische Landesbibliothek der Architekten Oeschger, Kaufmann und Hostettler, wiederum in Bern. Alle diese Bauten stellten für ihre Zeit stilistisch einen Höhepunkt und gewissermassen auch einen Abschluss dar. Dies gilt für die Stile des Eklektizismus und der Moderne in Bern genauso wie für den bürgerlichen Klassizismus oder den Heimatstil in Zürich oder den Neoklassizismus in Lausanne. Die Liste kann ohne Anspruch auf Vollständigkeit um neuere Beispiele erweitert werden: Um das Bundesbriefarchiv in Schwyz von Joseph Beeler, typisch für den Landistil, und für die heutige Zeit um das Learning Center der EPF Lausanne von Sanaa, das für internationale Stararchitektur steht. Nun findet mit dem Neubau des Schweizerischen Verwaltungsgerichts in St. Gallen eine weitere Institution ihr Gehäuse und eine Form, die architektonisch bedeutungsvoll sind. Der Bau der Architekten Staufer & Hasler kann jedoch nicht als ein Höhepunkt und Abschluss einer Epoche gesehen werden – eher stellt er einen Anfangspunkt dar: Die Fragen und Antworten zur Repräsentation, zur Tektonik und zum architektonischen Raum, die der Bau aufwirft, lassen eine Erneuerung der Schweizer Architektur erwarten oder zumindest eine Belebung der Debatte darüber erhoffen. Denn die Interpretation des Programms, die Konstruktion und der feierliche und trotzdem moderne Rahmen der Architektur des Gerichtsgebäudes jenseits hohler Pathosformeln weisen über die «Swiss Box» und über die «Swiss Shapes» hinaus. Zudem beruhen hier die konstruktiven und räumlichen Innovationen durch und durch auf komplexen, aber nachvollziehbaren Regeln – und das ist einer gesellschaftlichen Meinungsbildung, insbesondere über öffentliche Architektur förderlich.
Das vorliegende Heft möchte hierzu einen Beitrag leisten. Die versammelten Beiträge sind, so thematisch und inhaltlich verschieden sie auch erscheinen mögen, alle dahin angelegt, ein Nachdenken über die Architektur in allen Massstäben in Gang zu bringen: Sei es über Monumentalität in St. Gallen, die Angemessenheit zu einem Denkmal in Heidelberg, die Aktualität der Spuren des Lebens in São Paulo, die Rahmung der Masse als gesellschaftliches Ornament anhand von Fussballstadien in Luzern und Thun oder die intime Schönheit eines einzelnen Raums in einem Zürcher Hinterhof.