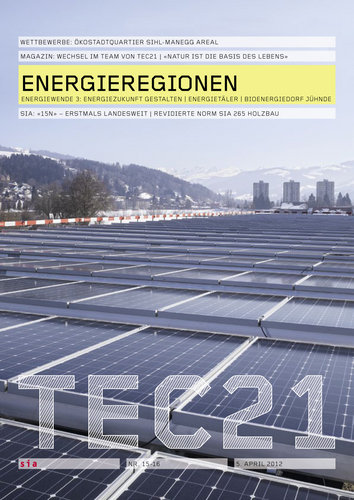Editorial
«Global denken, lokal handeln» – dieser Leitgedanke bringt die Motivation der Menschen in Energieregionen auf den Punkt: Energetische Verbesserungen bei sich zu Hause in der eigenen Region erzielen, dabei aber die grösseren Zusammenhänge nicht aus den Augen verlieren.
Wer sich auf den Weg in eine neue Energiezukunft begibt und beispielsweise eine Energieregion gründet, sucht nach einprägsamen Begriffen und Bildern. Energieautarkie ist so ein Schlagwort. Zumindest in der Schweiz löst dieser scheinbar aus einer anderen Zeit stammende Begriff mehrheitlich positive Assoziationen aus. Der Wunsch nach Unabhängigkeit ist gross, auch wenn dies in einer zunehmend vernetzten Welt immer mehr zu einer Illusion wird und auch aus volkswirtschaftlicher Sicht gar nicht immer zu optimalen Ergebnissen führt («Die Energiezukunft selbst gestalten»).
Dabei geht es nicht darum, die Interaktionen und Handelsbeziehungen zur Aussenwelt zu kappen. Vielmehr gilt es, das Bewusstsein der Menschen zu schärfen, wie viel Energie eigentlich benötigt wird und welcher Teil davon selbst bereitgestellt werden kann. Die einheimischen Ressourcen optimal zu nutzen, zeugt auch von globalem Verantwortungsbewusstsein. Die reiche Schweiz könnte – zumindest so lange es ihr wirtschaftlich gut geht – ihren Energiebedarf über Importe decken. Doch eine solche Strategie bliebe nicht ohne Folgen für die Länder, die uns ihre Ressourcen liefern.
In jüngster Zeit sind in der Schweiz einige Energieregionen entstanden. Im Artikel «Energietäler im Aufwind» legen wir den Schwerpunkt auf das Toggenburg. Wie in den anderen Energieregionen will man dort nicht zuwarten, bis die grosse Politik die Weichen stellt. Durch die Erschliessung vieler kleiner energetischer Potenziale wird der Selbstversorgungsgrad einer Region mit Energie deutlich verbessert. Doch diese Entwicklung ist nicht ohne Risiken: Gerade der Ausbau der Kleinwasserkraft und Windenergie tangiert die Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes. Eine Abwägung von Fall zu Fall ist unerlässlich.
Dabei sollen die öffentlichen Interessen gewahrt werden, ohne die Eigeninitiative von Privaten übermässig einzuschränken.
Auch bei der Nutzung von Bioenergie ergeben sich neben den Möglichkeiten auch Konflikte. Im niedersächsischen Jühnde («Bioenergiedorf Jühnde») wird ein Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche für die Erzeugung von Bioenergie verwendet. 2009 wurden in Deutschland bereits auf 10 Prozent der Landwirtschaftsfläche Energiepflanzen angebaut. Letztlich stellt sich die Frage, wie viel Fläche der Nahrungsmittelproduktion entzogen werden darf. Diese Problematik hat eine globale Dimension – zumindest solange Europa Nahrungs- und Futtermittel im grossen Stil importiert und das Hungerproblem in den ärmeren Regionen der Welt nicht gelöst ist.
Lukas Denzler, Alexander Felix
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Ökostadtquartier Sihl-Manegg Areal
10 PERSÖNLICH
Wechsel im Team von TEC21 | Ämter und Ehren
12 MAGAZIN
«Natur ist die Basis des Lebens» | Neue Architektur in Südtirol
18 DIE ENERGIEZUKUNFT SELBER GESTALTEN
Bruno Abegg
Die Vision, unabhängig von fossiler Energieimporten zu werden, übt auf viele Regionen eine starke Faszination aus.
22 ENERGIETÄLER IM AUFWIND
Lukas Denzler
Das Toggenburg und das Goms im Wallis gehen mit gutem Beispiel voran. Beide Regionen wollen die erneuerbaren Energieressourcen besser nutzen und gleichzeitig die regionale Wirtschaft ankurbeln.
29 BIOENERGIEDORF JÜHNDE
Swantje Eigner-Thiel
Das 780-Seelendorf in Niedersachsen setzt seit zehn Jahren voll auf Bioenergie. Dem Beispiel von Jühnde folgen immer mehr Dörfer.
33 SIA
«15n» – erstmals in der ganzen Schweiz | Kurzmitteilungen | Revidierte Norm SIA 265 Holzbau | Vakanzen
37 FIRMEN
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Die Energiezukunft selber gestalten
Die Vision, unabhängig von Energieimporten zu werden, übt auf viele Regionen eine starke Faszination aus. Mit der angestrebten Energiewende bekommen die regionalen Initiativen Auftrieb. Da Regionen jedoch mit ihrer Umgebung auf vielfältigste Weise verflochten sind, geht es nicht darum, starre Insellösungen anzustreben.
Wie die Energieversorgung künftig gewährleistet werden kann, ist eine zentrale Frage. Eine neuere Entwicklung sind sogenannte Energieregionen. Diese haben sich zum Ziel gesetzt, den eigenen Energiebedarf möglichst durch regionale, erneuerbare Energieträger zu decken, Energie zu sparen und sie effizienter zu nutzen. Die meisten Regionen, die nach Energieautarkie streben, berufen sich auf das Konzept der Nachhaltigkeit in seinen drei Zieldimensionen. In der konkreten Ausgestaltung jedoch werden die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte vergleichsweise prominent, die ökologischen dagegen eher stiefmütterlich behandelt. Augenfällig wird diese Problematik etwa, wenn es beim Bau von Anlagen zur Energieproduktion zu Zielkonflikten mit dem Natur- und Landschaftsschutz kommt. Eine Region kann aber nur dann als nachhaltig gelten, wenn auch diese Belange berücksichtigt werden.
Die fossile Abhängigkeit überwinden
Immer mehr Regionen in Europa erklären sich zu Energieregionen. Als Pioniere gelten die Stadt Güssing[1] im österreichischen Südburgenland, wo sich auch das europäische Zentrum für erneuerbare Energien angesiedelt hat, das deutsche Bioenergiedorf Jühnde (vgl. «Bioenergiedorf Jühnde», S. 29) und die dänische Insel Samsø[2]. Bei allen Unterschieden haben die Energieregionen eine gemeinsame, ehrgeizige Vision: Sie wollen sich vom Import fossiler Energie unabhängig machen. Die Vorreiter haben gezeigt, dass dies auch möglich ist. Eng damit verknüpft ist zudem oft das Ziel einer Klima- beziehungsweise CO2-neutralen Region. Und in vielen Fällen geht es auch darum, die regionale Wirtschaft anzukurbeln. Energiewende, Autarkie, Autonomie: Diese Begriffe sind nicht unbedingt wissenschaftlich gemeint, sondern dienen dazu, den eigenen Weg zu benennen und sich von anderen ab-zugrenzen. Sie sind Resultat eines politischen Entscheidungsfindungsprozesses und nicht eines fachlichen Diskurses. Im Folgenden wird auf einige Probleme, die bei der Verwendung von Begriffen wie «autark» auftauchen können, hingewiesen. Gemäss Duden bedeutet autark «(vom Ausland) wirtschaftlich unabhängig, sich selbst versorgend, auf niemanden angewiesen». Auf eine Region übertragen heisst dies, dass der gesamte Energiebedarf aus einheimischen Energiequellen gedeckt wird. Viele Konzepte weichen jedoch mehr oder weniger deutlich von diesen Vorgaben ab. Relativierungen wie «soweit wie möglich» oder «weitestgehend» weisen darauf hin, dass in einigen Fällen lediglich von einer Teilautarkie gesprochen werden kann. Mitunter werden ganze Bereiche ausgeklammert, wie etwa der Verkehr. Im Weiteren stellt sich die Frage, ob die Autarkie ein rechnerisches oder ein absolutes Ziel darstellt. Rechnerisch wäre Autarkie erreicht, wenn die Defizite in einer Energieform wie zum Beispiel Treibstoff mit den Überschüssen einer anderen Energieform wie zum Beispiel Strom ausgeglichen werden, oder wenn Defizite zu gewissen Zeiten wie über Mittag mit Überschüssen zu anderen Zeiten, beispielsweise bei kräftigem Wind in der Nacht «verrechnet» werden. Absolute Energieautarkie sieht solches Gegenrechnen nicht vor.
Keine Insellösungen anstreben
Energieautarkie ist auf verschiedenen räumlichen Ebenen anzutreffen. Es gibt den energieautarken Bauernhof, die energieautarke Gemeinde, den energieautarken Landkreis und vieles mehr. Auch energieautarke Nationen sind denkbar. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was eine geeignete Grösse ist, um das Autarkieziel zu erreichen. Gemäss einem in Deutschland erarbeiteten Leitfaden ist es wichtig, «einen gangbaren Kompromiss zwischen notwendiger räumlicher Nähe zu den Menschen vor Ort und der für die Schlagkräftigkeit gewünschten professionellen Ressourcenausstattung zu finden».[3] Es geht also auch um das Know-how, das für einen erfolgreichen Energiewende-Prozess unabdingbar ist. Dieses Wissen ist eher in einer Region vorhanden und weniger in einem Dorf, was für die Region als optimale räumliche Einheit spricht. Damit ist auch der Bilanzraum definiert. Hier tut sich ein Dilemma auf: Streng genommen verlangt Energieautarkie nach einem geschlossenen System – Regionen dagegen sind offene Systeme. Folglich müsste man eine Region als «Insel» begreifen – was in vielen Initia- tiven auch getan wird. Das wirkt jedoch geradezu anachronistisch, wenn man bedenkt, dass jede Region auf vielfältige Art und Weise mit ihrer Umgebung verflochten ist, also keineswegs ein «Inseldasein» führt. Autark bedeutet auch, dass die Energie in Eigenregie produziert wird. Hier geht es im weitesten Sinne um die Finanzierung und die Eigentumsverhältnisse – zwei wichtige Aspekte, will man die erhofften wirtschaftlichen Effekte einer «Energiewende» tatsächlich erreichen, zum Beispiel den Kapitalabfluss vermindern und die regionale Wertschöpfung erhöhen.
Motivation für Energieregionen
Es gibt gute Gründe, sich hin zu einer energieautarken Region zu entwickeln: Klima und Umwelt schützen: Die Produktion und der Verbrauch fossiler Energieträger sind mit gravierenden Umweltbelastungen verbunden. Durch sparsame und effizientere Energienutzung und eine Umstellung auf erneuerbare Energieträger können Umwelt und Klima geschützt werden. Da die Potenziale zur Erzeugung erneuerbarer Energien ungleich verteilt sind, bedeutet beispielsweise ein nationales Ziel von 30 % erneuerbarer Energie, dass einige Regionen weit darüber hinausgehen, sich also in Richtung einer 100-prozentigen Versorgung mit erneuerbaren Energien entwickeln müssen. Stabile Preise, sichere Versorgung: Die Energiepreise werden steigen. Eine verminderte Abhängigkeit von importierter fossiler Energie beziehungsweise die Umstellung auf erneuerbare Quellen gewährleisten Versorgungssicherheit und Preisstabilität. Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung: Die Förderung von einheimischen Energiequellen und Energiesparmassnahmen haben positive Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt. Land- und Forstwirtschaft können von einer verstärkten Nutzung der regionalen Rohstoffe (Biomasse) profitieren. Bereits bestehende Unternehmen aus den Bereichen Energietechnik, Wärmedämmung und Hochbau profitieren ebenfalls. Wird Energie importiert, so fliesst regionales Kapital ab, die Kontrolle liegt ausserhalb des Einflussbereichs der regionalen Akteure. Eine effizientere Energieverwendung und die dezentrale Versorgung auf der Basis von erneuerbaren Quellen können diese Nachteile beseitigen. Gestärkte Identität: Der Aufbau einer energieautarken Region setzt einen breiten Konsens der beteiligten Akteure voraus. Das gemeinsame Engagement verbindet und stärkt die sozialen Netze. Man kann sich als fortschrittliche und umweltbewusste Region präsentieren und eine Vorreiter- und Vorbildfunktion einnehmen. Eine positive Innensicht und ein Image als innovativer Standort fördern den Zusammenhalt und die Identifizierung mit der Region.
Der Weg in die Energiezukunft ist ein Prozess
Energieregionen planen ihre Zukunft langfristig. Die zugrunde liegenden Konzepte sind oft innovativ und vielversprechend, aber auch noch vergleichsweise jung. Mit anderen Worten: Es gibt kaum Erfahrungswerte und keine allgemein gültigen Vorgehensweisen. Häufig geht man nach dem Motto «Versuch und Irrtum» vor, im Wissen, dass der Weg in die Energieautarkie ein Prozess ist. In jüngster Zeit haben sich einige Erfolgsfaktoren herauskristallisiert, die eine solche Entwicklung begünstigen.[4] Dazu zählen unter anderem: – Eine überzeugende Vision, mit der man die ganze Bevölkerung ansprechen und «Wir-Gefühle» auslösen kann. – Ein klares Umsetzungskonzept mit realistischen Zielen. Wichtig ist, dass erste Resultate schnell sicht- und erlebbar werden. – Engagierte Persönlichkeiten, die den Prozess tragen und vorantreiben. – Gute Teams, die ihre Aufgaben verantwortlich erledigen. – Eine langfristig gesicherte Finanzierung. Ein Anschub durch staatliche Fördermittel ist sehr hilfreich. Mittelfristig sollte jedoch darauf geachtet werden, dass möglichst viel Kapital in der Region mobilisiert werden kann.
In Regionen, die sich auf den Weg in die Energieselbständigkeit machen, schlummert viel ökonomisches Potenzial. Dieses gilt es auszuschöpfen. Die regionalwirtschaftlichen Effekte müssen detailliert ausgearbeitet werden. Von einfachen Annahmen und allzu optimistischen Hochrechnungen ist jedoch abzuraten: Schliesslich sollen berechtigte Hoffnungen und keine übertriebenen Erwartungen geweckt werden.
Dem Artikel liegt der 2010 erschienene CIPRA-Hintergrundbericht «Energieautarke Regionen» zugrunde, der auch elektronisch zur Verfügung steht: www.cipra.org/de/cc.alps/ergebnisse/compacts
Anmerkungen:
[01] Die Stadt Güssing erzeugt über eine Holzvergasungsanlage Strom und Wärme. Bereits 2005 stellte man aus nachwachsenden Rohstoffen bedeutend mehr Wärme und Strom bereit, als die Stadt benötigte. Informationen: www.guessing.at, www.eee-info.net
[02] Die Insel Samsø ist dank Windkraftanlagen, einem Sonnenkraftwerk und Biogasanlagen weitgehend energieunabhängig und kann sogar einen beträchtlichen Teil des erzeugten Stroms exportieren.
[03] Tischer, M. et al.: Auf dem Weg zur 100 % Region – Handbuch für eine nachhaltige Energieversorgung von Regionen. 4. Auflage, München, 2009, Seite 51
[04] Neges, B. & Schauer, K.: Energieregionen der Zukunft – erfolgreich vernetzen und entwickeln. Graz, 2007; Kompetenznetzwerk Dezentrale Energietechnologien (Hrsg.): Kompass für die Entwicklung nachhaltiger 100 %-Erneuerbare- Energie-Regionen. Kassel, 2010TEC21, Mo., 2012.04.09
09. April 2012 Bruno Abegg