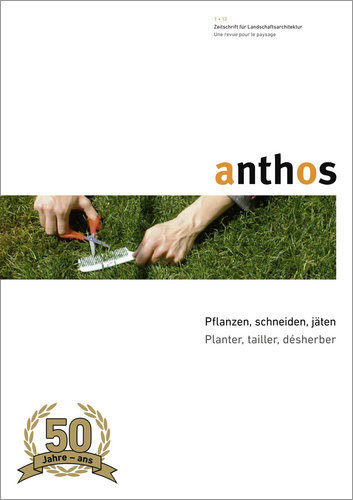Editorial
In Kindheitsträumen kommt der Gedanke an Unterhaltsarbeiten gar nicht vor: Wünschen sich doch so manche ein Schloss mit Märchengarten – ohne Bezug zur Pflegerealität. Die Klassiker des Traumgartens, zum Beispiel Rosen- und Sommerblumen, englische Staudenbeete und geschnittene Heckenskulpturen, Springbrunnen und Wasserbecken benötigen aber viel Zeit, Geld und Hingabe für ihr Bestehen.
In den vergangenen Jahren sind nicht nur die schmelzenden Unterhaltsbudgets der öffentlichen Hand und die knapper werdende Zeit des privaten Gartenbesitzers zum Thema geworden, sondern auch die Ansprüche an einen stärker ökologisch orientierten Unterhalt von Gärten und öffentlichen Anlagen. Dieses gestiegene Interesse an einer zielgerichteten und wohlgeplanten Pflege lässt sich nicht nur an der grossen Anzahl der Fachveröffentlichungen zum Thema ablesen, sondern vor allem an der geänderten Arbeitsweise von Landschaftsgärtnern und Stadtgärtnereien.
Die sozialen Funktionen von öffentlichen Parks werden immer wichtiger. Die aus städtebaulichen und raumplanerischen Gründen gewünschte Verdichtung der Städte führt zu neuen Ansprüchen an den urbanen Freiraum. Grössere und stärker genutzte Grünflächen erfordern eine kostengünstige Pflege.
Ihre als «Lebenszykluskosten» bezeichneten Gesamtkosten (Planung, Bau, lebenslanger Unterhalt) von Freiraumgestaltungen sollten zukünftig schon bei der Planung mit berücksichtigt werden; nach der Forschung steht hier nun die angewandte Landschaftsarchitektur stärker in der Pflicht. Auch auf der politischen Ebene muss noch gelernt werden. Während der private Gartenbesitzer die zukünftigen Pflegeansprüche seines Gartens häufig bei der Anlage schon bedenkt, wird diese Frage von den politischen Akteuren und vor allem bei der Formulierung von Wettbewerbsprogrammen noch meist vernachlässigt: gross ist die Versuchung, sich mit einer «Prachtanlage» zu schmücken, ohne die Folgekosten zu bedenken.
anthos macht die zahlreichen Einflüsse, Methoden und Techniken, welche bei der zielgerechten Pflege von Grünanlagen heute berücksichtigt werden müssen, zum Thema. Die Organisation des Grünflächenunterhalts in einer Grossstadt wie Nantes, in der nicht nur ökologische sondern auch soziale Indikatoren zur ständigen Erfolgskontrolle und Anpassung der Pflege genutzt werden, mögliche Reaktionen auf die extreme Belastung innerstädtischer Grünflächen sowie die spezifischen Mittel zur langfristigen Sicherung des Baumbestandes einer Stadt sind besonders für öffentliche Verwaltungen interessant. Auch Spezialthemen werden angesprochen: besondere Pflegeansprüche historischer Gärten, Probleme mit invasiven Neophyten oder Methoden, seltene Tierarten auch im dicht bebauten innerstädtischen Raum zu fördern. Der Beitrag zum Schweizer Nationalpark erinnert uns schliesslich: es war einmal eine Landschaft ohne Unterhalt …
Stéphanie Perrochet
Inhalt
Jacques Soignon
– Grünflächenmanagement in Nantes
Ursula Kellner
– Das öffentliche Grün, ein Pflegefall?
Florian Brack
– GreenCycle® – Lebenszykluskosten von Freiräumen
Martin Geissbühler
– Naturnahe Plätze und Anlagen für Kinder
Thomas Herrgen
– Stresstest für das Ufergrün
Stephan Bernhard
– Für einen vitalen Baumbestand
Nicolas Béguin
– Baumpfleger, Baumberater
Sonja Rindlisbacher, Stéphanie Perrochet
– Arten ohne Grenzen
Sylvie Barbalat, Blaise Mulhauser
– Biodiversität in der Stadt
Andreas Erni
– Umsorgte Dynamik
Steffen Osoegawa
– Unterhalt historischer Gärten
– Wettbewerb: 50 Jahre anthos!
– Schlaglichter
– In memoriam Sylvie Visinand
– VSSG-Mitteilungen
– Forschung und Lehre
– Wettbewerbe und Preise
– Agenda
– Literatur
– Schweizer Baumschulen
– Produkte und Dienstleistungen
– Die Autoren
– Impressum und Vorschau
Arten ohne Grenzen
Immer mehr Pflanzenarten breiten sich weit über ihre Ursprungsgebiete aus. Konkurrenzstarke Neophyten können dabei grosse Probleme in ihrer neuen Heimat schaffen. Gezielte Bekämpfungsmassnahmen sind heute unabdingbar.
Seit vielen tausend Jahren kultiviert der Mensch Pflanzen. Viele Obst- und Getreidearten wurden aus dem mediterranen Raum und Westasien zu uns gebracht, sie gelten als Archäophyten. Pflanzen, die nach der Ankunft von Kolumbus in Amerika (1492) bei uns eingeführt wurden, werden als Neophyten bezeichnet. In der Schweiz sind dies über 350 Arten.
Ab wann ein Neophyt als problematisch angesehen werden muss, ist eine nicht einfach zu beantwortende Frage, zumal deren Einfluss auf die Umwelt dynamischen Prozessen unterliegt. Neophyten haben in den hiesigen Ökosystemen keine natürlichen Feinde, und sie können beispielsweise durch die Klimaveränderung begünstigt werden. Je früher das invasive Verhalten entdeckt wird, desto eher besteht die Chance, dass mit Bekämpfungsmassnahmen die Bestände noch kontrolliert werden können.
Mittels eines Kriterien-Schlüssels für das Schadenspotenzial in den Bereichen Biodiversität (Verdrängung seltener Arten, Hybridisierung), Gesundheit und /oder Ökonomie werden die Neophyten beurteilt. Problematische Arten wurden in der «Schwarzen Liste» sowie der «Watch-List» zusammengestellt. Die Listen und Kriterienschlüssel durchlaufen im Moment eine umfassende Revision, sie werden im Frühjahr 2012 neu auf www.infoflora.ch zu finden sein. Neu wird es auch eine Warnliste[1] geben, die Pflanzen beinhaltet, welche im Ausland bereits Probleme verursachen, jedoch in der Schweiz noch kaum verbreitet sind.
Zur Prävention gilt es, auf die Verwendung von Pflanzen aus diesen Listen zu verzichten. Die Bekämpfung von Beständen der Probleme verursachenden Arten gestaltet sich wesentlich schwieriger. Die Kosten können extrem hoch sein, und es stellt sich die Frage der Verhältnismässigkeit. Daher sieht auch der Gesetzgeber keine genau definierten Massnahmen vor. Prioritäten und geeignete Eingriffe müssen jeweils situationsbezogen entschieden werden. Verschiedene Institutionen bieten Kurse für Praktiker an, die Kenntnisse zur Bekämpfung invasiver Neophyten vermitteln.
Eine wichtige Gesetzesgrundlage ist die Freisetzungsverordnung (FrSV 2008, SR 814.911), welche elf Pflanzenarten aufführt, mit denen der direkte Umgang verboten ist. Sie dürfen weder verkauft, transportiert noch gepflanzt werden. Sofern diese Pflanzen spontan wachsen, besteht keine unmittelbare Bekämpfungspflicht.
Es ist die Aufgabe der Kantone, erforderliche und sinnvolle Massnahmen zur Bekämpfung dieser Arten anzuordnen. Einzig für Ambrosia artemisiifolia besteht eine schweizweite Melde- und Bekämpfungspflicht nach der Pflanzenschutzverordnung. Für die Umsetzung der Massnahmen sind oft die Gemeinden zuständig. Wer in welchem Fall die Kosten für die Bekämpfung übernimmt, ist nicht einheitlich geregelt.
Aufgaben der Kantone
Die Kantone stehen vor einer grossen Herausforderung. Im Kanton Zug zum Beispiel verschafften sich die verschiedenen Ämter und Fachstellen gemeinsam einen Überblick über die Problemlage und die konkreten Gefahren im Kantonsgebiet. Der Umsetzungsplan[2] führt nun zehn Pflanzenarten auf, die prioritär behandelt werden sollen. Je nach Gebiet (zum Beispiel Landwirtschaft, Naturschutz, Gewässer, Wald, Infrastruktur-Verkehr, Deponien) wurden Handlungsvarianten wie «bekämpfen», «stabilisieren» oder «keine Massnahmen» festgelegt. So müssen beispielsweise in Naturschutzgebieten alle zehn Arten bekämpft werden, während sich im Siedlungsgebiet vorerst die Bekämpfungsprioritäten auf wenige Arten beschränken.
Neophytenkonzept Werdhölzli
Im Gebiet Werdhölzli an der Limmat (Zürich) sind grosse Bestände des Japanischen Staudenknöterich vorhanden, aber auch Armenische Brombeere und Kirschlorbeer. Anlass für die Erarbeitung einer Bekämpfungsstrategie waren geplante Baumassnahmen (Auensteg, Anlage von Tümpeln)[3]. Das Büro planikum GmbH, Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, erstellte 2009 das differenzierte Neophytenkonzept Werdhölzli[4]. Die Bekämpfungsvorschläge erfolgen auf der Grundlage der Neophytenstrategie des Kantons Zürich (Massnahmenplan 2009–2013)[5]. Der erste Schritt zur Erarbeitung des örtlichen Bekämpfungskonzepts war eine genaue Kartierung der Fundorte der oben genannten Pflanzen im Werdhölzli (dreimalige Begehung von Februar bis Mai 2009). Anschliessend erfolgte eine detaillierte Abwägung des Gefährdungspotenzials der verschiedenen Arten in Bezug auf die ästhetische und ökologische Qualität der Landschaft und die formulierten Nutzungsziele. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die von den geplanten Baumassnahmen betroffenen Flächen gerichtet. Die befallenen Flächen sind zum Teil Eigentum der öffentlichen Hand, zum Teil in Privatbesitz (hier zurzeit keine Massnahmen), die gesamte Fläche gilt rechtlich als Wald, weswegen eine chemische Bekämpfung ausgeschlossen ist. Das Konzept definiert präzise Ziele und Massnahmen, die von einer Verhinderung der Ausbreitung (vegetative Ausdehnung, Verschleppung durch Pflanzenteile oder Verbreitung durch Sämlinge) bis zu einer vollständigen Beseitigung der Neophyten in Teilbereichen abgestuft sind. Die Bilanz der Bekämpfungsmassnahmen steht noch aus (Sektion Bau beim Amt für Wasser und Abfall, Stefano Pellandini).
Stadt Neuenburg
In der Stadt Neuenburg geht die Bekämpfung der invasiven Neophyten auf eine Initiative der Stadtgärtnerei zurück. Im Jahr 2003 wurde bei den routinemässigen Unterhaltsarbeiten das Bestehen zahlreicher Bestände des Japanischen Staudenknöterichs in den Steinschüttungen am Seeufer festgestellt. Die in der Folge gegründete Arbeitsgruppe GRINE[6] testete an einer Versuchsfläche verschiedene Bekämpfungsmassnahmen[7]. Gleichzeitig wurde das Thema «ökologisch oder gesundheitlich gefährliche Neophyten» von der Stadt umfassend zum Thema gemacht. In den folgenden Jahren wurden eine Bestandskartierung durchgeführt, die Mitarbeiter weitergebildet, die im Bereich Landschaft arbeitenden Unternehmen informiert und Beiträge zur Weiterbildung auf Kantonsebene geleistet. Auch für das breite Publikum wurden die vorhandenen Informationen aufbereitet und zugänglich gemacht (Anschreiben und Beratung). Heute wird von der Stadtverwaltung Neuenburg in jeder Baubewilligung darauf hingewiesen, dass Arten der «Schwarzen Liste» nicht gepflanzt werden dürfen. Je nach Gefährlichkeitsgrad und Ausbreitungsmechanismen der Pflanzen wurden entsprechende Behandlungsprotokolle festgelegt.
Ausblick
Die Bekämpfung von invasiven, gebietsfremden Pflanzen bereitet Kopfzerbrechen. In Zukunft werden Planung und Unterhalt von pflegearmen, ästhetisch attraktiven und ökologisch wertvollen Grünflächen einer Gratwanderung gleichen. Durch die Problempflanzen können beispielsweise vermeintlich pflegearme Ruderalstandorte zu dauerhaft pflegebedürftigen Flächen werden. Auch die «Sofortbegrünung mit Einheitsmischung» ist keine Lösung – gerade diese Arten könnten leicht zu neuen Problempflanzen werden. Wir sind aufgefordert, bei der Pflanzenverwendung wachsam zu sein, manch Altbewährtes muss über Bord geworfen werden. Als Anregung kann die Ersatzpflanzenliste von Andreas Gigon (2007) dienen. Mit dem Motto Vielfalt zu fördern, werden Landschaftsarchitekten auch in Zukunft gut fahren.
Weitere Informationen:
Praxishilfe_Neophyten_Web_v1_100319.pdf
Praxishilfe Kanton Luzern (fast identisch mit der des Kt. ZH): www.umwelt-luzern.ch/praxishilfe_neophyten.pdf
www.neobiota.ch
www.kvu.ch/d_kvu_arbeitsgruppen.cfm?gruppe=AGI&pid=138
[01] Telefon Sybilla Rometsch SKEW 13.12.2011.
[02] Weisung Kanton Zug, 2011.
[03] Schälchli et al.: Limmat Auenpark Werdhölzli – Aufwertung und Hochwasserschutz. 2005.
[04] Das Neophytenkonzept Werdhölzli (2009) wurde im Auftrag des Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) der
Baudirektion des Kantons Zürich erarbeitet.
[05] Die Neophytenstrategie des Kantons Zürich kann in ihrer überarbeiteten Form von März 2011 als pdf von der Seite
www.awel.zh.ch heruntergeladen werden.
[06] Groupe de travail pour les espèces invasives (Neuchâtel) GRINE.
[07] www.ne.ch/neophytes.anthos, Do., 2012.02.23
23. Februar 2012 Sonja Rindlisbacher, Stéphanie Perrochet