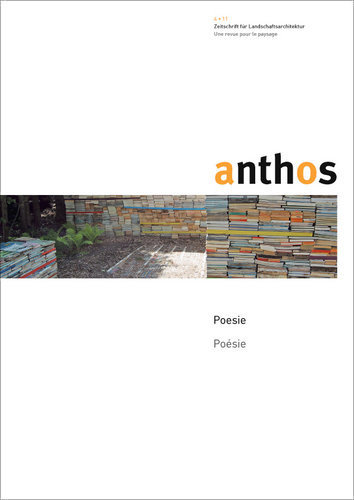Editorial
Die Poesie der Landschaft
Von Zeit zu Zeit eine Strasse beobachten. Sich dieser Beschäftigung mit voller Aufmerksamkeit widmen. Sieht man, was erwähnenswert ist? Sich einer Landschaft hingeben. Sich dazu zwingen, oberflächlicher zu sehen. Ein Stück Landschaft entziffern.
Hineinlauschen in den Ort. Weitermachen. Bis er unwahrscheinlich wird. Die Augen schliessen und die Landschaft mit allen Sinnen aus der Erinnerung beschreiben. Jede vorgefasste Meinung verjagen. Dem Raum den Ort entreissen.
So könnte, frei nach Perec, eine Handreichung zur Annäherung an die Poesie der Landschaft aussehen. Die Poesie gilt, auch ihrem Wortursprung her, der Erschaffung einer besonderen Qualität, einer sich der Sprache entziehenden Wirkung. Bildgewordene Emotion. Stimmungsgehalt und Zauber. Der Poesie der Landschaft erlagen nicht nur die grossen literarischen Poeten – von Goethe über Rousseau, von Hesse bis Hölderlin –, sie bildet auch einen bedeutenden Teil unserer Identität (und lässt sich deswegen auch so gut vermarkten: «Mehr Zeit für echte Glücksmomente», Ferienregion Heidiland). Die Arbeit von Landschaftsarchitekten und -planern als Gestalter und «Erschaffer» der Landschaft ist dabei zentral. Vielleicht sollten wir uns dieser besonderen Relevanz unserer Profession in allen Phasen des Entwurfs- und Realisierungsprozesses von Projekten gelegentlich bewusster werden.
Aber ist Poesie überhaupt plan- und umsetzbar? Entsteht sie nicht viel eher durch die Besonderheit des Moments, durch die dem Ort gegebene Geschichte und Bedeutung? Kann es eine universelle Poesie geben?
In der Wahrnehmung von Landschaft ist der Betrachter Konstrukteur. Und so geht es auch im Kontext von Poesie und Landschaft um Fragen des Blickwinkels und damit um den Mensch. Sein Vorwissen, seine Erfahrung und kulturelle Prägung bestimmen, was er zu sehen und wahrzunehmen in der Lage ist – und mithin auch, was er als poetisch empfindet. Voraussetzung ist die Bereitschaft, sich der Landschaft und ihren Orten auszusetzen und zuzulassen, dass sie Emotionen wecken. Aus dieser Perspektive heraus lässt sich auch der – scheinbare – Dualismus von Poesie und Alltag überwinden: durch einen bewussten Blick und eine wahrnehmende Offenheit.
Die weise Susan Sontag schrieb einst, Schönheit wohne nicht in den Dingen, sondern offenbare sich durch eine besondere Sehweise. So ist es auch mit der Poesie. Bei schlechten Projekten aber kann man sich noch so sehr um eine besondere Sehweise bemühen und wird ihre Poesie nicht spüren.
Sabine Wolf
Inhalt
Albert Kirchengast
- Die Ferne des Gartens
Paolo Bürgi
- Eine nacherzählte mediterrane Landschaft
Lukas Schweingruber, Dominik Bueckers
- Die Poesie des Unsichtbaren – ein Park in Uster
Lorenz Dexler, Martin Rein-Cano
- THE BIG DIG
Bernard Lassus
- Der Brunnen
Laurent Essig
- Die versteckte Seite der Schweiz
Michel Péna
- WEIHER-WOGE-WOLKEN
Bruno Vanoni
- «Die Landschaft stört mich beim Denken.»
Christiane Sörensen
- Grenzüberschreitung
Sabine Wolf
- Landschaft aufladen
Gabi Lerch
- Kamelbuckel in der Megacity
Anouk Vogel
- Vondel Verses
Thilo Folkerts
- Jardin de la Connaissance
Clà Riatsch
- Ode an die Arve
Weiher-Woge-Wolken
In Erwartung der warmen Wasser des Sommers,
versucht man, die Keilschrift der Lotusblüten zu entziffern,
wie sie von der zufälligen Geometrie der Pflanzen gezeichnet wurde
ähnlich einem Landschaftsgemälde, in dem Himmel und Wolken
die sinnlichen Kurven der Hügel spiegeln.
Am Süd- und Nordhang schwebt der Pass 620 Meter über den Höhen der Cevennen und des Mittelmeeres, das zu fern ist, um noch wirklich sichtbar zu sein, aber doch dank seines starken Charakters so gegenwärtig ist.
Es ist das Mittelmeer, das uns seine wildesten, und auch seine prächtigsten Wolken sendet.
Und so wohnen wir direkt am Meer…
am Wolkenmeer.
Hier sterben die Kastanienbäume an der Tintenkrankheit, so wie Dichter.
Wie der Erzähler Jean-Pierre Chabrol, dessen sanfte Stimme leise von den unendlichen Weiten und den grossen Aufständen der Cevennen berichtet, von Kamisarden und Partisanen der Résistance. Obwohl er uns erzählte, wie sehr der Duft des blühenden Ginsters ihn weniger an den Frühling, sondern vielmehr an den Tod erinnert, den Tod seiner Heimat, so lehnten wir uns dadurch nur noch mehr gegen diesen Tod auf.
Und so wollten wir den rebellischen Cevennen nachrufen, und erschöpft von den wieder erschönten Cevennen träumen.
Also wappneten wir uns, um auf die Landschaft zu wirken.
Nein, nicht zum Gärtnern
Nicht, um «Landschaft zu gestalten»
Sondern zum «Landschaftswirken»
Inspiriert und getrieben von den stürmischen Winden der Erinnerungen der Cevennen und anderer fantastischer Märchen, lehrte uns die Härte, uns diesen Orten zu stellen, an denen es stets und immer wieder um Leben und Tod geht. Wo die Menschen aus eigener Kraft ihr Land aufbauten, mit unendlich vielen aufeinander geschichteten Steinen, mit unendlich vielen Kämpfen.
Ach, es ist fürwahr nicht das «einfache» Südfrankreich der Strände und wolkenlosen, sorgenlosen Himmel.
Aber es ist das harte Land der Freiheit. Zwischen aufsteigendem Saft und abgründigem Hass.
Legt Eure Illusionen ab.
Der Stein muss aufgehoben werden, der stets wieder tief in das verlorene Flüsschen stürzt, fortgespült von sintflutartigen Regen im Herbst, fortgewühlt vom wütenden Rüssel des Wildschweines.
Wahrhafte Dichter müssen sich hier ganz und gar hingeben: Sie errichten Mauern aus schweren Steinen, rammen Pfähle mit dem Vorschlaghammer ein und pflanzen Bäume mit Strahlstöcken.
Also kämpfen wir mit dieser zwiegesichtigen, zugleich freundlichen und schrecklichen, furchteinflössenden Natur.
Und dann, nach so unendlich viel Schweiss, erblickten wir am Horizont, wie die Alpen erschienen, und wie sich die wogenden, provozierenden Kämme der schönen Cevennen abzeichneten.
Wieder entdeckte Quellen
Wieder aufgerichtete Mauern
Wieder eingepflanzte Bäume
Eines Tages nun, angesichts dieser zeitweiligen Gaudi, schlugen wir dem Berg einige Übereinkünfte mit dem Himmel vor.
Wir liessen den Himmel ein, in der Senke zwischen zwei Bergkämmen hindurch.
Bergsenke und Himmel – wir wussten von ihnen, dass sie mythologische, von Adonis und Venus bewohnte Landschaften waren.
Wir stellten uns den Himmel vor, eingeschmiegt in diese Bergsenke; würden wir eine erotische Landschaft erzeugen?
Zweifelsohne offenbarte sich uns hier nur urplötzlich etwas in der tiefgründigen Natur, eine Art Übernatur vielleicht, oder eher eine Subnatur?
Da erinnerten wir uns an diese «béals», die an den Felsenwänden entlang verlaufenden Bewässerungsrinnen, die das Wasser des Flusses Chassezac zu den fruchtbareren Kastanienhainen leiten. Granitblöcke, im Gleichgewicht auf der glatten Platte ruhend und auf unbegreifliche Weise wasserdicht bearbeitet, in denen dieses glasklare Wasser fliesst.
Vielleicht erinnerten wir uns an diese «lavognes», die sanften Bodensenken der trockenen Hochebenen, in denen man eine Handvoll Lehm ansammelte, um eine armselige Pfütze mitten im glühenden Sommer ein wenig vor dem Versickern zu bewahren.
– Einen Himmelsflecken auf den Berg malen –
Und als wäre es von einer anderen Natur angeleitet worden, liess sich das Wasser im Gleichgewicht auf dem Bergkamm nieder.
Seine Gestalt selber sollte zwischen den Felsen hindurch gleiten, den Abgrund meiden, als zwar natürliche Erscheinung, doch von einer anderen Naturhaftigkeit, jener, die dem Wasser oberhalb der Wolken Halt gewährt.
Himmel und Berghöhe halten sich gegenseitig hin.
Hier kommt er und umwirbt sie, streichelt sie. Dort leistet sie ihm Widerstand, gestattet ihm jedoch, ihr näher zu kommen, ja mit ihr zu verkehren.
Ein Bogen geschmeidiger Pflanzen, Huflattich, Gilbweiderich, Schwertlilie, Blutweiderich und Pfefferminze empfangen sanft ihr Liebesspiel.
Ein Strand gegenüber einem Wolkenmeer. Eine Barke, um darauf zu schweben.
Eine flache Vegetation überzieht den südlichen, mit Zistrosen bepflanzten Damm, damit den Horizonten Raum gewährt wird.
Der Damm erhebt sich nur wenige Zentimeter über der Wasseroberfläche. Die Böschung neigt sich dem Abgrund zu, um die Ferne und die geschwungenen Kämme des Horizonts näher treten zu lassen.
Die Wolken kehrten im Herbst zurück und luden den Wolkenweiher zu einer Reise in die Ferne ein.
Und so kamen die Dunstschleier des sublimierten Mittelmeeres und umschmeichelten sanft die Südflanken der Cevennen. Luden sie nicht zugleich zu den Reisen Homers ein, und könnte die Insel nicht jene der Zauberin Kirke und der natürlichen Lebensgenüsse sein?
Nun nehme man sein Bad im schwebenden, wohlwollenden Meer, seinen so langsamen Wellen, seinen so sanften Wassern.
Als der Winter kam, verstreuten wir Blütenblätter am Rande des Eises.
Und die Insel schwebt als Block aus Gneis und Quarz, über dem der grossartige Traum der Kirke gleitet.
Denn meine Asche wird sich hier mit meinen griechischen Helden wiedervereinen.anthos, Di., 2011.11.29
29. November 2011 Michel Péna