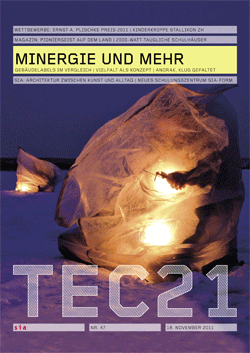Editorial
Die Situation erinnert an die Zeit vor 1875, vor der verbindlichen Einführung des metrischen Systems in der gesamten Schweiz: Parallel existierte eine Vielzahl an Messsystemen, alle verschieden, alle legitimiert. Ähnlich präsentiert sich heute die Lage bei den Gebäudelabels. Seit sich in den 1990er-Jahren das Bewusstsein für energieeffizientes Bauen verstärkt hat, prosperiert der Markt der Gütesiegel.
Hierzulande ist nachhaltiges Bauen eng mit dem Begriff Minergie verknüpft. Dies, obwohl zumindest der Basisstandard ausschliesslich auf Energieeffizienz setzt und weitere Aspekte der Nachhaltigkeit wie Mobilität oder graue Energie aussen vor lässt. Seit 1998 sind in der Schweiz rund 22 000 Bauten nach Minergie zertifiziert worden. Der Anteil am gesamtschweizerischen Gebäudepark liegt damit allerdings immer noch bei nur 1 %, bei Umbauten und Instandsetzungen sogar bei nur 1 ‰.[1]
Dieses Heft soll anhand von theoretischem Grundlagenwissen und gebauten Beispielen Klarheit in den Labeldschungel bringen. Ein Vergleich der drei wichtigsten internationalen Labels mit Minergie bringt die jeweiligen Unterschiede auf den Punkt und beweist: je umfassender das Verständnis von Nachhaltigkeit, umso komplexer das System (vgl. «Minergie und die anderen – Vergleich von vier Labels»). Dass die Anwendung verschiedener (Minergie-)Standards an einem Ort – oder der Verzicht auf einen solchen – sinnvoll sein kann, veranschaulicht dagegen ein Beispiel aus dem zürcherischen Thalwil (vgl. «Vielfalt als Konzept»). Hier wurde ein Ensemble geschaffen, das mehr darstellt als nur die Summe seiner Teile. Ein Blick über die Grenze nach Österreich zeigt, dass auch ein vermeintlich starres System wie der Passivhaus-Standard unkonventionelle Lösungen zulässt (vgl. «Anorak, klug gefaltet»).
Auch Mehrfachzertifizierungen scheinen sich zu einem Trend zu entwickeln: Vor allem global tätige Unternehmen legen neben Schweizer Gütesiegeln Wert auf ein international bekanntes Label wie das US-amerikanische LEED oder das Deutsche Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen, DGNB. Diese Standards fassen den Aspekt der Nachhaltigkeit sehr viel weiter als Minergie, auch wenn der Verein mit der Einführung von Minergie-P, -Eco und Minergie-A nachgebessert hat (vgl. «Pioniergeist auf dem Land»). Trotz der unübersichtlichen Lage besteht aber Hoffnung: Zwar existiert in der Schweiz neben den internationalen Labels eine Vielzahl an Konzepten für nachhaltiges Bauen, wie der SIA-Effizienzpfad Energie oder die 2000-Watt-Gesellschaft (vgl. «2000-Watt-taugliche Schulhäuser»). Sowohl auf Bundes- als auch auf EU-Ebene ist man aber bestrebt, die verschiedenen Standards in (jeweils) einem (eigenen) Gütesiegel zu bündeln.
Tina Cieslik
Anmerkung:
[01] CCRS, E. Meins (Hg.): Der Minergie-Boom unter der Lupe: Eine Marktanalyse der ZKB. Zürich, 2010
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Ernst A. Plischke Preis 2011 | Kinderkrippe Stallikon ZH
16 MAGAZIN
Pioniergeist auf dem Land | «Intelligentes» Tragwerk | 2000-Watt-taugliche Schulhäuser | Bücher
32 MINERGIE UND DIE ANDEREN – VERGLEICH VON VIER LABELS
Holger Wallbaum, Regina Hardziewski
In den letzten Jahren wurden weltweit Zertifizierungssysteme für nachhaltige Bauten entwickelt. Ein Vergleich dreier internationaler Labels mit Minergie.
40 VIELFALT ALS KONZEPT
Jutta Glanzmann Gut
Zwei verschiedene Minergie-Standards sowie eine Instandsetzung ohne Label: Bei der Überbauung «Güggel» in Thalwil ergeben verschiedene Standards am selben Ort Sinn.
45 ANORAK, KLUG GEFALTET
Franziska Leeb
Kein kompakter Würfel – das Passivhaus U31 in Wien reizt technische und rechtliche Vorgaben elegant aus.
52 SIA
Architektur zwischen Kunst und Alltag | Neues Schulungszentrum SIA-Form
59 MESSE
Schweizer Hausbau- und Energiemesse 2011
60 FIRMEN
64 PRODUKTE
77 IMPRESSUM
78 VERANSTALTUNGEN
Minergie und die anderen – Vergleich von vier Labels
In den letzten Jahren wurden weltweit Zertifizierungssysteme zur Beurteilung und Förderung energieeffizienter bzw. nachhaltiger Bauten entwickelt. Ein Vergleich der drei wichtigsten internationalen Labels mit Minergie zeigt deutliche Unterschiede darin, wie umfassend und mit welchen Kriterien die Nachhaltigkeit der Gebäude bewertet wird, was einen Vergleich der Ergebnisse schwierig macht. Der neue, umfassende Schweizer Standard für nachhaltiges Bauen, der derzeit erarbeitet wird, sollte daher keine weitere Neuschöpfung sein, sondern etablierte Ansätze einbinden.
Die Schweiz hat mit Minergie ein etabliertes Label für energetisch anspruchsvolle Gebäude, das eine im internationalen Vergleich sehr gute Marktdurchdringung aufweist. Die drei gängigsten Zertifizierungssysteme am internationalen Markt sind BREEAM[1], LEED[2] und DGNB[3]. Sie spielen heute in der Schweiz noch eine untergeordnete Rolle, werden aber zunehmend von Investoren gefordert, sodass auch in der Schweiz erste Gebäude nach LEED (z.B. Innovationszentrum von CPW, Orbe [Abb. 1] und Prime Tower, Zürich [vgl. TEC21 45/2011] [Abb. 2]) und DGNB (z.B. Dienstleistungsgebäude Majowa, Wankdorf) zertifiziert werden.
Die gängigsten internationalen Labels
Das 1990 in Grossbritannien eingeführte BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ist das älteste System und jenes mit der grössten Anzahl zertifizierter Gebäude – insgesamt über 200 000, davon allerdings nur 76 ausserhalb von Grossbritannien. Diese breite Anwendung in Grossbritannien wird durch staatliche Vorgaben gefördert. Wohnungsneubauten, die den grössten Anteil zertifizierter Bauten ausmachen, müssen beispielsweise nach dem Standard «BREEAM Code for Sustainable Homes» zertifiziert werden. Bewertungen in Europa werden vor allem mit der Systemvariante «BREEAM Europe Commercial» durchgeführt, die eine Berücksichtigung von europäischen und länderspezifischen Normen und Standards bei der Zertifizierung von Geschäftsliegenschaften ermöglicht.
Das amerikanische System LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) wurde vom US Green Building Council (USGBC), einer nationalen Non-Profit-Organisation Ende der 1990er-Jahre entwickelt. LEED gehört dank gutem Marketing zu den weltweit bekanntesten Zertifizierungssystemen. Die Anzahl der Zertifizierungen liegt bei insgesamt über 24 000 mit Schwerpunkt auf Wohngebäuden in den USA. Das ursprünglich für den amerikanischen Markt entwickelte System stützt sich auf die amerikanischen Normen (ASHRAE) und Standards ab. Bei Bewertungen ausserhalb der USA können seit Oktober 2011 optional für bestimmte Kriterien lokale Standards oder Normen angewandt werden, wenn diese den amerikanischen Anforderungen entsprechen.
Das DGNB (Deutsches Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen) wurde 2007 von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung am Beispiel von Bürogebäuden entwickelt. Seit der Lancierung des DGNB Anfang 2009 wurden über 200 DGNB-Zertifikate verliehen und weitere Nutzungsprofile geschaffen. Das DGNB wurde speziell für die deutsche Baubranche entwickelt und basiert daher vor allem auf den deutschen Regelwerken (DIN) und Richtlinien (VDI[4]). Eine Internationalisierung des DGNB-Systems erfolgte 2010 durch die Einführung von «DGNB International », das sich auf Normen und Vorgaben der Europäischen Union abstützt und eine weltweite Anwendung sowie Vergleichbarkeit des Gütesiegels ermöglichen soll. Eine interessante Entwicklung ist auch die Adaption des DGNB-Systems an Schweizer Bedürfnisse durch die Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft SGNI[5]. Hierbei wird das internationale DGNB-Bewertungssystem an Schweizer Normen (SIA) und Richtlinien angepasst. Die Adaption des Nutzungsprofils «Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude» ist bereits abgeschlossen. Aktuell startet die SGNI in die Pilotphase zur Zertifizierung nach dem national adaptierten System.
Das Schweizer Minergie-Label wurde durch den Verein Minergie entwickelt und 1998 auf den Markt gebracht (vgl. Kasten S. 37). Es folgten die Varianten Minergie-Eco, Minergie-P und Minergie-A, die jeweils noch mit Eco ergänzt werden können. Die Anforderungen an das Minergie- Label beruhen auf Schweizer Normen (SIA) und Vorschriften.
Entwicklung eines Schweizer Nachhaltigkeitsstandards
Immer mehr Bauherrschaften fordern ein möglichst umfassendes Nachhaltigkeitslabel, das ausser energetischen und/oder ökologischen Aspekten auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Kriterien beinhaltet. Aus diesem Grund hat das Bundesamt für Energie ein Projekt zur Entwicklung eines Standards für nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBCH) lanciert. Aufbauend auf den bestehenden Instrumenten und Labels der Schweiz (Minergie, DGNB/ SGNI, SIA 112/1, Nachhaltiges Immobilienmanagement von IPB/KBOB, sméo etc.) und mit Rücksicht auf den internationalen Kontext (LEED, DGNB, BREEAM etc.) soll ein umfassender Nachhaltigkeitsstandard für die Schweiz entwickelt werden, der den hohen Schweizer Planungs- und Baustandards Rechnung trägt und an diese angepasst ist. Das Projekt ist in die Bestrebungen zur Förderung des nachhaltigen Bauens in der Schweiz integriert, die auf ein «Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz (NNBCH)»[6] fokussieren, und könnte später vom NNBCH getragen werden (vgl. TEC21 Nr. 35/2011).Auch auf europäischer Ebene sind Arbeiten im Gang, die die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden anstreben. Das im Februar 2010 gestartete dreijährige EU-Forschungsprojekt Open House entwickelt ein einheitliches europäisches Zertifizierungssystem für nachhaltige Gebäude, basierend auf den Standards CEN/TC 350 bzw. ISO TC59/SC17, der EPBD Direktive (Energy Performance of Buildings Directive) sowie Methoden zur Bewertung von nachhaltigen Gebäuden auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene.[7]
Unterschiede zwischen den Labels: Zertifizierungsprozess
Die vier Zertifizierungssysteme BREEAM, LEED, DGNB und Minergie unterscheiden sich sowohl strukturell als auch inhaltlich. Betrachtet werden nachfolgend die auf dem Schweizer bzw. internationalen Markt gängigen Systemvarianten DGNB Büro- und Verwaltungsbauten Neubau 2009, LEED New Construction 2009, BREEAM Europe Commercial 2009 (office) und Minergie-Eco 2011.
Jedes Bewertungssystem hat unterschiedliche Anforderungen an die Durchführung des Bewertungsprozesses. Bei BREEAM und DGNB kann die Bewertung nur durch Experten erfolgen, die eine spezielle Ausbildung bei den jeweiligen Zertifizierungsorganisationen absolviert haben. LEED dagegen fordert nicht zwingend einen «LEED Accredited Professional» (AP) bei der Bewertung; die Integration eines solchen im Projektteam generiert allerdings einen Bewertungspunkt in der Kategorie Innovation. Bei der Durchführung von Minergie-Zertifizierungen können Bauherrschaften und Investoren durch sogenannte Minergie-Fachpartner unterstützt werden.
Eine Zertifizierung wird bei allen Systemen in einem zweistufigen Prozess durchgeführt und gliedert sich in eine Vorzertifizierung (freiwillig) während der Planungsphase und eine definitive Zertifizierung nach Bauabschluss. Bei BREEAM und DGNB erfolgt die Vorzertifizierung basierend auf Planungswerten und die finale Zertifizierung aufgrund der tatsächlich gemessenen Werte bzw. Ausführungen. BREEAM fordert für die finale Beweisführung in vielen Fällen ausserdem eine Gebäudebegehung durch den BREEAM-Experten sowie eine Fotodokumentation zur Kontrolle, ob die Planung auch umgesetzt wurde. LEED dagegen unterscheidet zwischen Kriterien, die nur in der Planungsphase betrachtet werden (design credits) und Kriterien, die nach bzw. während der Bauausführung bewertet werden (construction credits). Eine Vorortbegehung wird bei LEED lediglich für die Abnahme der energetisch relevanten Gebäudetechnik verlangt. Bei Minergie-Eco werden die auf den Projektierungswerten erstellten Berechnungen aktualisiert, falls es während der Bauphase Abweichungen gab. Die Umsetzung der Minergie-Eco-Anforderungen wird durch die Bauleitung anhand einer Checkliste überwacht und stichprobenartig durch die Zertifizierungsstelle geprüft.
Bewertungsstufen und Pflichtkriterien
Die Zertifizierungssysteme setzen unterschiedliche Bewertungsstufen und Auszeichnungen ein (Abb. 4). Die Resultate werden durch Prozent- oder Punkteangaben abhängig vom Gesamterfüllungsgrad dargestellt. Die unterste Stufe stellt dabei die aktuellen Mindestanforderungen an nachhaltiges Bauen auf nationaler Ebene dar. Aufgrund der unterschiedlichen Baustandards in den einzelnen Ländern ist ein Vergleich der Bewertungsergebnisse jedoch kaum möglich. Bei Minergie werden die verschiedenen Anforderungsstufen als eigenständige Produkte (Minergie-Eco, Minergie-P etc.) vermarktet. Aufgrund fehlender Zertifizierungsstufen gibt es nur das Ergebnis bestanden bzw. nicht bestanden.
LEED, BREEAM, DGNB und Minergie-Eco fordern zur Qualitätssicherung von Zertifizierungen die Einhaltung von Pflichtkriterien. Bei LEED stellt die Erfüllung dieser sogenannten «pre-requisites» eine Grundvoraussetzung für eine Zertifizierung dar. Bei BREEAM müssen abhängig von der angestrebten Bewertungsstufe bestimmte Kriterien («Minimum BREEAM standards») erreicht werden. Das DGNB setzt sogenannte «Mindestqualitäten» für die einzelnen Bewertungsstufen voraus, d.h., ein Gebäude mit z.B. einer Silberzertifizierung muss in allen Themenfeldern mindestens Bronzeniveau erreichen. Minergie-Eco definiert in seinem Kriterienkatalog sogenannte Ausschlusskriterien, die zwingend umgesetzt werdenmüssen. Dabei geht es vor allem um die Vermeidung von Materialien, die mit einer gesunden und ökologischen Bauweise nicht vereinbar sind (z.B. schwermetallhaltige Baustoffe, Biozide und Holzschutzmittel).
Abdeckung von Nachhaltigkeit und Lebenszyklus
Inhaltlich unterscheiden sich die Systeme vor allem hinsichtlich des Abdeckungsgrads der Nachhaltigkeitsanforderungen. Das DGNB verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der ökologische, ökonomische und soziokulturelle Kriterien über den gesamten Lebenszyklus umfasst. Dieser Ansatz wird auch als Bewertungsmethode der «2. Generation» bezeichnet. Im Gegensatz dazu betrachten Systeme der «1. Generation», wie LEED, BREEAM oder Minergie- Eco, hauptsächlich Energie- und Umweltaspekte.
Die Schwerpunkte der jeweiligen Systeme spiegeln sich auch in der Gewichtung der Bewertungskriterien und Kategorien wider. Bei LEED und BREEAM liegt das Hauptgewicht auf Energie (BREEAM: 19 %, LEED: 35 von 100 bzw. 110 Punkten). Das DGNB-System bewertet die einzelnen Nachhaltigkeitskategorien mit je 22.5 %. Der Anteil der Energie innerhalb der ökologischen Qualität beträgt 5.6 %. Ergänzend werden die «Technische Qualität» mit 22 % sowie die «Prozessqualität» (10 %) bewertet (Abb. 4). Die Bewertung der Standortqualität erfolgt beim DGNB separat, da vor allem die Nachhaltigkeitsqualität des Gebäudes bewertbar gemacht werden soll, und fliesst im Gegensatz zu BREEAM und LEED nicht in die Gesamtbewertung ein.
Der Lebenszyklus wird bei der Zertifizierung von Gebäuden ausser bei DGNB bis jetzt nicht oder nur teilweise berücksichtigt. Der Schwerpunkt liegt bis anhin auf der Betriebsphase, ergänzt um die Erstellungsphase. Hier zeichnet sich aber ein Wandel ab. Die neuen Systemversionen integrieren verstärkt eine Betrachtung über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. So wird bei BREEAM UK 2011 in der Kategorie «Materialien» neu das Kriterium «Life Cycle Impacts» aufgenommen; bei LEED wird das Kriterium «Life Cycle Assessment of Building Assemblies and Materials» als Pilotkriterium getestet. Auch das diesen März neu erschienene Minergie-Eco 2011 berücksichtigt durch die Berechnung der grauen Energie den umfassenden Lebenszyklusgedanken.
Berücksichtigung ökonomischer Aspekte
Eine Gegenüberstellung der Bewertungsmethoden BREEAM, DGNB, LEED und Minergie- Eco zeigt, dass alle vier Systeme ökologische und energetische Bewertungskriterien gefolgt von Behaglichkeits- und Komfortaspekten berücksichtigen (Abb. 7). Unterschiede treten vor allem bei den ökonomischen Aspekten auf, die umfassender durch das DGNB in den Kriterien «Lebenszykluskosten (LCC)» und «Wertstabilität» berücksichtigt und durch BREEAM mit nur einem Kriterium in der Kategorie Management (Man 12: Life Cycle Cost Analysis) bewertet werden. Die LCC-Berechnung bei DGNB weist gegenüber dem vereinfachten Verfahren von BREEAM einen höheren Stellenwert auf. LEED und Minergie-Eco besitzen für die ökonomische Nachhaltigkeit kein direktes Kriterium. Indirekt führt LEED aber durch die Berechnung der jährlichen Einsparung an Energiekosten gegenüber einem (simulierten) Referenzgebäude eine Teilanalyse einer Lebenszyklusbetrachtung durch.
Weitere Nachhaltigkeitsaspekte
Auch weitere Nachhaltigkeitsaspekte wie Qualität der technischen Ausführung (Brandschutz, Reinigungs- und Instandsetzungsfreundlichkeit des Baukörpers) und Funktionalität (Flächeneffizienz, Umnutzungsfähigkeit) werden momentan vor allem mit dem deutschen Gütesiegel bewertet (Abb. 7).
Umgekehrt besitzen BREEAM, LEED und Minergie-Eco Kriterien, die das DGNB nicht abdeckt. Hierbei handelt sich vor allem um ökologische und standortspezifische Aspekte wie Lichtverschmutzung, Wiederverwendung der Gebäudestruktur, Parkplatzkapazität, Schutz von Grünflächen, Biodiversität, Wasserzähler, Radonbelastung, Kompostierung oder Innovationspunkte für aussergewöhnliche Leistungen bzw. den Einsatz innovativer Technologien.
Ökobilanzierung
Eine Ökobilanzierung (LCA) berücksichtigen zwar alle vier Systeme, allerdings mit unterschiedlicher Ausprägung. Das DGNB fordert eine umfassende Ökobilanzierung des gesamten Gebäudes gemäss DIN ISO 14040 und 14044, wobei in die Bewertung Treibhauspotenzial (GWP100)[10], Ozonbildungs- und -zerstörungspotenzial (ODP), Überdüngungs- und Versauerungspotenzial sowie Primärenergiebedarf (nicht erneuerbar/erneuerbar) einfliessen (Abb. 6). Die Ökobilanzierung bildet bei DGNB mit 13.5 % einen wesentlichen Teil der ökologischen wie auch der gesamten Bewertung. LEED dagegen führt nur für das in Kühlanlagen eingesetzte Kältemittel eine Lebenszyklusbewertung durch, wobei die Bewertungsindikatoren GWP und ODP betrachtet werden. Eine Betrachtung des gesamten Gebäudes findet nicht statt. Auch BREEAM verlangt keine Ökobilanzierung des gesamten Gebäudes, aber eine Einstufung der wichtigsten strukturellen Gebäudeelemente (Aussen- /Innenwände, Fenster, Dach, Geschossdecken, Bodenbeläge) nach 13 Kriterien (Treibhauspotenzial, Eutrophierung, Versauerungspotenzial etc.). Dies geschieht auf Basis des Green Guide[11], der standardisierte Werte für diese Kriterien auflistet. Bis jetzt werden nur die im Gebäude verbauten Materialien, ohne Berücksichtigung weiterer Lebenszyklusphasen wie Nutzung oder Rückbau bewertet. Ausserdem werden bei BREEAM Landschaftsgestaltungselemente und thermische Wärmedämmung des Gebäudes mit dem Green Guide Rating untersucht. Wie LEED bewertet BREEAM das GWP und ODP der verwendeten Kühlmittel und darüber hinaus die Stickoxidemissionen (NOx) der Heizungssysteme. Neubauprojekte, die FCKW-basierende Kühlmittel einsetzen, sind bei LEED ein Ausschlusskriterium. Bei BREEAM dagegen würde damit lediglich ein Kriterium (Begrenzung Treibhauspotenzial Kältemittel Gebäudetechnik) nicht erfüllt. Das Projekt könnte somit trotz FCKW-haltiger Kühlmittel zertifiziert werden. Auch Minergie-Eco 2011 fordert neu eine auf einer Ökobilanzierung aufbauende Berechnung der Grauen Energie.
Schwer vergleichbare Anforderungen an die Energieeffizienz
Die Beurteilung der Energieeffizienz erfolgt unterschiedlich zwischen den Zertifizierungssystemen und ist daher schwer vergleichbar. Die Systeme wenden hauptsächlich nationale Standards und Richtlinien an, die auf die klimatischen, politischen und kulturellen Bedürfnisse der jeweiligen Länder ausgerichtet sind. Ein Forschungsprojekt am Lehrstuhl für Nachhaltiges Bauen an der ETH Zürich vergleicht derzeit die Stärken und Schwächen der verschiedenen Systeme (vgl. untenstehender Kasten).
Erfahrungswerte zeigen, dass beispielsweise neue Gebäude in Deutschland die Anforderungen an die Energieeffizienz nach US-Richtlinien in den meisten Fällen um mindestens 25 bis 30 % unterschreiten.[14] Auch bei LEED und Minergie zeigen sich unterschiedliche Ansätze bei der Energiebilanzierung. LEED fokussiert im Gegensatz zu Minergie auf den gesamten Energiebedarf, d.h., berücksichtigt auch den Verbrauch von Computern, Servern, Kaffeemaschinen, Lifts etc.[15]
Einschätzung und Ausblick
Mit der zunehmenden Internationalisierung der Unternehmen werden immer mehr ausländische Labels versuchen, sich auf dem Schweizer Markt zu behaupten. Nach Einschätzung von Experten wird gerade bei grossen Geschäftsliegenschaften mit global tätigen Mietern die Nachfrage nach zertifizierten Gebäuden steigen. Gleichzeitig ist ein deutlicher Trend hin zu Doppel- bzw. Mehrfachzertifizierungen zu erkennen. In der Schweiz erfolgt die Bewertung meist basierend auf dem nationalen Label Minergie und wird durch eines der marktgängigen internationalen Labels wie LEED oder DGNB ergänzt. Ein Beispiel ist der Prime Tower in Zürich mit gleich drei Gütesiegeln (LEED, Minergie, greenproperty).
Ausländische Labels können und sollten nicht vom Markt ferngehalten werden. Aber in welchem Umfang sich diese am Markt wiederfinden, kann beeinflusst werden. Für die Schweiz wäre es wünschenswert, wenn nicht weitere nationale Standards/Labels etabliert würden, die die Stakeholder eher verunsichern, als dass sie einen Beitrag zum nachhaltigen Bauen leisten. Ein Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBCH) sollte der hiesigen Planungsund Baukultur entsprechen, auf den internationalen und nationalen Labels aufbauen und die bewährten Instrumente nutzen. Angestrebt werden sollte also keine Neuschöpfung, sondern ein System, das die etablierten Ansätze einbindet und zeitgemäss weiterentwickelt.
Bei dieser Erarbeitung wäre ein Top-down-Ansatz wünschenswert, der zuerst die anzustrebenden Ziele definiert und erst in einem zweiten Schritt die dazu notwendigen Messgrössen (Indikatoren) festlegt. Vielfach ist zu beobachten, dass eher ein Bottom-up-Ansatz angewendet wird, der existierende Messgrössen neu zusammensetzt. Dies birgt die Gefahr, dass die Kommunizierbarkeit der Zielsetzung des Bewertungssystems leidet und mehrere Messgrössen das gleiche Ziel verfolgen. Mehr Messgrössen bedeuten aber nicht zwingend mehr Qualität des Systems bzw. mehr Nachhaltigkeit eines Gebäudes; im Gegenteil: Ein System wird durch Doppelspurigkeiten unnötig komplex, was den Planungs-, Bau- und Bewertungsprozess verlängert und damit auch Kosten induziert, die im Sinne des nachhaltigen Bauens sinnvoller in integrative Planungsprozesse, ganzheitliche Lösungsansätze und innovative Konzepte und Technologien investiert wären – wie das im Projekt SNBCH realisiert wird.
Ein nationaler Standard kann dazu beitragen, dass neue, exportfähige Bausysteme und Gebäudetechnologien (weiter)entwickelt werden. Ausserdem kann ein nationaler Standard ein gemeinsames Verständnis des «Nachhaltigen Bauens» fördern und somit ein zielgerichtetes und effizienteres nachhaltiges Bauen unterstützen. Die nächsten zwei bis drei Jahre bleiben also spannend – dann sollte der Markt entschieden haben, welche Standards sich durchsetzen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist aber auch noch sehr viel Grundlagenarbeit zu leisten, was die empirischen Grundlagen der einzelnen Betrachtungsparameter sowie deren Bewertungsskalen anbelangt. Auch die Wechselwirkung der Bewertungskriterien untereinander ist bis anhin nicht Gegenstand eines unabhängigen fachlichen Diskurses geworden.
Anmerkungen:
[01] www.breeam.org
[02] www.usgbc.org
[03] www.dgnb.de/
[04] Verein Deutscher Ingenieure, www.vdi.de
[05] www.sgni.ch
[06] www.bbl.admin.ch/kbob/00477/02476/index.html?lang=de
[07] www.openhouse-fp7.eu
[08] www.credit-suisse.com/ch/real_assets/de/real_estate_switzerland/products/institutionnelle_anleger/cs_ref_green_property_inst.jsp (23.9.2011)
[09] www.abs.ch/de/produkte-dienstleistungen/finanzieren/eigenheim/immobilienrating/
[10] Der Beitrag eines Stoffes zum Treibhauseffekt gemittelt über 100 Jahre
[11] www.bre.co.uk/greenguide/podpage.jsp?id=2126
[12] Schätzung Verein Minergie, November 2011
[13] Preise, Mieten und Renditen. Der Immobilienmarkt transparent gemacht, Zürcher Kantonalbank, 2004
[14] Baumann, O., Reiser, C., Schäfer, J.: Grün ist nicht gleich Grün – Einblicke in das LEED-Zertifizierungssystem. Bauphysik Vol. 31, Issue 2, April 2009
[15] Knüsel, P.: Das amerikanische Label ist strenger. Haustech Nr. 7-8, Juli/August 2010
[16] Ebert, T., Essig, N., Hauser, G.: Zertifizierungssysteme für Gebäude: Nachhaltigkeit bewerten, Internationaler Systemvergleich, Zertifizierung und Ökonomie. Institut für internationale Architektur-Dokumentation, München 2010TEC21, Fr., 2011.11.18
18. November 2011 Holger Wallbaum
Vielfalt als Konzept
Drei im Dezember 2010 fertiggestellte Neubauten und ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus, das zeitgemäss erneuert wurde, schaffen an prominenter Lage in Thalwil ZH einen Ort zum Wohnen und Arbeiten mit hoher räumlicher Qualität. Für die Bauherrschaft und die Thalwiler Architekten der Archplan AG stand die Nachhaltigkeit im Vordergrund, nicht nur die Energieeffizienz der einzelnen Gebäude. Diese überzeugen als eigenständige Objekte ebenso wie als Teile des Ganzen.
Dass mit dem Neubau von drei Mehrfamilienhäusern im Zentrum eines Ortes ein Ensemble mit ausserordentlicher städtebaulicher Qualität entsteht, ist keine Selbstverständlichkeit. Es gehört aber ebenso zu einer nachhaltigen Sichtweise wie eine energieeffiziente Gebäudestruktur (vgl. «Intelligentes Tragwerk», S. 20) oder der Einsatz ökologischer Baumaterialien. Das Areal Güggel in Thalwil liegt in Gehdistanz zum Bahnhof. Eigentümerin ist die Heer & Co AG, die bis in die 1970er-Jahre auf dem benachbarten Grundstück Seide und Rayonstoffe produzierte. Dort wurde bereits 1972 anstelle der Fabrikationsgebäude die Wohnsiedlung «Im Isisbüel» erstellt. Das Areal Güggel hat seinen Namen vom Lehenhaus «Güggel», einem Fachwerkhaus, das dort 1741 durch das Kloster Muri erstellt wurde. Das Grundstück liegt im Rank der Mühlebachstrasse, die unter den Bahngleisen hindurch zum See führt. Bereits seit 1996 bestanden Neubaupläne für das Areal, auf dem neben dem 270 Jahre alten Fachwerkhaus zwei baufällige Wohnhäuser standen. Aber erst ein auf einem Projekt der Archplan AG basierender Gestaltungsplan führte 2009 zur Baubewilligung. Das Konzept für die Bebauung der Parzelle sah vor, das Fachwerkgebäude zu erhalten und mit drei Neubauten zu ergänzen. Diese liegen entlang der Mühlebachstrasse und nehmen in Form und Höhe Bezug auf die angrenzende Bebauung. Dadurch wird der Strassenraum gefasst, und zwischen den Volumen entsteht ein städtischer Platz, den der Geometrieingenieur und Künstler Urs Beat Roth gestaltet hat.[1] Während das nördlich angrenzende Haus gegenüber dem Fachwerkhaus mit dem Giebeldach und der Lochfassade eine klassische Formensprache spricht, sind die östlich liegenden Baukörper beide als eher längliche Kuben mit Flachdach gestaltet (Abb. 1).
Der ganzheitliche Blick
Dieser formalen Unterscheidung entsprechen auch die verschiedenen Bauweisen und Energiestandards der einzelnen Häuser. Während der Neubau mit Giebeldach massiv gebaut ist und den Minergie-Standard erfüllt, sind die beiden anderen Gebäude in Mischbauweise erstellt und Minergie-P-zertifiziert. Die Unterscheidung führt bis zum Innenausbau: Der Massivbau besitzt im Gegensatz zu den Minergie-P-Bauten kleinere Wohnungen in einem einfacheren Standard, so konnten auch die Mieten tiefer gehalten werden. Das Fachwerkhaus dagegen wurde der alten Bausubstanz entsprechend sanft erneuert, ohne einen zertifizierten Energiestandard anzustreben. Während das Fachwerkhaus innen neu mit 14 cm Zelluloseflocken gedämmt wurde, verfügt der massive Neubau über eine 20 cm starke Aussendämmung. Die beiden Minergie-P-Gebäude sind in Elementbauweise errichtet, mit 40 cm integrierter Dämmung. Daraus resultiert für das Fachwerkhaus ein etwa vier Mal so grosser Verbrauch an Heizenergie (bezogen auf die gleiche Wohnfläche) wie für die beiden Minergie-P-Gebäude.
Für Architekt Felix Sponagel, der innerhalb des Architektenteams für die Erneuerung des alten Fachwerkhauses verantwortlich war, stellt sich dennoch die Frage, welches der vier Häuser einer ganzheitlichen Betrachtung von Nachhaltigkeit am nächsten kommt. Denn das Minergie-Label fokussiert auf die Energieeffizienz eines Gebäudes, Aussagen zur Höhe der grauen Energie aber fehlen. Dieser Einwand hat durchaus seine Berechtigung, zeigt sich doch, dass die typischen Werte für die graue Energie eines Gebäudes bei durchschnittlich 100 MJ–150 MJ/m2a liegen – und damit etwa auf dem Niveau der Betriebsenergie für Raumheizung und Warmwasser von energieeffizienten Neubauten.[2] Damit hat die Energie für die Herstellung der Baustoffe, die Erstellung und den späteren Rückbau eines Gebäudes sowie die Entsorgung eine ähnliche Bedeutung wie die Betriebsenergie. Mit konkreten Zahlen belegen lässt sich die Vermutung, dass das Fachwerkhaus über den gesamten Lebenszyklus betrachtet im Vergleich zu den drei Neubauten nicht schlechter abschneidet, allerdings nicht – dazu fehlen Daten zur aufgewendeten grauen Energie für die einzelnen Gebäude. Als Anhaltspunkte können aber die nebenstehenden Zahlen dienen (Abb. 3).
Platz als verbindendes Element
Für Andreas Friedrich als Vertreter der Bauherrschaft war eine nachhaltige Bauweise an diesem zentralen Ort in Thalwil eine Selbstverständlichkeit, trotz den damit verbundenen Mehrkosten. Mit Blick auf nachfolgende Generationen zu bauen, bedeutet nicht nur energieeffiziente Gebäude, sondern auch Flexibilität der Struktur und ein sorgfältiger Umgang mit dem verfügbaren Boden. Diese Haltung manifestiert sich am Platz, der die vier neuen Volumen miteinander verbindet und sofort ins Auge fällt. Urs Beat Roth hat dafür ein Muster geschaffen, das durch die mit Gras bewachsenen Fugen der trapezförmigen Kunststeinplatten in drei verschiedenen Formaten entsteht. Sie verlängern die Gebäudelinien perspektivisch und schaffen einen Ort, der kraftvoll und eigenständig ist. Die Baukörper selbst stehen so zueinander, dass zwischen ihnen gassenähnliche Räume und gefasste Durchblicke entstehen. Eine Treppe führt von der Mühlebachstrasse auf den tiefer gelegenen Platz, der die einzelnen Häuser erschliesst und der wiederum mit der angrenzenden Mühlebachstrasse verbunden ist. Die beiden Minergie-P-Gebäude – eines viergeschossig (Haus Nr. 32), eines dreigeschossig (Haus Nr. 28) –, die in Mischbauweise mit Betondecken und Fassadenelementen aus Holz erstellt wurden, verbindet eine offene Treppenkonstruktion. Sie führt auf die gemeinsam genutzte Dachterrasse des dreigeschossigen Wohnhauses und erschliesst dieses gleichzeitig. Durch das gemeinsame Treppenhaus war es möglich, nur einen Lift für beide Häuser zu bauen. Gegen aussen sind die beiden Längskuben mit bandartigen Fenster elementen gestaltet, die durch vertikal strukturierte Holzverkleidungen unterbrochen werden. Zum einen verweisen sie damit auf die darunterliegende Konstruktion, zum anderen entsteht eine Verwandtschaft mit dem bestehenden Fachwerkhaus. Das in Massivbau erstellte vierte Haus entwickelt eher auf einer formalen Ebene eine Verbindung mit dem Altbau: Beides sind Giebelhäuser. Was wiederum alle Gebäude miteinander verbindet, ist die Gebäudetechnik: In einem einzigen Technikraum im viergeschossigen Minergie-P-Bau (Haus Nr. 32) steht die Holzpelletheizung, die Alt- und Neubauten mit Wärme und Warmwasser versorgt.
Breites räumliches Spektrum
Bei den Neubauten findet die äussere Gestaltung ihre Fortsetzung im Inneren. Während die beiden Minergie-P-Häuser aufgrund der Stützenbauweise im Grundriss frei einteilbar und die Wohnungen entsprechend offen organisiert sind, orientiert sich der verputzte Massivbau an einer klassischen Wohnungstypologie mit zentralem Entrée und darum gruppierten Räumen und abgeschlossener Küche. Bei der Erneuerung des Fachwerkhauses ging es darum, das Bestehende so gut wie möglich zu erhalten und mit einer zeitgemässen Küche und Bädern zu ergänzen. Durch eine zusätzliche Erschliessungstreppe vom Erdgeschoss ins 1.Obergeschoss gelang es überdies, zwei voneinander unabhängige Wohnungen zu schaffen. Bei der Wahl neuer Materialien achteten die Architekten darauf, dass sie im Haus bereits vorhanden waren – die Küche beispielsweise ist deshalb aus heimischer Lärche. Auf diese Weise ist es gelungen, trotz dem Umbau die ursprüngliche räumliche Atmosphäre des Gebäudes zu erhalten.
Ein ähnlich sorgfältiger Umgang ist auch in der Gestaltung des Aussenraums spürbar. So blieb eine grosse Tanne auf dem Grundstück stehen und bietet heute Sichtschutz für die Wohnungen, die hier auf die stark befahrene Strasse orientiert sind. Laut dem Architekten und Projektleiter Simon Langenegger, der innerhalb des Büros für die drei Neubauten zuständig war, sind der Minergie- und Minergie-P-Standard an dieser exponierten Lage auch in Bezug auf den Schallschutz vorteilhaft: Zum einen schützt die dichte Gebäudehülle auch vor Lärm, zum anderen müssen wegen der eingebauten Komfortlüftung die Fenster an der stark befahrenen Strasse nicht zum Lüften geöffnet werden. Die vier Häuser, die trotz ihrer Verschiedenheit in Thalwil einen neuen Ort mit hoher Qualität geschaffen haben, zeigen, dass dieser Entscheid richtig war.
Anmerkungen:
[01] Zu den Arbeiten von Urs B. Roth vgl. auch TEC21, 16/2008, 26/2009, 7/2010
[02] Heinrich Gugerli et al., Merkblatt SIA 2032: Graue Energie im Fokus; 15. Schweizerisches Status- Seminar «Energie- und Umweltforschung im Bauwesen», Zürich, 2008TEC21, Fr., 2011.11.18
18. November 2011 Jutta Glanzmann