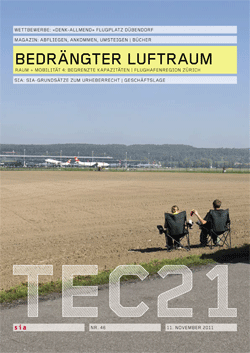Editorial
Heute gibt es viele Gründe, nicht zu fliegen. Trotzdem werden immer mehr Güter mit dem Flugzeug transportiert, und die Passagierzahlen steigen. Weltweit sehen sich daher Flughäfen gezwungen, ihre Kapazität zu erhöhen – auch der Flughafen Zürich. Die grosse wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens für den Raum Zürich und weite Teile der Schweiz ist unbestritten. Gleichzeitig steht ein Flughafen aber auch für Lärm, Schadstoffe, Ressourcenverbrauch und erhöhtes Verkehrsaufkommen am Boden. Wie lassen sich also die wirtschaftlichen Aspekte mit den Interessen der betroffenen Bevölkerung vereinbaren?
Die vorliegende Ausgabe von TEC21 ist die vierte und letzte der diesjährigen Reihe «Raum und Mobilität». Von «Wie verdichten?» (TEC21 7/2011) über «Vorstadt in Bewegung» (TEC21 21/2011) und «Sehnsucht Landschaft» (TEC21 26/2011) haben wir den Perimeter immer weiter ausgedehnt. Mit dem Luftraum erreicht der Verkehr nun die dritte Dimension. Bei Verkehrsprojekten wie Autobahnabschnitten oder Bahntrassen sind die Schnittstellen und die Anzahl der Beteiligten in der Regel noch überschaubar. Bei der Erweiterung von Flughäfen scheint die Systemgrenze erreicht zu sein: Zu viele Interessen und Bedürfnisse treffen aufeinander.
Zurzeit wird auf verschiedenen Ebenen diskutiert, wie man die Kapazität des Flughafens Zürich möglichst verträglich steigern kann. Aus Rücksicht auf die aktuellen, teilweise sehr emotional geführten Diskussionen über Pistenverlängerungen und die Richtplanbehandlung beschränken sich die Beiträge in diesem Heft auf eine unpolitische, fachlich orientierte Berichterstattung – insbesondere für all jene, die sich bisher nicht intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
Reisen mit dem Flugzeug ist heute nicht mehr aussergewöhnlich, und trotzdem hat das Fliegen nichts von seiner Faszination eingebüsst. Dennoch stellt sich die Frage, ob in absehbarer Zeit ein Umdenken stattfinden wird. Eine nachhaltige Mobilität bedeutet auch weniger Verkehr, besonders weniger belastenden Verkehr. Technische Verbesserungen, die den Energieverbrauch reduzieren, oder der Einsatz anderer Treibstoffe könnten helfen, dieses Ziel zu erreichen.
Sicher lässt sich der Flugverkehr nur bis zu einer gewissen Entfernung auf die Schiene verlagern. Aber eine solche Trendwende ist nicht absehbar aufgrund der heutigen Subventionen, die dem Flugverkehr noch einen deutlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Schienen- und Strassenverkehr verschaffen.
Daniela Dietsche
Inhalt
05 WETTBEWERBE
«Denk-Allmend» Flugplatz Dübendorf
12 MAGAZIN
Abfliegen, Ankommen, Umsteigen | Bücher
16 BEGRENZTE KAPAZITÄTEN
Bernd Scholl
Aufgrund steigender Nachfrage bauen viele Flughäfen ihre Infrastruktur aus, meist in dicht besiedeltem Gebiet. Ein zentraler Diskussionspunkt ist dabei der Fluglärm.
21 FLUGHAFENREGION ZÜRICH
Christian Schärli
In Zürich wird seit Jahren über die künftige Entwicklung des Flughafens diskutiert. Der Autor liefert umfassende Informati-onen zur Meinungsbildung betreffend Abstimmung von Siedlung und Verkehr.
27 SIA
SIA-Grundsätze zum Urheberrecht | Weiterbildung in digitalem Bauen | Geschäftslage (noch) hervorragend
31 PRODUKTE
Neues aus der Baumuster-Centrale
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Begrenzte Kapazitäten
Aufgrund der steigenden Nachfrage bauen viele Flughäfen ihre Anlagen aus. Die dichte Besiedelung im Umfeld setzt diesen Plänen jedoch Grenzen. Als besonders lästig und schädlich für die Betroffenen gilt der Fluglärm. Technische und betriebliche Möglichkeiten, um diesen zu reduzieren, sollen künftig helfen, die Gestaltungsspielräume der Flughäfen und der dicht besiedelten Gebiete in ihrem Umfeld zu verbessern.
Flughäfen mit attraktiven Flugverbindungen gehören zu den metropolitanen und national bedeutenden Infrastrukturen. Effiziente Flughäfen mit möglichst störungsfreiem Betrieb, auch und gerade in den Spitzenzeiten, sind für die Konkurrenzfähigkeit der Volkswirtschaften bedeutend und ein wichtiger Standortfaktor für die auf internationalen Austausch angewiesenen Zivilgesellschaften. Viele europäische Flughäfen befinden sich in unmittelbarer Nähe von Stadtzentren. Das ist in Bezug auf die Erreichbarkeit ein Vorteil. Die immer dichtere Besiedelung im Umfeld der Flughäfen mit den Fragen des Lärmschutzes und der Erschliessungsqualität, das prognostizierte weiter zunehmende Passagier- und Frachtaufkommen und die damit verbundenen Ausbauvorhaben der Flughäfen stellen jedoch hohe Anforderungen an die Akteure der Raumplanung und der Flughafenentwicklung.
Das ungebrochene Wachstum des Flugverkehrs
Obwohl wirtschaftliche Rückschläge und besondere Ereignisse die Entwicklung des weltweiten Flugverkehrs immer wieder beeinträchtigten, nimmt das Passagier- und Frachtaufkommen weiter zu. Die International Air Transport Association (IATA) rechnet damit, dass das weltweite Fluggastaufkommen von 2.5 Mrd. Passagieren im Jahr 2011 bis 2014 auf 3.3 Mrd. zunimmt und die Fracht von 26 auf 38 Mio. Tonnen. Ein grosser Teil dieses Zuwachses vollzieht sich in den aufstrebenden Märkten von Asien und teilweise Südamerika. Aber auch in Europa ist nach den Einbrüchen infolge der Anschläge vom 11. September 2001 und der Wirtschaftskrise 2009 an vielen Flughäfen ein jährlicher Zuwachs im Personenund Frachtverkehr, meist im einstelligen Prozentbereich, zu verzeichnen. Prognosen vieler Flughafenbetreiber weisen auch für die nähere Zukunft in diese Richtung. Trotzdem wird die Errichtung neuer Flughäfen, namentlich in den dicht besiedelten Ländern von Europa, die Ausnahme sein (z.B. München, 1992). Um die steigenden Passagierzahlen bewältigen zu können, bauen viele europäische Flughäfen die vorhandenen Anlagen aus. So wird in Berlin ein neuer Zentralflughafen am Standort des Flughafens Schönefeld errichtet, am Flughafen Schiphol in Amsterdam wird durch zusätzliche Pisten die Leistungsfähigkeit gesteigert und die Windanfälligkeit reduziert. In Frankfurt am Main wird durch die Inbetriebnahme der Nordwestlandebahn 2011 die Voraussetzung für die Abwicklung von rund 90 Mio. Passagieren geschaffen (bei gegenwärtig etwa 53 Mio.). Knapp 130 Flugzeuge pro Stunde können dann gleichzeitig starten und landen. Die Raumentwicklung muss die Konsequenzen des möglichen Wachstums in der Planung berücksichtigen, aber auch Schwellenwerte erkennen, welche die Entwicklung des jeweiligen Flughafens begrenzen, und diese frühzeitig in die Diskussion einbringen. Selbstverständlich sind Wirkungen und Konsequenzen nicht oder mit Verzögerung eintretender Prognosen zu prüfen.
Vom Airport zur Airport City
Im Zusammenspiel mit der weltweiten Zunahme des Flugverkehrs und dem Ausbau der land- und luftseitigen Verkehrsanlagen entwickelten sich viele Flughäfen von multimodalen Verkehrsknoten zu Flughafenstädten. Ziel der Flughafenunternehmungen ist es, den Passagieren während der Warte- und Transferzeiten sowie den Beschäftigten der am Flughafen ansässigen Unternehmen vielfältige Dienstleistungen und Angebote zum Einkaufen oder Erholen anzubieten. Mehr und mehr werden diese Angebote wegen der Breite der Sortimente und der besonderen Öffnungszeiten auch von der Bevölkerung der Region genutzt. Doch nicht nur innerhalb des «Flughafenzauns» spielen sich weitreichende städtebauliche Entwicklungen ab. Auch im näheren und weiteren Umfeld der Flughäfen und ihrer Verbindungsachsen zu den Zentren der Metropolregionen wird in die bauliche Entwicklung investiert. Dabei spielt die gute Erreichbarkeit eine wichtige Rolle. In Frankfurt beispielsweise werden mit der Cargocity Süd über 100 ha Gewerbeland erschlossen. Nahe den Terminalgebäuden und über den Gleisen des Fernverkehrsbahnhofes entstand in den letzten Jahren ein Komplex mit Hotel, Läden und Dienstleistungsangeboten. Ähnliche Entwicklungen lassen sich an der Südachse von Amsterdam beobachten.
Die zukünftigen städtebaulichen Entwicklungen werfen Fragen der landseitigen Verkehrsanbindung auf. Hochleistungsstrassen im Einzugsbereich grosser europäischer Flughäfen sind in den Spitzenzeiten oft überlastet. Geringfügige Störungen können zu Staus und zu zeitlich unberechenbaren Situationen führen. Die Attraktivität der Airport Cities und ihres Umfeldes könnte mittel- und langfristig zu ihrer Bürde werden. Regeln, um das Parkplatzangebot zu begrenzen, sind unumgänglich, wenn mittel- und langfristig die Verkehrsabläufe zuverlässig und berechenbar sein sollen.
Die Entwicklung der Lärmsituation
Fluglärm ist in vielen Flughafenregionen der zentrale Konfliktbereich, obwohl durch den technischen Fortschritt am Fluggerät Lärmreduktionen erreicht wurden (Abb. 3). Treiber waren die Reduktion des Kerosinverbrauchs, lenkende gesetzgeberische Massnahmen, eine Bündelung der An- und Abflüge sowie Lärmgebühren an den Flughäfen für nicht dem Stand der «Lärmtechnik» entsprechendes Fluggerät. An vielen Flughäfen wurden diese Erfolge jedoch durch eine Steigerung der Flugbewegungen kompensiert. Vereinfacht ausgedrückt wurde die Lärmreduktion nicht an die Bevölkerung weitergegeben. Dies wird erst gelingen, wenn bestimmte Obergrenzen bei der Anzahl Flugbewegungen nicht überschritten werden können. In Zürich beispielsweise wird – bei Verzicht auf Parallelpisten – wegen der topografischen Situation und der gegebenen Pistenkonfiguration die Obergrenze bei etwa 340 000 Bewegungen pro Jahr liegen. Auch in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren lassen die Einführung neuer Triebwerksgenerationen und andere Massnahmen am Fluggerät eine erhebliche Reduktion des Fluglärms erwarten. Lärmmindernde An- und Abflugverfahren tragen ebenso dazu bei wie passive Massnahmen des Lärmschutzes. Alles zusammengenommen ergeben sich verheissungsvolle Perspektiven, wenn es gelingt, die unterschiedlichen Akteure an einen Tisch zu bringen.
Zunehmende Bedeutung der informellen Verfahren
Flughafenentwicklung in dicht besiedelten Regionen fordert die Beteiligten. Besonders die Raumplanung ist aufgerufen, durch innovative Planungsprozesse und integrative Lösungen die Raum- und Flughafenentwicklung zu fördern. Zentrales Merkmal solcher Prozesse muss es sein, effektiver als bisher das gesamte Wissen für Lösungen verfügbar zu machen – von den Entwicklungen des Fluggeräts bis zu den raumplanerischen Wirkungen und Konsequenzen. Beim Lärm eröffnen sich durch den technologischen Fortschritt am Fluggerät und lärmmindernde An- und Abflugverfahren besondere Möglichkeiten. Dabei ist eine frühzeitige, grenz- und institutionenüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Flughafenregionen, Fluggesellschaften, Flughafenbetreibern, Flugzeugherstellern, Flugsicherung, Wissenschaft und Fachleuten der Raumplanung sowie der Politik eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz von Lösungen bei den vom Flugbetrieb Betroffenen.
Die Raumplanung sollte «Räume nationaler Bedeutung» ausweisen und so die Voraussetzung für die Zusammenarbeit schaffen: Kräfte werden für eine schwierige Aufgabe für eine bestimmte Zeit konzentriert und Ressourcen für das Klären und Lösen relevanter Aufgaben bereitgestellt. Solche Schwerpunkte zu bilden, ist bei stets begrenzten Ressourcen unausweichlich. Und die knappste Ressource sind nicht die finanziellen Mittel, sondern Fachleute, die sich von den Alltagsaufgaben zeitweise lösen können und bereit sind, ihre Expertise zur Verfügung zu stellen. In der Schweiz eröffnet das Bundesgesetz über die Raumplanung bereits jetzt gewisse Möglichkeiten, indem für herausgehobene und konfliktreiche Aufgaben der raumbedeutsamen Abstimmung zeitlich befristete Organisationen eingesetzt werden können. Die Kantone können im Rahmen der Richtplanung Initiativen ergreifen und Nachbarkantone und Bundesstellen zur Mitwirkung einladen.
Bei zukünftigen Verfahren sollte man auch über Kompensationsangebote für jene nachdenken, die dauerhaft besondere Lasten (beispielsweise Lärm) des Flugverkehrs übernehmen. So hat zum Beispiel der Flughafen Frankfurt in der Rhein-Main-Region einen Regionalpark materiell unterstützt. Zwischenergebnisse und Ergebnisse solcher Verfahren müssen als ver- trauensbildende Massnahmen mit den Standortgemeinden und mit der interessierten Bevölkerung diskutiert werden. Dabei gilt es, die Komplexität der Materie nicht zu verdrängen, sondern zu veranschaulichen und die Diskussion schrittweise zu versachlichen. Denn ohne Kenntnis der Zusammenhänge, des Für und Wider einzelner Massnahmen wird zuviel vermischt, und an sich erzielbare Fortschritte werden blockiert.
Die spezielle Situation in der Schweiz
Mit Ausnahme des Flughafens Bern befinden sich die Landesflughäfen der Schweiz in Grenznähe. Man könnte die Idee vertreten, dass der Bau eines neuen Zentralflughafens viele damit zusammenhängende Probleme lösen würde. Dies würde jedoch den Vorteil der kurzen Distanzen zu den wichtigen Zentren aufheben und einen neuen Kristallisationspunkt für die Zersiedlung schaffen. Aufgrund der dichten Besiedelung der Schweiz scheidet der Bau eines neuen zentralen Landesflughafens ohnehin aus. Es gilt daher, Lösungen an den vorhandenen Standorten zu finden. Für die Raumplanung der jeweiligen Kantone und die Zuständigen des Bundes wird es darum gehen, betriebliche Massnahmen in der Abwicklung des Flugverkehrs auszuschöpfen und die Pistensysteme zu optimieren, um einen sicheren, robusten und umweltverträglichen Flugverkehr zu organisieren. Im Fall des Flughafens Zürich, der seit einigen Jahren Gegenstand intensiver Verhandlungen und Auseinandersetzungen ist, sind als Stossrichtung Pistenverlängerungen und die Einführung einer Abgrenzungslinie vorgesehen («Flughafenregion Zürich», Seite 21). Die Pistenverlängerungen dienen der Optimierung des betrieblichen Ablaufes. Ziel ist es nicht, die Zahl der Flugbewegungen zu steigern, sondern einen sicheren und zuverlässigen Ablauf zu gewährleisten.
Dieser ist auch für die Drehscheibenfunktion bedeutend. Entsprechend den gesetzlichen Grundlagen muss der Flugverkehr durch das optimierte Pistensystem künftig auf die weniger dicht besiedelten Gebiete konzentriert werden. Eine Obergrenze der Kapazität für Flugbewegungen ist im Fall von Zürich durch die Topografie des Umlands und die Topologie des Pistensystems gegeben. Mit dem bestehenden und auch mit einem optimierten Pistensystem kann der Flughafen rund 325 000 bis 340 000 Flugbewegungen pro Jahr bewältigen. Ein an der Professur für Raumentwicklung der ETH Zürich durchgeführtes internes Symposium zur Flughafen- und Raumentwicklung hat ergeben, dass durch die Verminderung des Fluglärms an der Quelle und durch lärmoptimierte Ab- und Anflugverfahren, konservativ geschätzt, mit einer Reduktion von fünf bis sieben Dezibel gegenüber der heutigen Lärmkurven zu rechnen ist. Besonders geräuschärmere Triebwerke und Fluggeräte mit verbesserten aerodynamischen Merkmalen tragen dazu bei. Der Lärmeintrag in den Ein- und Abflugkorridoren wird in diesem und im nächsten Jahrzehnt stark abnehmen. Der Flughafen Zürich kann diese Verminderung nicht durch eine Zunahme der Bewegungen kompensieren, weil – wie erwähnt – die Leistungsfähigkeit auch eines optimierten Pistensystems begrenzt ist. Hier wird es darauf ankommen, diese Zusammenhänge diesseits und jenseits der Grenzen zu veranschaulichen.
Perspektiven
Die Ausbauprogramme und Entwicklungsperspektiven vieler Flughäfen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass man die land- und luftseitigen Kapazitäten nicht unbegrenzt ausbauen kann. Stärker als bisher wird es darauf ankommen, durch Zusammenwirken der Flughäfen die begrenzten Ressourcen zu nutzen. Attraktive Schienenverbindungen sind eine Voraussetzung dafür. Auch bestehen Möglichkeiten, die «inneren Reserven» der Flughäfen zu mobilisieren, um die vorhandenen Infrastrukturen besser zu nutzen. Hierzu gehört beispielsweise die Auslagerung von Kleinflugzeugen an kleinere Flugplätze im Umfeld (z.B. St. Gallen-Altenrhein oder Bern-Belp). Die frei werdenden Slots können dann mit grösseren Flugzeugen belegt werden. Denkbar ist auch, dass ein weiter optimiertes Flugcontrolling und -management die Leistungsfähigkeit einzelner Flughäfen steigert, beispielsweise indem die Abstände der Flugzeuge im Anflug vermindert werden, wobei durch die Wirbelschleppenproblematik[1] physische Grenzen gesetzt sind.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass durch weiterentwickelte Preisbildungsprogramme die Flugzeuge stärker ausgelastet wurden und die Anzahl Passagiere pro Flugzeug gestiegen ist. Diese Möglichkeiten sind vermutlich noch nicht ausgereizt. Schliesslich können Flüge durch attraktivere Schienenverkehrsverbindungen substituiert werden, deren Destinationen im zeitkritischen Bereich von unter vier Stunden Reisezeit liegen. Welche Möglichkeiten am Ende mobilisiert werden, hängt von der spezifischen Situation der Flughäfen ab. Die zentrale Herausforderung wird aber darin liegen, die Zahl der vom Fluglärm betroffenen Anwohner durch die zu erwartenden technischen und betrieblichen Verbesserungen des Flugverkehrs zu reduzieren. Damit verbessern sich auch die Gestaltungsspielräume der Flughäfen sowie der dicht besiedelten Gebiete in ihrem Umfeld, und es eröffnen sich neue Perspektiven für die Transformation und innere Entwicklung des Siedlungsbestandes.
Anmerkung:
[01] Wirbelschleppen breiten sich korkenzieherförmig hinter den Flugzeugflügeln aus und können dort über Minuten stehen bleiben. Ein kleines Flugzeug, das in einen solchen Wirbel hineingerät, kann dabei um seine Längsachse gedreht werden. Aus diesem Grund müssen beim Starten und Landen bestimmte Sicherheitsabstände (Wirbelschleppenstaffelungen) vorgesehen werden. Die mittlere Grösse der Abstände hat natürlich Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Flughafens. Durch geschicktes Flugverkehrsmanagement (das heisst, die Staffelung von Flugzeugen gleicher Grössenordnung) kann diese optimiert werden. Durch Forschungen, beispielsweise des DLR (deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), ist ein vertieftes Verständnis der Zusammenhänge, namentlich des Einflusses der Wetterlagen, und eine angepasstere Gestaltung der An- und Abflugprozeduren sowie eine Reduzierung der Abstände ohne Einbussen bei den Sicherheitsstandards möglich.TEC21, Fr., 2011.11.11
11. November 2011 Bernd Scholl
Flughafenregion Zürich
Aufgrund der steigenden Nachfrage bauen viele Flughäfen ihre Anlagen aus. Die dichte Besiedelung im Umfeld setzt diesen Plänen jedoch Grenzen. Als besonders lästig und schädlich für die Betroffenen gilt der Fluglärm. Technische und betriebliche Möglichkeiten, um diesen zu reduzieren, sollen künftig helfen, die Gestaltungsspielräume der Flughäfen und der dicht besiedelten Gebiete in ihrem Umfeld zu verbessern.
Der Luftverkehr nimmt weiter zu, und der Flughafen Zürich stösst in absehbarer Zeit an seine Kapazitätsgrenzen. Der Bundesrat sieht die Anlage als Schlüsselinfrastruktur, die im Wettbewerb mit anderen internationalen Flughäfen bestehen muss. Um die Flughafen- und die Siedlungsentwicklung in der Region aufeinander abzustimmen, wurden zahlreiche Betriebsvarianten untersucht, die Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung analysiert und die Erkenntnisse in einem Objektblatt festgehalten. Dieses ist Teil des Sachplans Infrastruktur der Luftfahrt, den der Bundesrat 2012 genehmigen soll. Der Flughafen Zürich ist der grösste und wichtigste der drei Schweizer Landesflughäfen. Er ist die Drehscheibe für direkte Luftverkehrsverbindungen nach Europa und zu den wichtigen globalen Wirtschaftszentren. Die Rahmenbedingungen für seine weitere bauliche und betriebliche Entwicklung müssen mit dem Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) definiert werden: Der SIL ist die Basis für die Genehmigung von Ausbauten an den Flughafenanlagen und des Betriebsreglements. Der Konzeptteil des SIL mit seinen allgemeingültigen Festlegungen liegt seit dem Jahr 2000 vor. Noch immer fehlt aber ein Objektblatt für den Flughafen Zürich, das die anlagespezifischen Rahmenbedingungen definiert.
Verkehrs- und Raumplanung koordinieren
Sachpläne sind das vom Raumplanungsgesetz vorgesehene Planungsinstrument des Bundes zur Erfüllung seiner raumwirksamen Aufgaben. In einem Koordinationsprozess werden sie mit den Richtplänen der Kantone abgestimmt. Für das SIL-Objektblatt Flughafen Zürich dauerte der Prozess von 2004 bis 2010. Die Federführung hatte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl), Projektpartner waren die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich und die Flughafen Zürich AG. Der Prozess diente dazu, die sach- und richtplanerischen Grundlagen auszuarbeiten und diese mit dem Bund, den betroffenen Kantonen und den wichtigsten Akteuren der Luftfahrt zu diskutieren.[1] Die Ergebnisse sind in einem Schlussbericht[2] dokumentiert. Gegenwärtig laufen die formellen Verfahren für den Erlass des Objektblatts und für die Teilrevision des kantonalen Richtplans, Kapitel «Flughafen Zürich». Beide Verfahren sollen im Jahr 2012 durch einen Bundesratsbeschluss abgeschlossen werden. Die Teilrevision des kantonalen Richtplans bedarf vorgängig der Festsetzung durch das Kantonsparlament, den Zürcher Kantonsrat. Der Grosse Rat des ebenfalls raumplanerisch betroffenen Kantons Aargau hat seinen Richtplan bereits verabschiedet.
Weiterhin eine Drehscheibe des Weltluftverkehrs bleiben
Gemäss dem Konzeptteil des SIL soll der Flughafen Zürich seine Rolle als eine der grossen europäischen Drehscheiben des Weltluftverkehrs wahrnehmen können. In seinem Bericht über die Luftfahrtpolitik der Schweiz 2004 ergänzt der Bundesrat: «Der Flughafen Zürich ist eine Schlüsselinfrastruktur und sein reibungsloses Funktionieren ist für die Schweiz deshalb von grösster Bedeutung. Er soll den Fluggesellschaften weiterhin die geeignete Infrastruktur bereitstellen, um ab Zürich möglichst gute Direktverbindungen nach Europa und in die wichtigen weltweiten Zentren zu unterhalten und damit die Bedürfnisse des Markts zu befriedigen. Erwartet wird auch die Ermöglichung eines Drehkreuzbetriebs für eine Fluggesellschaft.
Der Flughafen Zürich muss Rahmenbedingungen bieten, unter denen die Fluggesellschaften im Wettbewerb mit ihrer Konkurrenz auf anderen Flughäfen bestehen können.» Der Drehkreuzbetrieb von Netzwerk-Fluggesellschaften läuft weltweit nach einem ähnlichen Muster ab: Mit dem Drehkreuzbetrieb stellt die Netzwerkgesellschaft an ihrem Heimatflughafen – am Flughafen Zürich die Swiss – Umsteigeverbindungen zwischen interkontinentalen und europäischen Destinationen her (Abb. 1). So können die Swiss und ihre Allianzpartner Interkontinentalverbindungen anbieten, die aus der Nachfrage im Lokalmarkt nicht rentabel betrieben werden könnten. Der Drehkreuzbetrieb benötigt ausreichende Kapazitäten der Anlagen und der Betriebsabläufe, um attraktive Umsteigezeiten anbieten zu können. Wollte man die bis zum Jahr 2030 (Planungshorizont des SIL) prognostizierte Nachfrage befriedigen, wäre eine Spitzenkapazität von über 100 Flugbewegungen pro Stunde nötig. Eine derartige Leistungsfähigkeit wäre nur mit einem Parallelpistensystem zu erreichen. Ein solcher Ausbauschritt wäre technisch zwar machbar, wurde jedoch aus verschiedenen Gründen verworfen (vgl. Kasten). Die im Entwurf zum SIL-Objektblatt enthaltenen Betriebsvarianten ermöglichen maximal 70 Flugbewegungen pro Stunde. Konsequenz daraus: Die Kapazitätsgrenzen sind in absehbarer Zeit erreicht.
Pistensystem, Topografie und Siedlungsstruktur
Seine Lage im Glatttal, das in Nord-Süd-Richtung verläuft, schränkt die bauliche und betriebliche Entwicklung des Flughafens ein (Abb. 3). Die in Ost-West-Richtung liegende Hauptstartpiste 28 verläuft quer zur Talrichtung und kann aufgrund der Topografie nicht auf eine Länge ausgebaut werden, die den Start aller Flugzeugtypen in der Hauptwindrichtung ermöglichen würde. Die Starts der schweren Interkontinentalflugzeuge erfolgen tagsüber auf der Piste 16 nach Süden und abends auf den Pisten 32 und 34 nach Norden. Anflüge können aus Norden, Osten oder Süden erfolgen, aufgrund der Topografie jedoch nicht aus Westen. Ost- und Südanflüge wurden nötig, weil Deutschland Sperrzeiten zur Benützung des süddeutschen Luftraums eingeführt hat. Südanflüge führen grossräumig, Ostanflüge vor allem in der Endanflugphase über dicht besiedeltes Gebiet.
Ein Flughafen der Grösse von Zürich benötigt einen Start- und Landebetrieb auf zwei unabhängigen Pisten. Ein solcher ist nur bei Nord- oder Ostanflügen möglich. Bei Nordanflügen erfolgen die Starts hauptsächlich nach Westen, bei Ostanflügen hauptsächlich nach Norden. Bei Südanflügen verunmöglichen Pistenkreuzungen einen unabhängigen Startbetrieb, was die Kapazität einschränkt.
Die im SIL-Objektblatt vorgesehenen Varianten kombinieren die drei nach der Anflugrichtung bezeichneten Betriebskonzepte «Nord», «Ost» und «Süd» in unterschiedlicher Ausprägung. Für besondere Wettersituationen wie Bise oder Nebel existieren spezielle Betriebskonzepte (Abb. 4). Betrieblich betrachtet wäre das Nordkonzept zu bevorzugen, weil es die höchste Leistungsfähigkeit und Wetterrobustheit aufweist. Soll das Ostkonzept eine annähernd gute Leistungsfähigkeit erreichen, müsste die Piste 28 nach Westen verlängert werden, um darauf vermehrt mit Grossraumflugzeugen landen zu können. Um für alle Flugzeugtypen einen unabhängigen Startbetrieb zu ermöglichen, müsste zudem die Piste 32 nach Norden verlängert werden. Das Problem der Pistenkreuzungen des Südkonzepts lässt sich nicht ausräumen. Solange die deutschen Sperrzeiten bestehen, wird das Südkonzept vor allem in der Anflugwelle der Interkontinentalflüge am frühen Morgen eingesetzt. Der Blick auf die Siedlungsstruktur zeigt deutlich, dass es bezüglich Lärmauswirkungen unvorteilhaft ist.
Konflikte zwischen Flughafen- und Siedlungsentwicklung
Der Flughafenbetrieb ist in verschiedener Hinsicht raumwirksam. Die Flughafenanlagen beanspruchen Boden; die Sicherheitszonen zur Freihaltung der An- und Abflugwege und vor allem die Lärmbelastung schränken die Siedlungsentwicklung in der Flughafenregion ein. Überschreitungen der Planungswerte sind mit Restriktionen für die Raumplanung verbunden, Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte mit Einschränkungen für die Erteilung von Baubewilligungen. Die Projektleitung und Experten aus der Luftfahrt entwickelten deshalb im SIL-Prozess die Betriebsvarianten in enger Zusammenarbeit mit den Raumplanungsfachstellen, und das Büro Ecoplan (Bern) bewertete sie hinsichtlich Raum- und Umweltverträglichkeit in Zusammenarbeit mit Fachleuten des Bundes, des Kantons Zürich und des Flughafens.
Die lärmschutzrechtlichen Restriktionen führen zu Konflikten zwischen der Flughafen- und der Siedlungsentwicklung. Sie akzentuieren sich in den sogenannten «Stadtlandschaften » und «urbanen Wohnlandschaften», die gemäss dem Raumordnungskonzept des Kantons Zürich «dynamisch» beziehungsweise «massvoll» entwickelt werden sollten (Abb 5).3 Stoss richtungen der Teil revisio n des kantonalen Ri chtplans Die Teilrevision des kantonalen Richtplans hat zum Ziel, in der Flughafenregion trotz Fluglärm eine zweckmässige Siedlungsentwicklung zu ermöglichen. Siedlungsentwicklung ist ein langsamer Prozess, der auf verlässliche Rahmenbedingungen angewiesen ist. Wichtig ist zunächst eine langfristig beständige Definition der Gebiete, in denen die spezifischen raumplanerischen Massnahmen greifen sollen. Diese Funktion erfüllt die Abgrenzungslinie, die im SIL-Objektblatt und im kantonalen Richtplan festgelegt werden soll (Abb. 6). Ihre räumliche Definition beruht auf dem für Wohnzonen geltenden Immissionsgrenzwert der Empfindlichkeitsstufe II (IGW ES II) des geltenden Betriebsreglements sowie der vorgesehenen An- und Abflugvarianten.
Die Richtplanvorlage knüpft folgende Ziele und Massnahmen an die Abgrenzungslinie: Innerhalb der Abgrenzungslinie wird grundsätzlich kein zusätzliches Potenzial für Wohnnutzungen geschaffen. Vorbehalten bleibt die Aufzonung eingezonter und erschlossener Gebiete, bei denen der IGW ausschliesslich durch den Flugbetrieb während der ersten Nachtstunde überschritten wird. Das Ziel, die Wohnbausubstanz innerhalb der Abgrenzungslinie zu erneuern und zu verbessern, erhält eine grosse Bedeutung. Langfristig sind alle Wohnungen mit einem hochwertigen Schallschutz auszustatten: passiver Schallschutz der Gebäudehülle, einschliesslich der Fenster, und Komfortlüftung mit Zu- und Abluft sowie Wärmerückgewinnung. Der Kanton unterstützt die Gemeinden bei der Siedlungserneuerung. Ausserhalb der Abgrenzungslinie soll die Siedlungsentwicklung aufgrund einer raumplanerischen Interessenabwägung auch bei Überschreiten der Planungswerte möglich sein. Der Kanton setzt sich beim Bund dafür ein, dass die umweltrechtlichen Vorschriften so angepasst werden, dass diese Vorgaben umgesetzt werden können.
Trotz Restriktionen wird die Bevölkerung zunehmen – innerhalb der Abgrenzungslinie und im Gebiet mit Planungswertüberschreitungen. Indessen wäre eine Raumordnungspolitik, die versuchte, die Siedlungsentwicklung in der Flughafenregion einzufrieren, unverhältnismässig und kontraproduktiv. Die angestrebte Siedlungserneuerung und -verbesserung tritt nur ein, wenn Bund, Kanton und Gemeinden genügend Anreize für Investitionen schaffen und die Investitionstätigkeit in die erwünschte Richtung lenken.
Anmerkungen:
[01] An den SIL-Koordinationsgesprächen beteiligt waren neben den Projektpartnern die Kantone Aargau und Schaffhausen, Fachstellen des Uvek (Bundesamt für Umwelt und Bundesamt für Raumentwicklung) und des VBS (Generalsekretariat, Luftwaffe), die Fachstelle für Raumplanung des Kantons Zürich (Amt für Raumordnung) und Skyguide. Die Projektpartner orientierten die Kantone Thurgau, St. Gallen, Schwyz und Zug sowie die Öffentlichkeit über die Ergebnisse.
[02] Flughafen Zürich, SIL-Prozess: Schlussbericht vom 2. Februar 2010; www.bazl.admin.ch/ sil_zuerich/index.html
[03] Kanton Zürich, Baudirektion, Amt für Raumentwicklung; www.richtplan.zh.chTEC21, Fr., 2011.11.11
11. November 2011 Christian Schärli