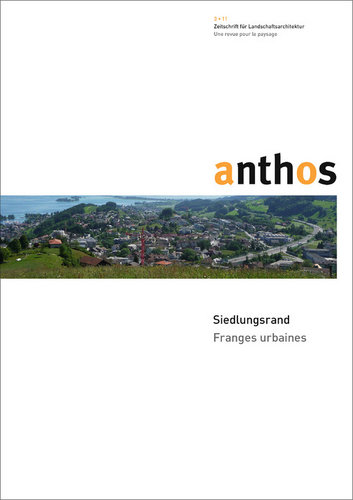Editorial
Siedlungsrand: Naht- oder Schnittstelle ?
Früher wurden die Aussätzigen vor die Ränder der Städte getrieben. Der Stadtrand wurde verteidigt, er sicherte das Innen gegen das Aussen ab, er definierte den rechtlichen Status der Gemeinde und ihrer Bevölkerung. Die Umgrenzung der Siedlung durch eine Mauer – und damit die eindeutige Kennzeichnung des Randes – war einer von vier definitorischen Faktoren einer Stadt. Die Randlage galt als wenig attraktiv, wer etwas auf sich hielt wollte ins Zentrum.
Die Mauern sind längst geschliffen, am Siedlungsrand durchdringen sich Stadt und Land. Die Randlage ist rehabilitiert, ihre Attraktivität steigt – und damit auch die Anforderungen. So faszinierend das fraktale Durcheinander manchen Siedlungsrandes ist, so deutlich zeigt es fehlende Leitbilder und klare Vorgaben für seine Ausgestaltung auf. Dabei ist für den, der von aussen kommt, der Rand das erste, was er von einer Siedlung kennenlernt. Alleine das sollte Grund genug sein, dem Rand besonders viel Aufmerksamkeit zu widmen. Er ist die visuelle Visitenkarte einer Gemeinde. Und wenn es innen immer enger wird, wie in den meisten Regionen, gewinnt der Rand weiter an Bedeutung: dann drängt das Innen weiter ins Aussen und der Rand wächst. Läuft man an den Rändern von Siedlungen entlang, lassen sich städtebauliche Entwicklungsphasen wie Jahresringe ablesen. Hier eine natürliche und historische Grenze, da ein Einfamilienhausgarten aus den 1970ern, dort ein moderner Gewerbebau. Der Rand ist aber nicht nur typologisch hoch interessant. Auf einen anderen Aspekt der Bedeutung von Rändern und Grenzen wies Kevin Lynch bereits in den 1960ern hin: Sie sind essentiell für die menschliche Orientierung, für die Wahrnehmung und Erlebbarkeit der Räume durch den Menschen.
Ist es heute aber immer so klar, wo der Rand ist? Wo ist Innen und wo Aussen? Ist es sinnvoll, klare Grenzen zu definieren und damit eines der charakteristischen Merkmale von Siedlungen – ihre Dynamik – einzuschränken? Oder ist gerade dies offenkundig notwendig – und wie könnte die planerische Umsetzung verankert werden?
Die Frage danach, ob der Siedlungsrand Naht- oder Schnittstelle ist (oder sein kann), berührt sensible Aspekte. Wie auch immer die Antwort lautet: Sie muss in einem breiten Abwägungsverfahren gewonnen werden, der Siedlungsrand ist längst bedeutender Teil der Siedlungskultur. Die differenzierte Auseinandersetzung ist überfällig.
Übrigens: Wir haben eine neue Website (www.anthos.ch) mit einer aktuellen und internationalen Agenda. Und zum runden «50-Jahre-anthos»-Geburtstag 2012 gibt es einen Zeichenwettbewerb!
Sabine Wolf