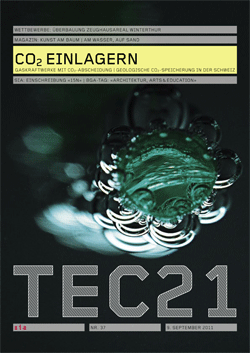Editorial
Die Eindämmung der Klimaerwärmung auf ein noch verträgliches Mass ist eine gigantische Aufgabe. Unter den Optionen zu ihrer Lösung wird seit einigen Jahren auch die CCS-Technologie (carbon capture and storage) diskutiert. Gemeint ist damit die Abscheidung von CO2 an grossen Punktquellen wie fossilen Kraftwerken oder emissionsintensiven Industriebetrieben und dessen Einlagerung in tiefen geologischen Schichten. Interesse daran bekundeten in den letzten Jahren vor allem Betreiber von Kohlekraftwerken. In der Schweiz mit ihrer auf Wasser- und Kernkraft gestützten Stromversorgung bestand bisher wenig Bedarf. Das hat sich mit der Diskussion zum Ausstieg aus der Kernenergie geändert, mit dem auch der Bau von Gaskraftwerken in den Fokus gerückt ist. CCS böte die Möglichkeit, den damit verbundenen Anstieg der CO2-Emissionen stark zu begrenzen. Allerdings bekommt man dies nicht umsonst. Die Investitionskosten für ein Gaskraftwerk mit CCS würden sich schätzungsweise verdoppeln, die Betriebskosten würden um 25 % ansteigen («Gaskraftwerke mit CO2-Abscheidung»). Da die Abscheidung von CO2 zudem sehr energieintensiv ist, müssten ca. 17 % mehr Gas verbrannt werden, um die gleiche Nennleistung zu erreichen. Bei Kohlekraftwerken geht man gar von einem bis zu 35 % höheren Kohlebedarf aus. Die unterirdische Einlagerung von CO2 wiederum weckt vor allem hinsichtlich ihrer Sicherheit Bedenken, wie der Widerstand gegen Speicherprojekte in Deutschland zeigt.
Ob die CCS-Technologie zum Einsatz kommen soll, ist daher stark umstritten. Befürworter sehen sie als Brückentechnologie, bis der Ausbau der Erzeugung erneuerbarer Energie bzw. die Steigerung der Energieeffizienz den Bedarf decken können. Kritiker befürchten, dass Letzteres genau durch das Verfolgen der CCS-Option gebremst wird, indem CCS-Pilotprojekte Fördergelder verbrauchen und als Legitimation für den Weiterbetrieb bzw. den Neubau fossiler Kraftwerke dienen. Diese Befürchtungen sind sicher teilweise berechtigt. Allerdings bleiben, selbst wenn die Schweiz oder andere Industrieländer sich gegen fossile Kraftwerke entscheiden sollten, die CO2-Emissionen aus emissionsintensiven Industriezweigen, die sich prozessbedingt zum Teil nicht reduzieren lassen. Und es bleibt der wachsende Energiebedarf aufstrebender Länder wie Indien und China, den diese zu einem grossen Teil weiterhin mit ihren grossen Kohlevorkommen decken werden. Sich die Option CCS zur Reduktion der dort anfallenden CO2-Emissionen nicht offenzuhalten, ist angesichts der Dringlichkeit, die Klimaerwärmung zu bremsen, nicht ratsam. Allerdings müssen Potenzial, Aufwand und Risiken der Technologie in Pilotprojekten genau abgeklärt und offen kommuniziert werden. Einige der von CCS-Gegnern geäusserten Bedenken hinsichtlich der CO2-Speicherung liessen sich mit sachlicher Information schon heute entkräften («Geologische Speicherung von CO2 in der Schweiz»).
Claudia Carle
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Überbauung Zeughausareal Winterthur
10 MAGAZIN
Kunst am Baum | Am Wasser, auf Sand
16 GASKRAFTWERKE MIT CO2-ABSCHEIDUNG
Johanna Schell, Mischa Werner, Nathalie Casas, Marco Mazzotti
Erläutert werden drei Methoden, die für die CO2-Abscheidung zur Verfügung stehen, deren Energiebedarf und Kosten sowie ihr Potenzial in der Schweiz.
21 GEOLOGISCHE C02-SPEICHERUNG IN DER SCHWEIZ
Mischa Werner, Dorian Marx, Daniel Sutter, Marco Mazzotti
In einer Studie wurde untersucht, ob in der Schweiz geeignete geologische Strukturen zur sicheren Lagerung von CO2 vorhanden sind. Abgeklärt werden auch mögliche Risiken und Nutzungskonflikte bei CO2-Lagern.
28 SIA
Einschreibung «15n» 2012 eröffnet | Potenzial Bogenglas | Vernehmlassung | «Architektur, Arts & Education»
31 PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Gaskraftwerke mit CO2-Abscheidung
Der politische Wille von Bundes- und Nationalrat, bis 2034 aus der Kernenergie auszusteigen, hat neben dem Ausbau regenerativer Energien und verbesserter Energieeffizienz auch den Bau von Gaskraftwerken wieder in den Fokus der Diskussion gerückt. Mit der Abscheidung der dort anfallenden CO2- Emissionen und ihrer Speicherung in tiefen geologischen Schichten (Carbon capture and storage, CCS) liesse sich der Anstieg des Treibhausgases begrenzen. Der Artikel erläutert diese Technologie, deren Energiebedarf und Kosten sowie ihr Potenzial in der Schweiz.
Die Schweiz erzeugt derzeit 57 % ihres Stromes aus Wasserkraft und 38 % aus Kernkraft.1 Daher liegen ihre CO2-Emissionen aus der Stromproduktion heute niedriger als in vielen anderen Industrienationen. Ein Ausstieg aus der Kernenergie bis zum Jahr 2034 würde die Schweiz vor die Herausforderung stellen, die Lücke zwischen dem voraussichtlich weiterhin steigenden Bedarf und der reduzierten Produktionskapazität zu schliessen. Eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien und eine Steigerung der Energieeffizienz bieten Möglichkeiten, dies ohne erhöhte Treibhausgasemissionen zu tun. Gelingt es damit nicht rechtzeitig, die Lücke zu schliessen, sind als Überbrückung fossile Kraftwerke notwendig.
Momentan sind in der Schweiz fünf Kernkraftwerke mit einer Gesamtleistung von rund 3200 MW am Netz. Die drei kleinsten und ältesten (Beznau I und II sowie Mühleberg) haben jeweils eine Leistung, die mit einem Gaskraftwerk vergleichbar ist (~ 400 MW)[1], was eine direkte Substitution ermöglichen würde. Gaskraftwerke sind insbesondere im Hinblick auf die zu ersetzende Grundlastfähigkeit der Kernkraftwerke wie auch auf die schnelle Realisierbarkeit attraktiv. Das Schweizer Gesetz schreibt jedoch eine hundertprozentige Kompensation der entstehenden CO2-Emissionen vor, davon 70 % im Inland.[2] Die Kosten dafür werden aufgrund der Auswahl an Möglichkeiten umso höher, je mehr CO2 zu kompensieren ist. Die sogenannte «carbon capture and storage»-Technologie, kurz CCS, könnte hier die Möglichkeit bieten, den Ausstoss von CO2 und somit die zu kompensierende Menge zu reduzieren. Diese Technologie besteht darin, das bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Erdgas, Erdöl oder Kohle oder auch bei industriellen Prozessen entstehende CO2 nicht einfach in die Atmosphäre abzugeben, sondern direkt am Kraftwerk bzw. am Ort der industriellen Produktion abzuscheiden und an einem geeigneten Ort sicher einzulagern (Abb. 1, vgl. auch nebenstehenden Kasten).
Die verschiedenen Teile dieses Konzepts – Abscheidung, Transport und Speicherung des CO2 – werden momentan international in verschiedenen Projekten und Forschungsprogrammen entwickelt. Diese Technologie ermöglicht einerseits den hoch entwickelten Ländern, ihren Ausstoss an CO2 zu reduzieren und eine Brücke bis zur ausschliesslichen Nutzung von regenerativen Energien zu bauen. Andererseits bietet sie aufstrebenden Ländern wie China und Indien die Chance, ihre enormen Vorräte an Kohle klimafreundlicher zu verwenden.
Methoden zur CO2-Abscheidung
Im Bezug auf die CO2-Abscheidung werden drei verschiedene Strategien diskutiert und getestet (Abb. 2):[3]
Oxyfuel-Verfahren
Die erste Möglichkeit ist die «oxyfuel combustion», die Verbrennung des fossilen Brennstoffs mit reinem Sauerstoff anstelle von Luft. Damit besteht der Abgasstrom lediglich aus CO2 und Wasserdampf, der kostengünstig auskondensiert werden kann. Allerdings erfordert die Methode eine energieaufwendige Luftzerlegung, um den Stickstoff abzutrennen und Sauerstoff zu gewinnen. Sie wird derzeit zum Beispiel am Braunkohlekraftwerk Schwarze Pumpe in Deutschland (Abb. 3) oder an der Gasaufbereitungsanlage bei Lacq in Frankreich getestet.
Abscheidung vor der Verbrennung
Eine weitere Methode nennt sich «pre-combustion capture». Dabei wird das CO2 vor der eigentlichen Verbrennung abgeschieden. Dafür wird ebenfalls zunächst durch Luftzerlegung reiner Sauerstoff gewonnen und damit anschliessend ein fester Energieträger (Kohle, aber z. B. auch Biomasse ist eine Option) durch eine Vergasungsreaktion in CO2 und Wasserstoff umgewandelt. Das CO2 wird abgeschieden, während der Wasserstoff in einer Gasturbine verbrannt und damit Elektrizität erzeugt wird. Kommerzielle Kraftwerke dieses Typs gibt es bereits, bekannt unter der Abkürzung IGCC (integrated gasification combined cycle).
Solche mit CO2-Abscheidung sind jedoch erst in der Planungs- oder Testphase (z. B. in Buggenum und Emshaven, Niederlande, oder Hatfield, UK). Während konventionelle Kessel mit gewissem Aufwand mit der Oxyfuel-Technik nachgerüstet werden können, setzt die «pre-combustion»-Methode tief greifendere Änderungen am Kraftwerksdesign voraus (namentlich an der Gasturbine). Sie kommt daher nur für neue Anlagen, nicht für Nachrüstungen infrage.
Abscheidung nach der Verbrennung
Die dritte Option, die sogenannte «post-combustion capture», ist am einfachsten realisierbar. Hier findet eine Trennung des Abgases in CO2 und mehrheitlich Stickstoff erst nach der Verbrennung statt. Dies hat den Vorteil, dass der eigentliche Kraftwerksprozess unverändert bleibt, was – vorausgesetzt, es besteht genügend Platz für die nötigen Installationen – eine unkomplizierte Nachrüstung bei bestehenden Anlagen erlaubt. Nachteilig ist der voraussichtlich höhere Energiebedarf für die Abscheidung.[4] Die eigentliche Trennung des CO2 vom Restgas erfolgt mittels Gaswäsche, das heisst durch einen Ablauf von Absorptionsund Desorptionsreaktionen in zwei säulenförmigen Reaktoren – sogenannten Kolonnen. In der ersten Kolonne rieselt ein geeignetes Waschmittel über das Abgas und nimmt dabei selektiv CO2 auf. In der zweiten Kolonne wird dieses durch Erhöhung der Temperatur wieder abgegeben. Letzteres ist derjenige Teilschritt mit dem grössten Energiekonsum. Die «post-combustion»-Methode wird bereits an verschiedenen Kraftwerken in Pilotprojekten mit einem kleinen Teilstrom des Abgases und verschiedenen Waschmitteln untersucht (z. B. in Mongstadt, Norwegen, oder Pleasant Prairie und Mountaineer, USA). Beim sogenannten «chilled ammonia»-Prozess von Alstom Power (Schweiz) AG wird beispielsweise eine Ammoniaklösung verwendet. Absorption ist eine grundlegende Methode in der Verfahrenstechnik und wird z. B. an Kohlekraftwerken bereits für die Entschwefelung und Entstickung der Abgase angewendet. Deshalb und aufgrund der in den Pilotprojekten gesammelten Erfahrungen kann das Verfahren als «pre-commercial» bezeichnet werden. Für alle drei beschriebenen Methoden sind weitere Forschung, Evaluierung und die Erprobung im Grossmassstab notwendig, wovon man sich in erster Linie eine Verbesserung der Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen verspricht. Erkannt zu haben scheint dies die EU. Das von der EU-Komission beschlossene und vom EU-Rat gutgeheissene CCS-Demonstrationsprogramm sieht vor, in Europa bis 2015 zehn bis zwölf grosse Demoprojekte zu lancieren, um CCS ab 2020 kommerziell verfügbar zu machen.[5] Bisher sind erst sechs Projekte ausgewählt und in der Planung weiter fortgeschritten, entsprechend ambitioniert scheint der Zeitplan der EU. Es werden jedoch alle gesammelten Erfahrungen auch für den möglichen Einsatz von CCS in der Schweiz verfügbar sein.
Forschung in der Schweiz
Auch Schweizer Forschungsinstitute beschäftigen sich mit dem Thema CO2-Abscheidung. So ist das Institut für Verfahrenstechnik der ETH Zürich Projektpartner bei «DECARBit», einem EU-Forschungsprojekt zur «pre-combustion»-Technologie.[6] An der Fachhochschule Nordwestschweiz und am Paul Scherrer Institut untersuchen Forschende ausserdem, wie sich Wasserstoff optimal in einer Gasturbine zu Energie umsetzen lässt. Und an der ETH Lausanne beschäftigt sich das Labor für Industrielle Energiesysteme mit modellbasierter Optimierung und Systemintegration der drei Abscheidungstechnologien in bestehende und zukünftige Kraftwerksdesigns. Diese Aktivitäten sind Teil des schweizerischen CCS-Projektes CARMA[7] (CARbon MAnagement in power generation, vgl. Kasten Seite 23).
Auswirkungen von CCS auf die CO2- und Erdgasbilanz der Schweiz
Soll konkret ein Kernkraftwerk durch ein Gaskraftwerk ersetzt werden, stellt sich die Frage, welche Auswirkungen dies auf die Schweizer CO2- und Erdgasbilanz hätte. Der Erdgasverbrauch der Schweiz lag 2009 bei nur 2800 Mio. m3 / Jahr.[8] Allerdings ist die Schweiz aufgrund ihrer zentralen Lage geopolitisch günstig am EU-Netz angeschlossen. Sie ist heute mit zwölf grenzüberschreitenden Leitungen ins internationale Erdgas-Transportnetz eingebunden. Unter anderem verläuft die Transitleitung von den Niederlanden nach Italien zwischen Wallbach (AG) und dem Griespass (Oberwallis). Weiterhin soll eine neue Pipeline, die Trans Adriatic Pipeline (TAP), Europa mit dem Erdgas vom Kaspischen Meer und aus dem Nahen Osten verbinden. Die Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg AG (Schweiz) hält daran 42.5 %.[9]
Eine Versorgungslücke ist daher hinsichtlich vorhandener Infrastruktur und geplanten Kapazitätsausbaus eher unwahrscheinlich. Für ein 400-MW-Gaskraftwerk ohne CCS mit einem Wirkungsgrad von 58 % und einer Auslastung von 87 % betragen die CO2-Emissionen ungefähr 1 Mio. t CO2 / Jahr. Dies entspräche einem Anstieg um 2.5 % der aktuellen Schweizer Emissionen (40 Mio. t CO2 / Jahr). Der gesamtschweizerische Erdgasverbrauch würde sich um 18 % erhöhen. Unter der Annahme, dass sich der Wirkungsgrad mit CCS auf 50 % reduziert, muss 17 % mehr Gas verbrannt werden, um auf die gleiche Nennleistung von 400 MW zu kommen. Das dabei anfallende CO2 erhöht sich auf 1.2 Mio. t / Jahr. Bei einer Abscheidungsrate von 90 % würden die jährlichen CO2-Emissionen allerdings nur 0.12 Mio. t / Jahr betragen, was einem Anstieg der Schweizer Gesamtemissionen von 0.3 % entspräche. Der gesamtschweizerische Erdgaskonsum würde um weitere 3 % auf 21 % erhöht.
Kosten
Die Kosten hierfür sind, vor allem die CCS-Technologie betreffend, im aktuellen Stadium noch schwer abzuschätzen. Innerhalb der CCS-Wertschöpfungskette entfallen 75–90 % der Kosten auf die energieintensive Abscheidung inklusive Verflüssigung des CO2.[10,12] Der anschliessende Transport, die unterirdische Einlagerung und die Überwachung der Speicher fallen aus rein ökonomischer Perspektive entsprechend kaum ins Gewicht. Untersuchungen lassen vermuten, dass sich die Investitionskosten für ein Gaskraftwerk mit CO2-Abscheidung ungefähr verdoppeln, während die Betriebskosten um ca. 25 % steigen.[11] Bezogen auf den Elektrizitätspreis würde das nach neuesten Abschätzungen einen gegenüber dem Fall ohne Abscheidung um 30–50 % höheren Preis bedeuten.[11,12] Je langsamer die Forschung, Entwicklung und Implementierung von CCS im umliegenden Ausland, aber auch innerhalb der Schweiz vonstattengeht, desto höher werden die Kosten für die erste Generation kommerzieller Kraftwerke ausfallen. Umgekehrt sinkt der Preis mit jeder zusätzlich umgerüsteten oder neu installierten Anlage nach denselben ökonomischen Gesetzen wie bei den erneuerbaren Energien. Würden die absehbaren zusätzlichen CO2-Emissionen durch Gaskraftwerke in der Schweiz auf andere Art und Weise im Inland kompensiert, wären sogenannte billige Massnahmen rasch ausgereizt, und der Strompreis würde stetig steigen. Insofern bietet CCS sowohl aus ökonomischer Sicht als auch aus klimapolitischen Gründen eine sinnvolle Lösung zur Überbrückung der Zeit, die wir brauchen, um unser Energiesystem vollständig auf erneuerbare Ressourcen umzurüsten.
Anmerkungen:
[01] Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2010, Bundesamt für Energie BFE, 2010
[02] 641.71 Schweizer Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz); Stand 1. 1. 2011
[03] www.zeroemissionsplatform.eu/ccs-technology/capture.html, Stand 19. 7. 2011
[04] Notz et al., CO2-Abtrennung für fossil befeuerte Kraftwerke, Chemie Ingenieur Technik (10) 82, 2010
[05] http://ec.europa.eu/energy/coal/sustainable_coal/ccs_project_network_en.htm, Stand 16. 8. 2011
[06] www.decarbit.com, Stand 16. 8. 2011
[07] www.carma.ethz.ch
[08] Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2009, Bundesamt für Energie BFE, 2009
[09] www.trans-adriatic-pipeline.com/de; Stand 19.7.2011
[10] IPCC, Special Report Carbon Dioxide Capture and Storage. Cambridge University Press. 2005
[11] Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2011, DOE/EIA-0383 (2010)
[12] ETP-ZEP, 2011. The Costs of CO2 Capture, Transport and Storage. Post-DemonstrationTEC21, Fr., 2011.09.09
09. September 2011 Johanna Schell, Mischa Werner, Nathalie Casas, Marco Mazzotti
Geologische Speicherung von CO2 in der SChweiz
Will man in der Schweiz Gaskraftwerke mit «Carbon capture and storage»- Technologie bauen, um die Treibhausgasemissionen trotz Atomausstieg zu reduzieren, braucht es entsprechende Speichermöglichkeiten für CO2 im Untergrund. In einer Studie wurde daher untersucht, ob in der Schweiz geeignete geologische Strukturen zur sicheren Lagerung vorhanden sind. Parallel dazu werden sowohl in der Schweiz als auch international mögliche Risiken oder Nutzungskonflikte bei CO2-Lagern untersucht.
Bei der «Carbon capture and storage»-Technologie (CCS) wird das bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie Erdgas, Erdöl oder Kohle produzierte Kohlendioxid (CO2) vom restlichen Abgas getrennt, bevor es in die Atmosphäre gelangt (vgl. Artikel S. 16). Das so gewonnene CO2 wird verflüssigt und kann unterirdisch in geeigneten geologischen Strukturen gelagert werden. Eine Herausforderung bildet hierbei vor allem die Menge, die bearbeitet werden muss. Ein einziges 400-MW-Gaskombikraftwerk stösst ungefähr 1 Mio. t CO2 pro Jahr aus, bei einem Kohlekraftwerk gleicher Kapazität ist es mehr als doppelt so viel.[1]
Welche geologischen Speicher gibt es?
Zur Speicherung bieten sich vor allem saline Aquifere an, also Gesteinsschichten mit mikroskopisch kleinen Poren, die mit Salzwasser gefüllt sind (Abb. 1). Um für die CO2-Speicherung infrage zu kommen, müssen sie über eine undurchlässige Deckschicht verfügen. In einer Tiefe ab 800 m ist der Umgebungsdruck des Gesteins hoch genug, damit das injizierte CO2 in flüssigem Zustand vorliegt und somit relativ wenig Volumen einnimmt. Der Injektionsdruck übersteigt denjenigen der Umgebung nur um wenige Bar, gerade so viel, dass das CO2 in den Porenraum der Gesteinsschicht eindringen kann, ohne diese zu beschädigen. Nach der Injektionsphase baut sich dieser Zusatzdruck mit der Zeit ab, indem er sich über den ganzen Aquifer verteilt. Dies funktioniert, da sich geeignete saline Aquifere im Normalfall über hunderte von Kilometern ausdehnen. Flüssiges CO2 ist leichter als Salzwasser und bewegt sich deshalb in Richtung der undurchlässigen Deckschicht, die das weitere Aufsteigen verhindert. Nebst dieser Deckschicht sorgen weitere physikalische und chemische Prozesse für die Dauerhaftigkeit der Speicherung:
1. Auf dem Weg Richtung Deckschicht bleiben winzige CO2-Tröpfchen unterhalb der engen Verbindungen einzelner Poren hängen und werden dadurch effektiv immobilisiert.
2. Sobald das eingeleitete CO2 mit dem Salzwasser in Kontakt kommt, löst es sich darin unter Bildung von Kohlensäure. Die Dichte dieser Lösung ist höher als diejenige des umliegenden, CO2-freien Salzwassers. Als Folge davon sinkt die Lösung zum Grund des salinen Aquifers, und die Gravitation sorgt nunmehr dafür, dass kein CO2 aufsteigen kann.
3. Die mineralogische Zusammensetzung der meisten infrage kommenden Speicherschichten ermöglicht ein Reagieren des kohlensäurehaltigen Salzwassers mit dem umgebenden Gestein zu Karbonaten (z. B. Kalk oder Dolomit). Die Bildung dieser Feststoffe geschieht nur sehr langsam, im Verlauf von Jahrhunderten, allerdings bleibt das CO2 in dieser Form über Jahrmillionen stabil gespeichert. Dank der Kombination der drei beschriebenen Speichermechanismen wird die Lagerung des Kohlendioxids mit der Zeit immer sicherer.
Alternativen zu salinen Aquiferen fi nden sich in Öl- und Gasfeldern, die ebenfalls über eine dichte Deckschicht verfügen, ohne die sich Öl oder Gas nicht hätten ansammeln können. Nach einiger Zeit der konventionellen Öl- oder Gasgewinnung sinkt der Druck in diesen Feldern, was zu einer verminderten Ausbeute führt. Durch gezielte Injektion von CO2 kann der Druck länger aufrechterhalten und die Ausbeute wieder erhöht werden. Dies wird als «Enhanced Oil Recovery» bzw. «Enhanced Gas Recovery» bezeichnet (Abb. 1). Auch in Kohlefl özen, die zu tief liegen, als dass sich der Abbau lohnen würde, kann CO2 gespeichert werden. Bei der Entstehung von Kohle wird auch Erdgas gebildet – im Kohlebergbau als Grubengas bekannt. Da Kohle eine poröse Struktur hat, wird dieses auf der grossen internen Oberfl äche angelagert. Die Förderung dieses Erdgases durch Bohrungen ist meist nicht besonders ergiebig, da der grösste Teil in den Poren adsorbiert bleibt. Durch die höhere Affi nität zur Kohlenoberfl äche kann injiziertes CO2 das Erdgas verdrängen, sodass es gefördert werden kann. Diese Technologie ist als «Enhanced Coal Bed Methane (ECBM) Recovery» bekannt (Abb. 1).
Internationales Potenzial von CCS
Die Internationale Energieagentur (IEA) legt in ihrem «Clean energy progress report» ein sogenanntes Blue Map Scenario vor[2], das zeigt, wie die weltweiten CO2-Emissio nen bis 2050 von heute ca. 30 Mrd. t pro Jahr auf 14 Mrd. t reduziert werden könnten (Abb. 2). Demnach hat CCS das Potenzial, bis 2050 mit bis zu 19 % zu den Emissionsreduktionen beizutragen, was ungefähr so viel ist wie der voraussichtliche Beitrag der erneuerbaren Energien bis zu diesem Zeitpunkt. Doch die Realisierung dieses Potenzials ist aufwendig und wird auch nach optimistischen Schätzungen Jahre dauern. In einigen Grossprojekten, die auf der ganzen Welt verteilt sind, wird die Machbarkeit dieser Technologie getestet. Die Pilotprojekte zur Abscheidung haben dabei grosse Fortschritte gemacht. Dies liegt unter anderem daran, dass bei vielen der dafür nötigen Technologien auf Erfahrungen aus anderen Anwendungsgebieten aufgebaut werden konnte. Daher sind jetzt grössere Demonstrationsprojekte in Planung (vgl. S. 19).
Untersuchung möglicher Risiken
Auch die unterirdische Speicherung von CO2 wird getestet. Dabei werden alle denkbaren Auswirkungen untersucht, insbesondere das Verhalten des injizierten fl üssigen CO2 in der Gesteinsformation und eventuell spürbare induzierte Seismizität. So zum Beispiel im Sleipner-Projekt in Norwegen, wo seit 1996 jährlich 1 Mio. t CO2, das bei der Reinigung des dort geförderten Erdgases anfällt, in einem Aquifer unter dem Meeresboden gespeichert wird. Dabei werden die Ausbreitung des Kohlendioxids sowie jegliche Erdbewegungen beobachtet. Bis heute wurden dort wie auch in allen anderen existierenden Speicherprojekten weder abnormale seismische Aktivität noch Anzeichen für ein Entweichen des eingelagerten CO2 durch die Deckschicht registriert. Spontane CO2-Ausbrüche oder -Explosionen, wie sie in CCS-kritischen Dokumenten beschrieben werden, sind geophysikalisch nicht möglich und ohne natürliche Vorbilder. Weder in Gegenden mit Erdgas- oder Ölvorkommen noch in solchen mit natürlichen CO2-Lagern sind solche Szenarien je dokumentiert oder rekonstruiert worden. Möglich hingegen ist ein langsames Emporsickern von CO2 entlang eines ungenügend verschlossenen Bohrlochs oder einer unerkannten geologischen Verwerfung. Eine akute Gefährdung an der Oberfläche ist aufgrund der Langsamkeit dieses Vorganges und der raschen Verdünnung an der Luft eher unwahrscheinlich. Das Problem dabei wäre jedoch, dass das teuer abgeschiedene CO2 doch noch in die Atmosphäre gelangen und zum Klimaproblem beitragen würde. Dies gilt es zu verhindern durch die sorgfältige Auswahl und Untersuchung der Tauglichkeit der Speicher- und Deckschicht und durch ein rigoroses Risikomanagement, das die Überwachung der Injektion und die langfristige Beobachtung des CO2 im Untergrund vorsieht sowie für alle Fälle die richtigen Gegenmassnahmen bereithält (z. B. das Wiederhochpumpen und Einspeichern an einem anderen Ort oder das Abdichten einer defekten Bohrlochfüllung).
Offene Kommunikation erforderlich
Obwohl man von Offshoreprojekten wie in Sleipner viel lernen kann, müssen bei einer eventuellen Injektion an Land noch andere Aspekte betrachtet werden. Ein erfolgreiches Forschungsprojekt, das einem möglichen Schweizer Pilotprojekt am nächsten käme, läuft in Ketzin in Brandenburg (D). Hier wird seit 2008 CO2 in einer Tiefe von 650 m in einem Aquifer gespeichert.[3] An derselben Stelle, allerdings in einer höher liegenden Formation, wurde bis 2004 Erdgas saisonal gespeichert, sodass die geologische Beschaffenheit des Gesteins bereits zu einem gewissen Grad bekannt und eine industrielle Infrastruktur vorhanden waren. Ausserdem war die lokale Bevölkerung bereits an Gasspeicherung gewöhnt. Dies hatte einen entscheidenden Einfl uss auf eines der wichtigsten Hindernisse der meisten CCS-Projekte an Land: die öffentliche Wahrnehmung. Wie bei vielen industriellen Projekten stösst man bei der lokalen Bevölkerung oft auf die Einstellung, dass eine neue Technologie zwar grundsätzlich befürwortet, aber nicht in der näheren Umgebung gewünscht wird. Daher ist es wichtig, das Vorhaben offen und klar zu kommunizieren.
In Ketzin hat es insgesamt vier Jahre gedauert, bis alle nötigen Bewilligungen eingeholt waren, die nötigen Bauten errichtet werden und die Einspeisung beginnen konnten. Mittlerweile wurden über 50 000 t injiziert, in den letzten Monaten auch CO2 vom nahe gelegenen Oxyfuel- Kohlekraftwerk Schwarze Pumpe. Da es sich um ein Forschungsprojekt handelt, ist die Injektion auf 100 000 t begrenzt, und der Schwerpunkt liegt auf der CO2-Überwachung im Untergrund. Drei Beobachtungsbohrungen wurden durchgeführt, um die Ausbreitung des CO2 zu verfolgen.
CCS in der Schweiz
Um zu untersuchen, ob CCS-Technologien auch in der Schweiz angewendet werden könnten, wurde 2009 das Forschungsprojekt CARMA (CARbon MAnagement in power generation) gestartet (vgl. Kasten S. 23).[4] Es beschäftigt sich mit den ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen, die die Speicherung von CO2 hierzulande verursachen könnte.
Im August 2010 wurde zusammen mit dem Bundesamt für Energie (BFE) eine innerhalb des CARMA-Projekts erarbeitete Studie veröffentlicht, in der das Potenzial für die CO2-Speicherung in der Schweiz rein aus geologischer Sicht abgeschätzt wurde. Hierzu wurde ein Evaluationsverfahren, das in Kanada zu diesem Zweck entwickelt wurde, an die lokalen Gegebenheiten angepasst. Die Ergebnisse dieser Studie sind in Abb. 3 zusammengefasst.[5] Die Alpen sowie die grossen Täler der Südschweiz erwiesen sich für die Speicherung als ungeeignet. Im Mittelland hingegen wurden Gesteinsformationen identifiziert, die eine gewisse Kapazität versprechen. Diese Sandstein- und Kalkformationen stellen saline Aquifere dar, die im geeigneten Tiefenbereich zwischen 800 und 2500 m unter der Oberfläche liegen. Die Autoren der Studie berechneten eine theoretische Speicherkapazität von total 2600 Mio. t CO2. Zum Vergleich: Die CO2-Emissionen der Schweiz lagen 2009 bei rund 40 Mio. t, wovon jedoch nur ein geringer Anteil mittels oben beschriebener Technik abscheidbar ist.[6] Sollte eines der kleineren Schweizer Kernkraftwerke wie z. B. Mühleberg durch ein Gaskombikraftwerk ersetzt werden, würde dieses jährlich ungefähr 1 Mio. t CO2 produzieren. Folglich sind die Resultate der Studie im Hinblick auf die Machbarkeit von CCS in der Schweiz ermutigend. Da hierbei allerdings nur die geologische Beschaffenheit berücksichtigt wurde, müssen zur Bestimmung der tatsächlichen Kapazität noch weitere Punkte untersucht und berücksichtigt werden. So kann es im dicht besiedelten Mittelland zu Konflikten bei der Landnutzung kommen. An der Oberfläche kann das vor allem durch Städte, Naturerlebnispärke und Naturschutzgebiete der Fall sein. Da die Speicherformationen selbst salzhaltig sind und sehr tief liegen, sind unterirdische Konflikte in der Schweiz, zum Beispiel mit der Trinkwassernutzung oder dem Tunnelbau ausgeschlossen. Auch die Nutzung des Untergrundes für Tiefen-Geothermie wird durch CCS nicht konkurrenziert, da für beide Nutzungen jeweils andere geologischen Voraussetzugen gegeben sein müssen (vgl. nebenstehenden Kasten). Ein mögliches Speicherprojekt in der Schweiz muss also zunächst auf einer makroskopischen Skala eine geeignete Region finden, die für die Speicherung infrage kommt. Parallel dazu müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen für CO2-Speicherung in der Schweiz geschaffen werden. Dazu sollte zuallererst die Öffentlichkeit informiert und in die Debatte einbezogen werden. Bei der genaueren Bestimmung der Injektionsstätte werden dann neben der geologischen Beschaffenheit unzählige lokale Voraussetzungen beachtet, wie z. B. die Infrastruktur an der Oberfläche und die Anbindungsmöglichkeit an grosse CO2-Quellen. Wenn ein geeigneter Ort gefunden ist, sollte zunächst ein Pilotprojekt ähnlich dem in Ketzin durchgeführt werden, bevor eine Speicherung in industriellem Massstab realisiert wird. Man muss also davon ausgehen, dass es bis zur Anwendung von CCS in der Schweiz noch mindestens zehn Jahre dauern würde. Dies verdeutlicht die Dringlichkeit, ein Pilotprojekt so rasch wie möglich anzugehen, wenn man sich die Option von Gaskraftwerken mit CCS offenhalten will. Andernfalls fehlt es uns zum Zeitpunkt der zu erwartenden Stromversorgungslücke nicht nur an Energie, sondern auch am nötigen Know-how.
CCS und Tiefengeothermie
Die Nutzung des tiefen Untergrundes als CO2- Speicher steht nicht in Konkurrenz zur Produktion geothermaler Energie. Während für Letzteres ein möglichst hoher geothermischer Gradient, eine hohe Fliessgeschwindigkeit des Formationswassers sowie offene Verwerfungen, die heisses Wasser in höhere Schichten strömen lassen, erforderlich sind, will man solche Bedingungen bei der Suche nach einem CO2-Speicher möglichst vermeiden. Aber beide Technologien – CO2-Speicherung und tiefe Geothermie – können voneinander profitieren, indem man die Forschung und die Entwicklung in beiden Bereichen koordiniert. Tiefe Bohrungen sind sehr teuer, liefern aber Daten über die vorhandene Geologie, die für beide Vorhaben von Nutzen sein können. Findet man geologische Strukturen, die sich nicht für die Heisswasserförderung eignen, könnte mit demselben Bohrloch ein guter saliner Aquifer erschlossen worden sein, und umgekehrt. In der Schweiz wurde diese Synergie erkannt und soll in Zukunft genutzt werden. Momentan ist die Einreichung des Vorschlags für einen neuen Nationalen Forschungsschwerpunkt mit dem Titel «Geoenergie» beim Schweizerischen Nationalfonds in Vorbereitung, der beide Möglichkeiten der Nutzung des tiefen Untergrundes unter ein Dach bringen möchte.
Anmerkungen:
[01] IPCC, Special Report Carbon Dioxide Capture and Storage. Cambridge University Press. 2005
[02] IEA, Clean Energy Progress Report. OECD/IEA, Paris 2011
[03] www.co2ketzin.de, Stand 11. 8. 2011
[04] www.carma.ethz.ch
[05] Diamond L. W., Leu W., and Chevalier G., «Potential for geological sequestration of CO2 in Switzerland», Studie zur Abschätzung des Potenzials für CO2-Sequestrierung in der Schweiz. Im Auftrag des Bundesamtes für Energie, BFE. Schlussbericht, 31. August 2010
[06] Emissionen nach CO2-Gesetz und Kioto-Protokoll, Bundesamt für Umwelt Bafu, 2010TEC21, Fr., 2011.09.09
09. September 2011 Mischa Werner, Daniel Sutter, Marco Mazzotti