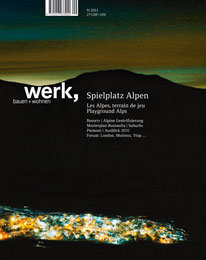Editorial
«Wenn Bauern spielen, spielen sie Streiche.» So schreibt der britische Romancier, Soziologe und Kunstkritiker John Berger, der seit den Siebzigerjahren in einem kleinen Bauerndorf in den savoyischen Alpen lebt. Er erzählt von Mistkarren, die während der Sonntagsmesse listig vor dem Kirchenportal platziert werden, und anderen nachbarschaftlichen Sticheleien. Die Lust am Streiche spielen ist den Einwohnern seiner alpinen Wahlheimat in den letzten Jahrzehnten jedoch zunehmend vergangen. Die landwirtschaftliche Ökonomie vermag in der globalisierten Welt immer weniger zu bestehen, der Alpenraum wird mehr und mehr fremdbestimmt: als Freizeitpark und Spielplatz für Städter, als Kompensationsgebiet für das Schweizer Mittelland, die Poebene, den Grossraum München oder das Rhonedelta. Dank künstlicher Beschneiung lässt sich auch in schneearmen Wintern Ski fahren; Klettersteige und Rodelbahnen sorgen dafür, dass das Sommergeschäft dem Winterplausch nicht nachsteht, Wellnessangebote erscheinen in der naturnahen Alpenwelt besonders wohltuend. Auch die Kultur hat das Anziehungspotenzial der Berge entdeckt: Vom Frühling bis in den Herbst hinein schallt und hallt es zwischen Felswänden, vom «SnowpenAir Kleine Scheidegg» bis zum «Open Air Lumnezia». Mitunter drohen die Event- und Funspektakel überhandzunehmen – und in all dem Trubel scheint es, dass diejenigen, die in und mit den Alpen leben, immer öfter den Kürzeren ziehen. «Zum ersten Mal überhaupt ist es möglich, dass eine Klasse von Überlebenden vielleicht nicht überlebt», schreibt John Berger über die savoyischen Alpengemeinden. «Bald könnten die ländlichen Gebiete der Welt auf die Städte angewiesen sein, sogar hinsichtlich der Nahrungsmittel, die die eigene Landbevölkerung braucht.»
Sein Buch trägt den Titel «SauErde» – nicht als Anklage, sondern in analytisch scharfer Anteilnahme. Wie von dieser Erde andere zu profitieren vermögen, und mit welchen Strategien die modernen Alpenbewohner den wachsenden Anforderungen der peripheren Metropolregionen begegnen, davon erzählt dieses Heft. Neben spezifisch wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten spielen im Hinblick auf wünschbare Lösungen der komplexen Problematik die Planung und der Städtebau, der Umgang mit dem tradierten Baubestand und der höchste Anspruch an neue Infrastrukturen und Architektur eine Schlüsselrolle.
Der Gemeindepräsident von Zermatt erörtert im Interview den hausgemachten Druck auf den Immobilienmarkt der Top-Tourismusdestination. Der Soziologe Maurizio Dematteis besucht vier Gemeinden in den Cottischen Alpen und zeigt, wie die Wiederbelebung der Alpentäler mit Hilfe von aussen vonstatten geht. Ein einleitender Essay des Alpenforschers Werner Bätzing wagt eine Prognose für die Zukunft des Herzens Europas, Architekt Marco Bakker zeigt an der Geschichte alpiner Resorts, wie Urbanisierung in der Höhe gelang, und Geograf Manfred Perlik macht auf das Problem der Periurbanisierungstendenzen in den Alpen aufmerksam – als Folge eines wirtschaftlichen Wandels, dessen längerfristige Auswirkungen noch nicht absehbar sind.