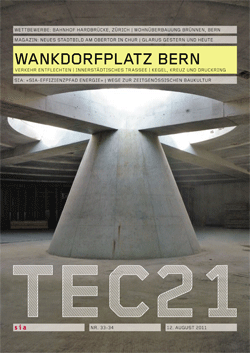Editorial
Zwölf Richtungen müssen bedient werden, wenn sich zwei Strassen kreuzen. Schon lange beschäftigen sich Planende damit, wie der Verkehr an solchen Knotenpunkten möglichst flüssig zirkulieren kann, immer auch mit Blick auf die zunehmende Verkehrsmenge oder die höher werdenden Geschwindigkeiten. Zum Sinnbild für das Autobahnkreuz wurde das Kleeblatt[1]. Doch das markante Gebilde braucht viel Platz und ist im urbanen Umfeld nicht geeignet. Für den Wankdorfplatz in Bern, eine innerstädtische Kreuzung und Herzstück des kantonalen Entwicklungsschwerpunktes Wankdorf im Norden der Stadt, haben die Planenden deshalb einen Verkehrsknoten der besonderen Art erdacht: Nach dem Umbau des Platzes, der im Sommer 2009 begann, wird der Verkehr auf zwei Ebenen geführt.
Ebenerdig, auf einer ampelgesteuerten Kreuzung, fahren der Geradeausverkehr, der öffentliche Verkehr und der Langsamverkehr. Vier Rampen führen den motorisierten Individualverkehr, der abbiegen möchte, in einen unterirdischen Kreise.
Auf diese Weise verbessert sich die Situation für Velofahrende, Fussgänger und Fussgängerinnen, zudem wird der öffentliche Verkehr bevorzugt behandelt, und eine Tramlinie kann ver-längert werden.
Das Projekt für das zweistöckige Betonbauwerk ging aus einem Ideenwettbewerb hervor, und nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist es jetzt im Rohbau fertig. Bis Sommer 2012 werden die Arbeiten an den Rampen beendet, das Kreiselbauwerk betriebsbereit gemacht und die Zubringerstrassen angepasst.
Eine weitere Herausforderung wird es sein, den Verkehrsknoten in das Verkehrsmanagement der Stadt Bern und der Autobahn einzubinden und im Dezember nächsten Jahres störungsfrei in Betrieb zu nehmen. Der Wankdorfplatz ist nach Frauenfeld TG erst der zweite unterirdische Kreisel der Schweiz und der erste, der sowohl ober- als auch unterirdisch befahren wird. Ob sich der neue Verkehrsknoten, der eine ampelgesteuerte Kreuzung mit einem Kreisverkehrsplatz verbindet, bewährt, wird sich zeigen. Ausserdem darf man gespannt sein, ob diese Konstruktionsform Schule machen und eine ähnlich starke emblematische Wirkung erreichen wird wie seinerzeit das Kleeblatt.
Daniela Dietsche, Clementine van Rooden
Anmerkung:
[01] Zumindest in Europa wird die Idee dieser verkehrstechnischen Lösung dem Schlosserlehrling Willy Sarbach aus Basel zugeschrieben: Er stellte 1927 im Rahmen eines Wettbewerbs des Vereins zur Vorbereitung der Autostrasse Hamburg–Frankfurt–Basel das vierblättrige Kleeblatt vor. Inzwischen weiss man allerdings, dass der Bauingenieur Arthur Hale aus Maryland bereits am 29. Februar 1916 die Kleeblattkreuzung zum Patent angemeldet hatte (Risk Management, die Zeitschrift von National Suisse, Sommer 2010)
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Ausbau Bahnhof Hardbrücke, Zürich | Wohnüberbauung Brünnen, Bern
12 PERSÖNLICH
Jürg Conzett: «Es geht auch um subjektive Werte»
14 MAGAZIN
Neues Stadtbild am Obertor in Chur | Glarus gestern und heute | Ämter und Ehren | Stadtraum fotografiert
22 VERKEHR ENTFLECHTEN
Franz Bamert, Alain Kutter
Zurzeit wird die Idee eines unterirdischen Kreisels zur Entflechtung des dichten Verkehrs auf dem Berner Wankdorfplatz in die Tat umgesetzt.
29 INNERSTÄDTISCHES TRASSEE
Christian Teuscher, Stefan Zingg
Als Grundlage für die Fachplanenden wurde das Trassee durch den innerstädtischen Raum vorab mit digitalen Hilfsmitteln modelliert.
32 KEGEL, KREUZ UND DRUCKRING
Mirko Feller
Eingeschränkt durch ein Korsett aus technischen und ästhetischen Randbedingungen, entwickelten die Bauingenieure für den Wankdorfkreisel ein durchdachtes Baugruben- und Tragwerkskonzept.
38 SIA
«SIA-Effizienzpfad Energie» | Zusatzversicherungen: Kollektivvertrag | Wege zur zeitgenössischen Baukultur | Agglomeration als Chance | Korrigenda zu SIA-Normen | Führung von Projektteams | Wohnumfeld als Mehrwert
45 MESSE
Energieeffizienz als Hauptthema an der Hausbau- und Energiemesse 2011
47 FIRMEN
48 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Verkehr entflechten
Der Wankdorfplatz in Bern wird schon bald den verkehrlichen Anforderungen nicht mehr genügen, da sich das umliegende Stadtgebiet rasant entwickelt. In einem Wettbewerb setzte sich 2001 die Idee der Planergemeinschaft BE3 für einen unterirdischen Kreisel durch. Im August 2009 begannen die Arbeiten zur Umgestaltung des Platzes. Während der Bauzeit muss der Verkehr möglichst störungsfrei fliessen, ab 2012 soll er auf zwei Ebenen über den Wankdorfplatz geführt werden.
Der Entwicklungsschwerpunkt Wankdorf im Norden der Stadt Bern ist einer der dynamischsten Wirtschaftsstandorte im Kanton. Im Raum Wankdorf arbeiten heute ca. 20 000 Menschen, bis 2020 sollen weitere 10 000 bis 15 000 Arbeitsplätze hinzukommen. Die bestehende Infrastruktur wird der steigenden Nachfrage nicht mehr gewachsen sein. Der Wankdorfplatz wird in Zukunft also mehr Verkehr bewältigen müssen, gleichzeitig soll er auch als Identifikationspunkt für das Gebiet dienen. Beide Zielsetzungen sind grosse Herausforderungen für Verkehrsplanung und Städtebau. Die Zusammenarbeit dieser beiden Fachgebiete wurde deshalb schon im Programm zu einem Ideenwettbewerb 2001 gefordert. Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern von Stadt und Kanton und eine international besetzte Fachjury wählte aus 23 eingereichten Vorschlägen vier verschiedene Projektansätze aus.
Diese wurden im Rahmen eines begleiteten Studienauftrags vertieft. Es zeigte sich, dass nur der Lösungsansatz der Planergemeinschaft BE3, bestehend aus Verkehrs- und Städteplanern Emch Berger Ingenieure, 3B Architekten und Schweingruber Zulauf Landschaftsarchitekten, den Anforderungen von öffentlichem Verkehr, Langsam- und Autoverkehr genügte: Der Verkehr sollte auf zwei Ebenen abgewickelt werden.
Der Wankdorfplatz erhält ein neues Gesicht
Auf Stadtniveau werden künftig Fussgänger, Velofahrende, der öffentliche Verkehr und der Geradeausverkehr geführt. Die Abbiegebeziehungen des motorisierten Individualverkehrs sind im zweispurigen Kreisel 7 m unter der Erdoberfläche organisiert. Dadurch entstehen auf dem Wankdorfplatz die notwendigen Freiräume für den öffentlichen und den Langsamverkehr, sodass der Platz auf eine Strassenkreuzung mit innerstädtischen Abmessungen redimensioniert werden kann. Die Baumreihen der Papiermühleallee, die historisch keinen Unterbruch hatten, werden ergänzt, über den Platz hinweggeführt und somit wieder erlebbar. Auf der Stadtebene dominiert der quadratische Platz. In den Ecken wird er begrenzt durch mächtige Pylone, an denen ein Seiltragwerk aufgehängt ist, das ihn überspannt. Daran ist die indirekte Beleuchtung befestigt. Die Tramfahrleitungen, die ebenfalls über den Platz führen, werden allerdings auf einer eigenen Ebene montiert, da sie vertikale Bewegungen zulassen, die bei der Beleuchtung nicht gewünscht sind. Die Rampen und Lichteinfallöffnungen für den Kreisel sind als ausgeschnittene Formstücke in der Ebene wahrnehmbar. Drei Brüstungen je Seite begrenzen den Platz und schützen die Übergänge für die Fussgänger.
Zwischen den Alleebäumen senkt sich die Rampe ins Erdreich. Der Verkehrsraum unter dem Platz besteht aus einem Kreisel mit einem Durchmesser von 40 m. Die raue Struktur der Wände der Ein- und Ausfahrten soll an ausgehobenes Erdreich erinnern; sie wird mittels Matrizen mit Felsstruktur hergestellt, die in die Schalung eingelegt werden. Der darüberliegende Lampenschlitz beleuchtet die Wände blau. Im Zentrum steht ein schalungsglatter und weiss gestrichener Kegel aus Stahlbeton, der einen grossen Teil der Last aus der Konstruktion trägt (vgl. «Kegel, Kreuz und Druckring», S. 32). Er wird durch Aussparungen in der Decke natürlich beleuchtet. Die Grundhelligkeit im Kreisel stellt eine künstliche Beleuchtung sicher.
Der Verkehr fliesst weiter
Der Wankdorfplatz ist Teil eines grösseren Verkehrssystems. Zum Projekt gehören neben der Neugestaltung des Platzes mit dem unterirdischen Kreisel auch die Verlängerung der Tramlinie 9 vom Guisanplatz zur S-Bahn-Station Wankdorf sowie Brückenbauwerke in der Papiermühlestrasse Nord. Nachbarprojekte, die unter der Federführung des Astra gleichzeitig ausgeführt werden, sind der Umbau des Autobahnanschlusses Bern Wankdorf und die Gesamterneuerung der Stadttangente Bern.
Auf dem gesamten System soll während der Bauzeit der Verkehr weiter fliessen. Besonders die tägliche Verkehrsbelastung von über 65 000 Fahrzeugen auf dem Wankdorfplatz war eine herausfordernde Ausgangslage für die Planung und Abstimmung der Verkehrs- und Bauphasen. Zudem finden während des Baus diverse Grossanlässe mit Auswirkungen auf den Verkehr im Raum Wankdorfplatz statt, die es in die verkehrsplanerischen Überlegungen einzubeziehen galt. Die Verantwortlichen mussten die Verkehrs- und Bauphasen so planen, dass keine Umleitungsrouten durch Wohnquartiere entstehen und der anfallende Verkehr direkt vor Ort verarbeitet werden kann. Weiter forderte der Kanton Bern, die provisorischen Verkehrssituationen auf Kontinuität auszurichten – dies vor allem, um die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen. Wichtig war zudem, dass das Nordquartier direkt an das Basisverkehrsnetz angebunden ist und dass die Erschliessung der direkten Anstösser aufrechterhalten bleibt. Selbstverständlich sollen auch die Busse möglichst störungsfrei verkehren sowie Fussgänger und Velofahrende ihre Verbindungen sicher nutzen können.
In einem iterativen Prozess entwickelten die Fachplanenden aus den Bereichen Kunstbauten, Verkehrsplanung, Tiefbau und Gleisbau erste Skizzen von Verkehrs- und Bauphasen, die die Verkehrsplanenden anschliessend konkretisierten. Sie definierten vier Hauptverkehrsphasen (vgl. Kasten nebenan) mit drei Kernelementen der Verkehrsführung: die grossräumige Umleitung von Teilverkehren aus Richtung Bolligen und Ittigen sowie Worblaufen und Zollikofen in Richtung westliche Innenstadt auf den neuen Autobahnanschluss Neufeld; die lokale Umfahrung über die Wölflistrasse für den Ziel- und Durchgangsverkehr aus Richtung Nord; die Umfahrung der Baustelle und des Installationsplatzes im Kreisverkehr (Abb. 13).
Das Kernstück des Betriebskonzeptes für den Endzustand und die Bauphasen ist das Strassenviereck rund um die Grosse Allmend, in welchem die lokale Umfahrung und die Kernumfahrung aufgenommen werden. Hier muss der Verkehrsfluss jederzeit gewährleistet sein, denn wenn dieser im genannten Viereck gegeben ist, wird kein unerwünschter Ausweichverkehr in die Wohnquartiere entstehen (Abb. 1). Erreicht wird dies durch eine klare Strategie bezüglich der Zuflüsse beziehungsweise der Grünzeiten bei den Lichtsignalanlagen: Es soll nur so viel Verkehr in dieses System hineinfahren, wie dort verarbeitet werden kann. Die Autobahnausfahrten werden dabei priorisiert, damit kein Rückstau auf die Autobahnstammlinie entsteht. Anhand von Verkehrserhebungen wurde festgestellt, dass es während der Bauzeit bisher kaum Ausweichverkehr gab. Bereits vor dem Baubeginn entstand während der Grossanlässe wegen der Parkplatzsuchenden ein hoher Druck auf die Wohnquartiere.
Mit einer dynamischen Parkraumbewirtschaftung im Endzustand wird man dem entgegenwirken.
Betreiber und Nutzende informieren
Aufgrund der massiven Eingriffe in das Verkehrssystem im Gebiet Wankdorf wurden Betreiber und Nutzer der Infrastrukturen grundsätzlich vorab umfassend darüber informiert, was sie zu erwarten hatten. Beispielsweise informiert die Bauherrschaft jeweils schon parallel zu den Vorbereitungsarbeiten über die Verkehrsumstellungen. Durch diese Vorabinformation entschärften sich die Vorbehalte, und die für den Umbau erforderlichen Massnahmen wurden eher akzeptiert. Aufgrund der Komplexität des Projektes rief das Tiefbauamt des Kantons Bern eine «Task Force Verkehr» ins Leben, deren Aufgabe es ist, während der heiklen Zeitfenster für schnell zu treffende Entscheide bereitzustehen, dringende Massnahmen umzusetzen und den gesamten Arbeitsablauf fachlich zu begleiten. Grundlage für diese Massnahme war unter anderem die von den Verkehrsplanenden vor Beginn der ersten Phase durchgeführte Risikoanalyse für jede Hauptverkehrsphase.
Das künftige Betriebskonzept
Der Wankdorfplatz kann nicht räumlich oder fachlich isoliert betrachtet werden, sondern beinhaltet ein Gesamtpaket an Massnahmen, die verschiedenen Ansprüchen gerecht werden müssen und die Weiterentwicklung des Entwicklungsschwerpunktes Wankdorf erst ermöglichen. Es wird beispielsweise ein Modalsplit mit einem Anteil des motorisierten Verkehrs von nur 35 % am gesamten Verkehrsaufkommen anvisiert. Nur gemeinsam mit allen geplanten Ausbauvorhaben, wie dem Ausbau des Angebotes im öffentlichen Verkehr und des Langsamverkehrs, kann dies erreicht werden. So ermöglichen der Umbau des Autobahnanschlusses Bern Wankdorf und zusätzliche Busspuren, dass der öffentliche Verkehr künftig ohne grössere Behinderungen zirkulieren kann. Dadurch, dass nur der Geradeausverkehr auf dem Wankdorfplatz verkehrt, kann dieser mit einer 2- Phasen-Steuerung betrieben werden, was dank kurzen Wartezeiten an den Ampeln wiederum eine attraktive Ausgangslage für den Langsamverkehr sein wird.TEC21, Fr., 2011.08.12
12. August 2011 Franz Bamert, Alain Kuttner
Innerstädtisches Trassee
Mit dem Ausbau des Wankdorfplatzes soll der Verkehr künftig flüssig und mit möglichst grossem Fahrkomfort für alle Verkehrsteilnehmenden abgewickelt werden. Zudem sollen Freiräume für den öffentlichen Verkehr und den Langsamverkehr geschaffen werden. Als Grundlage dafür dient eine Trassierung, die sowohl die zahlreichen Zwangspunkte als auch die verschiedenen Anliegen der Anstösser und Fachplanenden berücksichtigt.
Die Modellierung aller geometrischen Elemente von Strassen- und Gleisanlagen war bei der Umgestaltung des Wankdorfplatzes eine wesentliche Projektgrundlage für die beteiligten Fachplanenden. Seit Beginn sind etliche Fachbereiche wie Strassenbau, Kunstbauten, Gleisbau, Architektur sowie Ver- und Entsorgung involviert, und jeder möchte seine Ansprüche, Wünsche und Ideen ins Gesamtprojekt einbringen. Die Herausforderung für die Trassierung besteht darin, die zum Teil gegensätzlichen Anliegen gebührend zu berücksichtigen und dabei die Kosten im Auge zu behalten. Beispielsweise konnte die Aushubmenge nur bedingt optimiert werden, indem das Kreiselzentrum angehoben wurde, denn dadurch wäre die Verkehrsführung im Bauzustand komplexer geworden. Die Kunst des Trassierens ist also keine emotionslose, geometrische Angelegenheit, sondern liegt auch darin, in einem kreativen, iterativen Prozess möglichst viele Anforderungen im Gesamtbauwerk zu vereinen, gegebenenfalls Kompromisse zu postulieren und einen Konsens zu finden.
Zwangspunkte fordern Ingenieure heraus
Bereits im Vorprojekt haben die Verkehrs- und Bauphasen die Trassierung stark geprägt. Grundsätzlich führt der Verkehr jeweils über die bestehende Infrastruktur oder über die neu erstellten Bauwerke – je nach Bauphase wird der Verkehrsfluss angepasst und über die eine oder andere Variante abgewickelt. Diese Vereinfachung spart Kosten und verhindert vor allem provisorische Bauten wie Hilfsbrücken.
Besonders anspruchsvoll in diesem Gesamtverkehrssystem mit Autobahnzufahrten, Erschliessungsstrassen und mit dem Verkehrsnetz des öffentlichen Verkehrs ist der Wankdorfplatz mit dem unterirdischen Kreiselbauwerk, den vier Zufahrtsrampen und dem oberirdischen Platz inklusive der neuen Tramgleisanlage (vgl. «Verkehr entflechten»). Er bildet das Kernstück der Trassierungsarbeit. Beide Ebenen sind in der räumlichen Ausdehnung durch eine Vielzahl von Zwangspunkten begrenzt: das Leichtathletikstadion, die Allmend, angrenzende Gebäude, bestehende Strassenränder sowie die historische Achse der Papiermühlestrasse mit ihren Werkleitungen und dem alten Baumbestand. Die beiden Ebenen zu einem einheitlichen Modell zu verknüpfen, war eine ingenieurtechnische Herausforderung.
Oberirdisch und unterirdisch
Die beiden zentralen grossflächigen Bereiche des unterirdischen Kreisels und des oberirdischen Platzes befinden sich im Spannungsfeld zwischen Bestand, Fahrdynamik, Oberflächenentwässerung und Konstruktion des Kreiselbauwerks. Um die geeignetste Trassierung zu ermitteln, führten die Ingenieure von Emch Berger AG Bern ein Variantenstudium durch.
In der Konzeptphase zeigten sie alle relevanten Modellierungen der beiden Ebenen auf und verdeutlichten ihre Konsequenzen (Abb. 2). Mit einer Nutzwertanalyse beurteilten sie schliesslich jede Variante und ermittelten die Bestlösung, die sie zur Weiterbearbeitung empfahlen. Die Wahl der Oberfläche der Platzebene fiel auf die Kegelform mit einer konstanten Neigung von 3 % zum Platzrand hin, da diese für die Fahrdynamik, für die Oberflächenentwässerung und für den Bauablauf die beste Lösung bietet, nur geringe Anpassungen an die Umgebung fordert und eine Tramgeometrie gemäss den Anforderungen des Trambetreibers gewährleistet.
Bezugspunkte schaffen
Die im Raum Wankdorf vorhandenen Fixpunkte des Bundes, der SBB und der amtlichen Vermessung der Stadt Bern sind nicht in einem einheitlichen Fixpunktnetz zusammengeführt. Um sich also eine gemeinsame und einheitliche planerische Grundlage zu schaffen, fügten die Ingenieure alle Daten zuerst in ein harmonisiertes, übergeordnetes Fixpunktnetz zusammen. Dieses Fixpunktnetz dient als Grundlage für die Aufnahme des digitalen Terrainmodells (DTM) und für die Bauabsteckungen vor Ort – es bildet grundsätzlich das Bezugsnetz für alle späteren Ausführungsarbeiten. Auch das Kreiselzentrum ist seit der ersten Projektphase in Lage und Höhe präzis definiert. Damit sind ebenfalls die vier Hauptachsen räumlich klar definiert und zugeordnet (Abb. 1). Jede der Achsen hat eine eindeutige Kilometrierung und wird bis zur Inbetriebnahme beibehalten.
Nachdem das Modellierungskonzept bestimmt und die Bezugspunkte abgesteckt waren, erfolgte die planerische Ersttrassierung relativ rasch, um den weiteren Fachbereichen eine solide Basis für ihre fachspezifische Projektierung zu schaffen. Die Trassierung erfolgte lückenlos über den gesamten Perimeter und stellte für alle Fachplanenden eine definitive, dreidimensionale digitale Projektoberfläche zur Verfügung. Anschliessend erstellten die Planenden unter Berücksichtigung des Bauablaufs die Konzepte für Werkleitungen, Konstruktion und Verkehrsphasen.
Ausführung absichern
Während der Ausführungsprojektierungen erhöhte sich der Detaillierungsgrad weiter: Grundlagen wie Kotierungspläne, Höhenlinienpläne, Terrainschnitte, Abwicklungen von Linienführungen und Grundlagen für Visualisierungen entstanden. Zusätzlich wurden vor Baubeginn zahlreiche Absteckungsdaten für verschiedene Gewerke wie Gleisanlage, Baugrubenabschlüsse, Werkleitungen oder Schalungen erstellt und die entsprechenden Bezugspunkte, basierend auf dem erwähnten Fixpunktnetz, im Gelände abgesteckt.
Während der Realisierung werden die Arbeiten überwacht und kontrolliert. Dabei prüfen die Ingenieure die Lage und die Höhe der einzelnen baulichen Elemente wie der Randsteine, der Brüstungen, der Strassenchaussierung oder des Deckels des Kreiselbauwerks mittels eines Differenzmodells. Beispielsweise wird die erstellte Betondecke des unterirdischen Kreisels vor dem Belagseinbau mit den Sollhöhen aus der Projektierung verglichen. Die verschiedenen Differenzhöhen können abgestuft eingefärbt und entsprechend aufbereitet werden. Basierend auf der sich daraus ergebenden Visualisierung können allfällige Massnahmen präzis geplant werden.TEC21, Fr., 2011.08.12
12. August 2011 Christian Teuscher, Stefan Zingg