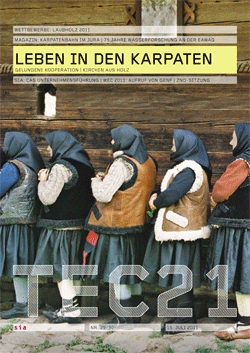Editorial
Ganz im Westen der Ukraine, in Transkarpatien, befindet sich der grösste Buchenurwald Europas. Während soeben fünf alte deutsche Buchenwälder zum Unesco-Weltnaturerbe erklärt wurden haben die Buchenurwälder in den ukrainischen und den slowakischen Karpaten diesen exklusiven Status bereits 2007 erlangt.
Wenn man die ukrainischen Karpaten besucht, so sticht der Waldreichtum ins Auge. Und der Wald prägt das Leben der Menschen in den Karpaten. Auf den zweiten Blick stellt man erstaunt fest, dass sich in Transkarpatien viele Schweizer engagieren. Vielleicht fasziniert hierzulande die Mentalität eines Bergvolkes, das immer wieder den Grossmächten zu trotzen versuchte – vor noch nicht langer Zeit dem Sowjetsystem und möglicherweise je länger, je mehr auch den gegenwärtigen Machthabern in Kiew. Respekt verdient zweifellos der Überlebenswille der Menschen in den abgelegenen Bergtälern, die in letzter Zeit von schweren Überschwemmungen heimgesucht wurden.
Als Kontrast zum rauen Gebirgsklima versprühen die vorgelagerten kleinen Städte am Rande der ungarischen Tiefebene fast schon mediterranes Flair. Und tatsächlich gab es früher Verbindungen nach Westen und nach Süden. Der bekannte Schriftsteller Juri Andruchowytsch, der in Iwano-Frankiwsk in den ukrainischen Karpaten lebt und noch bis Ende Juli dank einem Atelierstipendium in der Schweiz weilt, schrieb in einem Essay 2003, dass man zu Zeiten der österreichisch-ungarischen Monarchie von seiner Heimat aus bis nach Venedig visumfrei reisen konnte. Heute hingegen findet die Durchlässigkeit im neuen Europa an der ukrainischen Grenze ein abruptes Ende.
In den letzten Jahren hat sich die Schweiz in Transkarpatien unter anderem im Rahmen eines Forstentwicklungsprojektes engagiert. Nach schwierigem Anfang hat sich eine fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt. Besondere Beachtung fanden dabei die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung. So könnte ein grüner Tourismus künftig zu einer bedeutenden Einkommensquelle der ländlichen Bevölkerung werden. Die Buchenurwälder, heute noch ein Geheimtipp, dürften dabei eine wichtige Rolle spielen («Gelungene Kooperation»).
Die Region hat nicht nur Naturschätze zu bieten. Erstaunlich wenig bekannt sind etwa die zahlreichen Holzkirchen. Andrij Kutnyi hat in seiner Dissertation an der Universität Bamberg die Vielfalt dieser teilweise sehr alten Bauwerke untersucht und dokumentiert. Seine sehr umfangreichen Forschungsergebnisse sind als Buch veröffentlicht. Der Autor hat für uns die engen Bindungen zwischen Wald und Kirchenbau kurz zusammengefasst («Kirchen aus Holz»).
Die Erhaltung der ukrainischen Buchenurwälder scheint gesichert. Damit aber auch künftige Generationen Holzkirchen bewundern können, dafür bedarf es noch einiger Anstrengungen und innovativer Konzepte.
Lukas Denzler