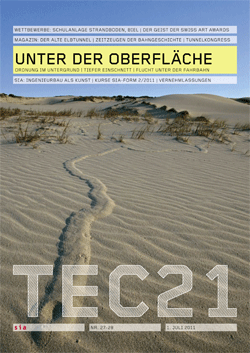Editorial
«Vor der Hacke ist es duster.» Die alte Bergmannsweisheit ist im Tunnelbau auch heute, trotz allen Prognosemitteln, noch aktuell. Aber nicht nur vor der Hacke der Tunnelbauer liegen verborgene Geheimnisse – überall, wo unter der Erdoberfläche gebaut wird, im Tiefbau, im Leitungsbau, bei Bohrungen, spielen Ungewissheiten mit, sind Überraschungen jederzeit möglich: Auch unter den Gummistiefeln der Tiefbauer ist es manchmal ziemlich «duster».
Dazu trägt auch bei, dass der Baugrund wegen der rasch fortschreitenden Verdichtung und Vernetzung unseres Lebensraums, neben den natürlichen Gegebenheiten, zunehmend von menschlichen Bauten und Einwirkungen geprägt wird. Das schafft neue Risiken und Ungewissheiten sowohl bei der Erstellung neuer Bauwerke als auch bei der Nutzung bestehender Strukturen. Zukünftige Planungen werden wesentlich mehr Informationen über den Untergrund einbeziehen müssen als die üblichen Ergebnisse geologischer Untersuchungen. Die Grundlagen dafür schaffen Datenbanken und Modelle wie das hier vorgestellte geologische 3D-Modell für den Grossraum Basel - Oberrhein («Ordnung im Untergrund»).
An der Oberfläche ist in der Regel nicht erkennbar, was für Probleme der Baugrund stellen kann. Natürlich werden im Vorfeld Baugrunduntersuchungen vorgenommen, Gutachten erstellt und Bodenmodelle berechnet, Gewissheit über die Eigenschaften und das Verhalten des Bodens hat man aber auch heute erst, wenn die Arbeiten tatsächlich begonnen haben. Erst dann weiss man, ob die projektierten Bauweisen und Massnahmen unter den tatsächlichen Bedingungen funktionieren oder ob kurzfristig, bei laufendem Baubetrieb, Anpassungen vorgenommen werden müssen oder gar das Konzept geändert werden muss. Welche Herausforderungen der Baugrund stellen kann und wie ihnen mit heutiger Tiefbautechnik begegnet wird, zeigt der Bau des Tagbautunnels der A9 bei Turtmann exemplarisch («Tiefer Einschnitt»).
Die kürzlichen Brände auf der Zürcher Westumfahrung und im Simplontunnel haben erneut gezeigt, wie berechtigt Massnahmen zum Schutz von Menschenleben in Tunnels im Brandfall sind. Sicherheits- und Brandschutzmassnahmen sind auch in Tunnels mittlerer Länge lebenswichtig, sie werden deshalb zu Recht mit hoher Priorität ertüchtigt. Am Beispiel der Ertüchtigung des Tunnels Eggflue im Basler Jura («Flucht unter der Fahrbahn») wird deutlich, wie gross der Aufwand für Planung und Realisierung einer derartigen Nachrüstung ist. Auch die Ausführung unter Verkehr stellt alle Beteiligten vor grosse Herausforderungen. Die Ertüchtigung bestehender Tunnels ist eine im Endeffekt unspektakuläre, aber sehr anspruchsvolle Aufgabe, die im Ereignisfall viele Menschenleben retten kann.
Aldo Rota
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Schulanlage Strandboden, Biel | Der Geist der Swiss Art Awards
12 MAGAZIN
Investitionen für die Zukunft | Effizienz von Rechenzentren erhöhen | Der alte Elbtunnel Hamburg | Zeitzeugen der Bahngeschichte | Swiss Tunnel Congress
20 ORDNUNG IM UNTERGRUND
Peter Huggenberger, Horst Dresmann
Mit einem an der Universität Basel entwickelten 3DModell können alle Parameter des Untergrundes erfasst und für die Planung zukünftiger Bauvorhaben genutzt werden.
23 TIEFER EINSCHNITT
Hermann Kaeser, Jörg Meier
Der Bau des Tagbautunnels Turtmann der A9 ist wegen des weichen Baugrunds anspruchsvoll. Für die Baugrubensicherung ist unter anderem eine Sohle aus Jettingsäulen erforderlich.
27 FLUCHT UNTER DER FAHRBAHN
Alexander Binggeli
Der Tunnel Eggflue der Umfahrung Grellingen erfüllt die aktuellen Sicherheitsanforderungen nicht mehr und wird deshalb ertüchtigt. Als wichtigste Massnahme wird ein Fluchtweg eingerichtet.
31 SIA
Ingenieurbau als Kunst | Kurse SIA-Form Deutschschweiz 2/2011 | Vernehmlassungen
36 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Ordnung im Untergrund
Bei vielen Bauvorhaben endet der Planungshorizont an der Erdoberfläche. Für den Untergrund fehlen hingegen, mangels ausreichender Daten und Erfahrungen, meistens verbindliche Regeln. Seine Bedeutung als Träger von Infrastrukturen nimmt aber rasch zu. Deshalb ist die nachhaltige Planung der Nutzung des Untergrundes unabdingbar. Die Werkzeuge dazu sind geologische 3D-Modelle, die die erforderlichen Daten zur Verfügung stellen.
Der frei verfügbare Raum in urbanen Gebieten ist knapp. Deshalb werden Verkehrslinien und Infrastrukturen vermehrt in den Untergrund verlegt. Auch Gebäude wachsen nicht nur in die Höhe, sondern in zunehmendem Ausmass auch in die Tiefe. Die unterirdischen Nutzungen haben vielfache Auswirkungen auf den natürlichen Untergrund.
Wärme und unsichtbare Hindernisse im Boden
Bauen im Untergrund hat oft eine Wärmeabstrahlung zur Folge, die zu einer Erhöhung der Temperaturen im geologischen Untergrund bzw. zu einer Temperaturerhöhung im dort zirkulierenden Grundwasser führt. Dadurch kann ihr chemisches und biologisches Gleichgewicht gestört werden. In kiesigem Untergrund können je Kubikmeter bis über 200 Liter Wasser gespeichert werden.
Einbauten verringern das Speichervolumen und teilweise auch die Durchgängigkeit des Untergrunds für das Grundwasser. Für den Trinkwasserschutz sind diese Einwirkungen im Allgemeinen von untergeordneter Bedeutung. Hingegen führen sie zu unerwünschten Nebeneffekten, beispielsweise einer Umlenkung von Grundwasserströmen. Durch grössere Grundwasserspiegelabsenkungen bei Baustellen können zusätzlich Schadstoffe von Industriealtlasten oder Betriebsstandorten mobilisiert und unkontrolliert verfrachtet werden. Zudem wird dem Risiko von Geländeabsenkungen oder Tagbrüchen während der Bauphase mit Zementinjektionen begegnet. Dadurch entstehen, je nach Bauwerkgrösse, lokal bis regional irreversible Verringerungen der Porosität und der Durchlässigkeit des Untergrundes.
Interessenskonflikte und Unsicherheit im Untergrund
Während für die Planung an der Oberfläche raumplanerische Vorgaben existieren, herrscht im Untergrund «Anarchie».[1] Es gibt nur wenige Regeln für dessen Nutzung, die auch die gegenseitige Beeinflussung konkurrenzierender Nutzungen beinhalten. Dadurch sind Nutzungskonflikte vorprogrammiert. Ausserdem ist es immer noch weit verbreitete Praxis, dass bei Infrastrukturvorhaben im Untergrund nicht der Schutz der natürlichen Ressourcen, sondern das jeweilige Projekt im Vordergrund steht.
Das Fehlen von geeigneten Regeln kann zu nicht zu unterschätzenden Gefährdungen führen, so zum Beispiel beim Bau von untiefen Geothermieanlagen (Staufen D), beim Auftreten unterirdischer Salzlösung (Adlertunnel BL) oder durch Quellen von Gesteinen bei der Umwandlung von Anhydrit zu Gips wie beim Chienberg- und beim Belchentunnel (BL und SO). Um den Untergrund in nachhaltiger Weise zu nutzen, bedarf es einerseits der raumplanerischen Priorisierung von Verkehrs- und Versorgungslinien von nationaler bzw. internationaler Bedeutung gegenüber individuellen Eingriffen in den Untergrund durch Private. Andererseits ist dem Aufbau und den Besonderheiten des geologischen Untergrundes Rechnung zu tragen.
Die Kenntnis davon ermöglicht, unter Einbezug eines geologischen 3D-Modells als Werkzeug für die Planung, differenzierte Lösungen bei der Nutzung des Untergrundes. Ausgehend von solchen Überlegungen hat die Abteilung Angewandte und Umweltgeologie (AUG) der Universität Basel im Rahmen ihres Leistungsauftrags «Zusammenführen der geologischen Daten mit den beiden Kantonen BS und BL» bereits 1993 begonnen, lokale projektbezogene geologische 3D-Modelle aufzubauen. Seit 2008 läuft zudem ein im Rahmen des INTERREG-Programms unterstütztes Projekt («GeORG») zur Charakterisierung geologischer Potenziale auf der Basis eines 3D-Modells entlang des Oberrheins (Abb. 3, vgl. auch Kasten S. 20).
Dynamisches 3D-Modell als Werkzeug
Die Entwicklung eines dynamisch anpassbaren geologischen 3D-Modells als Werkzeug für eine problemorientierte 3D-Raumplanung bedingt eine grosse Flexibilität sowohl im Datenmanagement als auch in der 3D-Modellierung. Veränderungen der Datenlage, des Modellinhalts oder der Modellgrösse müssen verarbeitet werden können. Die Erstellung des 3DModells beruht auf einem neuen Konzept, das Datenbank, Geoinformationssystem (GIS) und 3D-Modellierung kombiniert.
Zu jedem Modellhorizont, in der Regel eine geologische Formation, existiert ein eigenes thematisches GIS-Projekt. In ihm werden alle Eingangsdatensätze und, nach Abschluss eines Modellierungsschrittes, auch die resultierende Horizontgeometrie verwaltet. Eng verknüpft sind diese GIS-Projekte mit einer Datenbank, die über 9 000 Bohrungen aus der Region beinhaltet. Schon Ende der 1980er-Jahre hatte man in Basel die Notwendigkeit einer Bohrdatenerfassung erkannt und für das Baugrundarchiv des Kantons Basel-Stadt sowie für Bohrungen aus Basel-Landschaft eine Datenbank entwickelt. Seit dem wird deren Inhalt, aber auch deren technische Ausführung kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt. Die Datenbank verfügt über speziell programmierte Exportmöglichkeiten, um die geologische Abfolge einer Bohrung als File für die 3D-Modellierung bereitzustellen. Dies erspart umständliche Formatanpassungen und verhindert Fehler und Datenverlust. Das eigentliche geologische 3D-Modell wird mittels der Softwareapplikation GOCAD (Geological Objects Computer Aided Design) erstellt (siehe Kasten S. 22).
Die Datenverwaltung in thematischen GIS-Projekten ermöglicht einen schnellen Vergleich von neuen Daten (beispielsweise Bohrungen) mit schon erstellten Modellhorizonten, um Abweichungen ersichtlich zu machen. Solche Abweichungen begründen sich nicht nur in der Qualität der modellierten Fläche, ihre Ursache kann auch mit der Qualität eines Eingangsdatensatzes (beispielsweise geologische Bohraufnahmen) zusammenhängen.
Anwendungen des geologischen 3D-Modells in der Region Basel
Der aktuelle Bearbeitungsstand des Modells der Region Basel (Abb. 2) beinhaltet 180 Verwerfungen und 17 geologische Horizonte bis in eine Tiefe von 6000 m. Aus diesem regionalen Modell wird je nach Fragestellung ein lokales Teilmodell extrahiert. In diesem einfach zu handhabenden Teilmodell können spezifische Probleme angesprochen werden. Ergebnisse werden anschliessend wieder in das regionale Modell integriert, wodurch das regionale 3D-Modell sukzessive weiterentwickelt wird.
Die Planungen zu einem Autobahntunnel im Basler Süden sind ein Beispiel für die Anwendung eines 3D-Modells. Im Zusammenhang mit den Vorabklärungen bei der Planung der Verbindung «Anschluss Margarethenstrasse – Anschluss St. Jakobsstrasse West» (A2-Abschnitt 7) wird die Linienführung eines neuen Tunnelbauwerks evaluiert, welches das Bahnareal und einen Teil des Gundeldinger Quartiers im Südwesten von Basel unterquert. Die Angewandte und Umweltgeologie an der Universität Basel hat mithilfe einer GOCADKonstruktion zuhanden des Hochbau- und Planungsamts Basel-Stadt die aktuellen geologischen, hydrologischen und geotechnischen Daten entlang der geplanten Trasse zusammengestellt.
Lokales Teilmodell für Basels Süden
Dazu wurde das 3D-Modell im Basler Süden aktualisiert und ein lokales Teilmodell (Abb. 4) extrahiert. Zusätzlich wurden der Grundwasserstand im Lockergestein als zusätzlicher Horizont integriert und ein geologisches Längsprofil (Abb. 5) sowie mehrere Querprofile (Abb. 6) wurden erstellt. Auf Basis dieses 3D-Modells konnte dargestellt werden, in welchem Abschnitt die Tunneltrasse im Grenzbereich der Locker- und Festgesteine bzw. im Grundwasser verläuft. Eine Recherche in der Datenbank und im Baugrundarchiv ermöglichte eine Kompilation der geotechnischen Eigenschaften der Gesteine entlang der Tunneltrasse. Das 3D-Modell lieferte zudem auch eine rasche Visualisierung der Lage von bestehenden Nutzungen (Grundwassernutzung und Erdwärmesonden). Damit liessen sich insbesondere auch potenzielle Nutzungskonflikte zwischen Verkehrswegen und Anlagen zur Energiegewinnung frühzeitig erkennen.
Anmerkung:
[01] Tages-Anzeiger, 29.4.2011, S. 3 «Der Bund arbeitet an Regeln gegen die Anarchie unter der Erdoberfläche»TEC21, Fr., 2011.07.01
01. Juli 2011 Peter Huggenberger, Horst Dresmann
Tiefer Einschnitt
Der Baugrund ist der grösste Unsicherheitsfaktor, wenn neue Verkehrswege unter die Erdoberfläche, in Einschnitte und Tagbautunnels, verlegt werden. Auch die Rhoneebene bei Turtmann hat sich beim Bau des Tagbautunnels der A9 als weicher, instabiler Baugrund erwiesen. Die Grundbautechnik ist hier mehrfach gefordert: In der tiefen Baugrube kann der Tunnel nur gebaut werden, wenn die Sicherungskonzepte für Wände und Sohlen funktionieren.
Zwischen Sierre und Visp wird die vierspurige Autobahn A9 unter der Bauherrschaft des Kantons Wallis, Amt für Nationalstrassenbau, erstellt. Neben der Umfahrung Visp, als grosse Untertagebaustelle, sind auf dem ganzen Abschnitt verschiedene Ingenieurbauwerke im Bau, darunter der gedeckte Einschnitt Turtmann mit einer Länge von 1350 m. Die bautechnische Herausforderung ist hier der schwierige Baugrund und die dadurch bedingte Baugrubensicherung. Die teilweise geringen Abstände zu setzungsempfindlichen Produktionsanlagen erfordern den Einsatz deformationsarmer Baumethoden mit grossem Planungsund Überwachungsaufwand.
Der Tagbautunnel Turtmann wird zwischen den SBB-Gleisen im Norden und dem Industriegebiet von Turtmann im Süden mit maximalen Baugrubentiefen bis ca. 17 m geführt (Abb. 1). Das Bauwerk besteht aus zwei miteinander verbundenen Gewölben mit doppelspurigen Fahrstreifen der A9 sowie einem oben liegenden Leitungskanal (Abb. 3 unten).
Bautechnische Rahmenbedingungen
Zwischen dem Schuttfächer des Illgrabenbaches und der Engstelle beim Schuttfächer Gampel/ Steg resp. Riedberg liegt die Talebene Turtmann. Gebildet wurde sie durch mehrmalige Zyklen von Bergstürzen bzw. Murgängen mit nachfolgendem Rückstau der Rhone und erfolgter Stauverlandung und partieller Erosion der Auflandungsebene. Als Ergebnis liegt nun eine quartäre Talfüllung von grosser Mächtigkeit vor, wobei die Schichten in etwa oberflächenparallel verlaufen. Diese Schichten lassen sich als Wechsellagerung von locker gelagerten, wasserführenden Sanden und deformationsempfindlichen, wasserundurchlässigen siltig-tonigen Zwischenschichten von bis zu 15 m Mächtigkeit charakterisieren. Das Grundwasser steht bis auf Niveau der Terrainoberfläche.
Im nahen Umfeld des Bauwerks befinden sich Industriehallen mit sensiblen Fertigungsstrassen, ein Käsereibetrieb, der SBB-Bahnhof Turtmann sowie eine Strassenbrücke, bei der zwei Stützenfundamente von dem Tunnelbauwerk aufgrund ihrer Nähe direkt betroffen sind.
Bauphase 2004/2005
5Das Bauwerk wurde in drei Lose unterteilt und jeweils separat vergeben («Wanne West», «Wanne Ost» und «Haupttunnel»). In den Jahren 2004 und 2005 wurden die beiden Wannen erstellt und ab Mitte 2005 mit den Arbeiten am Haupttunnel im Bereich des tiefsten Aushubs (Pumpwerk) begonnen.
Während des Baugrubenaushubs und des Einbaus der zweiten Ankerlage stellten sich bereits sehr grosse Deformationen sowohl der Baugrubenwände (Spundbohlen) als auch der Geländeoberfläche ausserhalb der Baugrube ein. Die Arbeiten wurden deshalb unterbrochen und Massnahmen zur Beherrschung dieser neuen Gegebenheiten realisiert:
– Verdichtung der Bodenuntersuchungen inklusive zusätzlicher Labor- und Feldversuche
– Verdichtung des Monitorings der Baugrube und des Umfeldes
– Anpassung der Baumethoden und Optimierung des Baugrubenkonzeptes zur Minimierung der Verformungen
– Bauliche und technische Massnahmen zur Minimierung des Einflusses eventueller Verformungen und Verkippungen bei den umliegenden Bauwerken und Industrieanlagen.
Baugrubensicherung
Die Messungen der Setzungen der Geländeoberfläche haben gezeigt, dass die ursprünglich vorgesehene Baugrubensicherung mit durch Vibrationshammer einvibrierten 31 m langen Spundwandbohlen inakzeptable Setzungen verursachte. Als Alternative wurde im vorliegegenden weichen Baugrund das teilweise Einpressen der Bohlen mit hydraulischen Pressen erprobt, was aber zu ungewissen Ergebnissen führte. In den Bereichen mit Industrie- und Infrastrukturbauten favorisierten die Ingenieure deshalb eine Baugrubensicherung mit Schlitzwänden. Mit dieser verhältnismässig aufwendigen Baumethode konnten die Setzungen und die Ausführungsrisiken minimiert werden. Zudem reduzierte diese Baumethode die Anzahl Abspriessungen bzw. Rückverankerungslagen und die Verformungen der Bodenvolumina hinter der Baugrubenwand durch die Wahl einer deutlich steiferen Verbaulösung.
Optimierung des Baugrubenkonzeptes
Mit Blick auf die festgestellten Verformungen wurde das Hauptbauwerk in ca. 300 m lange Abschnitte eingeteilt. Somit war es möglich, die unterschiedlichen Randbedingungen der Abschnitte optimal zu berücksichtigen und in die Planung der Baugrubenabschlüsse detailliert einfliessen zu lassen. Die einzelnen Baugrubenabschnitte sind durch Querschotte voneinander getrennt und können unabhängig gebaut werden. Sobald ein Querschott gebaut ist, kann der Bauabschnitt hinterfüllt und in diesem die Wasserhaltung abgestellt werden. Mit der Simulation verschiedener Ausführungsvarianten mit klassischen und FE-Methoden konnte das Baugrubenkonzept technisch und kostenmässig optimiert und die Verformungen konnten minimiert werden. Die FE-Simulationen führten dazu, dass die ursprünglich geplante, rückverankerte Spundwand teilweise durch Schlitzwände mit vorgespannten Spriessen er- setzt wurde. Eine wichtige Folgerung der Simulationen ist auch das Einbringen einer unterirdischen Spriesslage in Form einer Jettingsohle (vgl. Kasten S. 26) zur Stützung der Baugrubenwände vor dem Baugrubenaushub.
Aus den Untersuchungen resultierten zwei (in Abb. 2 und 3 dargestellte) Baugrubenkonzepte. Beide Varianten stützen sich auf eine als unterirdische Spriesslage wirkende Jettingsohle unterhalb der Baugrubensohle. Die in Abbildung 3 gezeigte Lösung mit vorgespannten Spriessen in Kombination mit einer Schlitzwand kommt im Bereich der Industrieanlagen zum Einsatz, in dem die Verformungen des Baugrubenumfeldes möglichst minimiert werden sollen. In den anderen, weniger kritischen Bereichen wurde eine Rückverankerung mittels Jettingankern entweder mit einer Schlitzwand oder einer Spundwand vorgesehen (Abb. 1).
Jettingsohle
Die Jettingsohle, die als unterirdische Spriesslage die nur in geringem Umfang vorhandene Tragfunktion des Bodens zwischen den Baugrubenwänden unterhalb der Baugrubensohle übernimmt, trägt entscheidend zum stabilisierenden Effekt des Baugrubenverbaus bei. Bei der nach der Einbringung der Baugrubenwände (Spundwände oder Schlitzwände) erstellten Jettingsohle sind die Säulen nicht als durchlaufende Front angeordnet; zur Minimierung der Spannungsinduzierung sind sie in einer zufälligen Reihenfolge erstellt worden (Abb. 5). Abbildung 4 zeigt die Auswirkung der Jettingsohle im Schema links auf die Verformung der Baugrubenwand im Bereich mit einem rückverankerten Spundwandverbau (Diagramm rechts). Der im Diagramm blau hinterlegte Schwankungsbereich zeigt die Verformungen ohne Jettingsohle. Für diesen Fall findet eine Verschiebung des Spundwandkopfes in Richtung Baugrube von 8 bis 15 cm statt. Diese Deformation ist mit einer vergleichsweise geringen Biegung der Spundwandbohlen verbunden. Das Verformungsbild der Spundwandbohlen kann eher als Verdrehung um den Fusspunkt charakterisiert werden, wobei durch das unter der Baugrubensohle verbliebene Bodenvolumen keine ausreichende Stützwirkung mobilisiert werden kann. Eben diese fehlende Stützwirkung wird durch die nun verwendete Jettingsohle übernommen, sodass der im Diagramm grün hinterlegte Deformationsbereich mit Jettingsohle am Kopf der Spundbohlen ±0 cm beträgt. Ein weiteres interessantes Detail zeigt sich für das Verformungsbild der Spundwand mit Jettingsohle auf Höhe der Jettingsäulen: Der vor dem Jetting eingebaute Verbau wird durch die mit dem Jetting verbundenen Drücke leicht nach aussen gedrückt. Dieser Effekt ist im Diagramm als Ausbauchung sichtbar.
Numerische Nachrechnung der Optimierungen
Als Ergänzung zu den klassischen Bemessungsverfahren wurden FE-Modelle verwendet, um die zu erwartenden Verformungsbilder der einzelnen Verbaulösungen und Verbauvarianten möglichst realistisch abzuschätzen. Neben der detaillierten Modellierung der einzelnen Arbeitsschritte, ausgehend von einem Zeitpunkt vor Baubeginn bis zum hinterfüllten und in Betrieb genommenen Tunnel, wurde besonderes Augenmerk auf die realistische Darstellung des initialen Zustandes des Bodens und dessen konstitutive Modellierung gelegt. Die einzelnen Materialmodelle und zugehörigen Parametersätze wurden an verschiedenen in situ und im Labor bestimmten Messwertreihen validiert und kalibriert. Als Beispiel für die durchgeführten Berechnungen zeigt Abbildung 6 Ausschnitte aus den Resultaten der numerischen Modellierung der Unterfangung der Strassenbrücke Getwing, die den Einschnitt ungefähr rechtwinklig quert, im Zustand des Endaushubs. Zwei nahe am zu erstellenden Tunnel gelegene Brückenpfeiler wurden mittels Jetting unterfangen. Durch die wasserdichte Ausführung dieses Jettingkörpers konnte die Unterfangung auch gleichzeitig als Baugrubenwand verwendet werden. Wie in den restlichen Baugrubenabschnitten wirkte wiederum eine aufgelöste Jettingsohle als unterirdische Spriesslage. Auf der Basis dieser Berechnungen konnten die Verformungen des Brückenbauwerks abgeschätzt und ihre Warn- und Grenzwerte festgelegt werden. Die in den verschiedenen Jettingkörpern bestimmten Spannungen wurden den klassischen Nachweisverfahren gegenübergestellt und die damit verbundenen Nachweise geführt.
Projektstand
Mittlerweile ist der erste Baugrubenabschnitt von ca. 350 m im Osten fertig und hinterfüllt; im zweiten − und zugleich tiefsten − Abschnitt von weiteren ca. 300 m mit der Pumpstation ist der Baugrubenaushub fertig, die Pumpstation und die Hälfte des Tunnels sind gebaut. In den restlichen Bereichen sind die Baugrubenabschlüsse erstellt und die Jettingsohle in Arbeit. Im Bereich der Industrieanlage werden momentan die vorgespannten Spriesse eingebaut. Nach dem Terminplan der Bauherrschaft sind die Rohbauarbeiten 2014 beendet. Im Jahr 2015 erfolgt der Innenausbau, und 2016 werden die Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen angebracht. Somit kann der Tunnel voraussichtlich 2017 in Betrieb genommen werden.
Jetting
Jetting, deutsch Düsenstrahlverfahren, ist ein Verfahren zur Stabilisierung bzw. Verfestigung des Baugrunds im Tief- und Tunnelbau. Zunächst wird eine Rohrlanze mit wenigen Zentimetern Durchmesser in den Baugrund vorgetrieben. Die Rohrlanze verfügt kurz nach ihrer Spitze über meist zwei seitliche, senkrecht zur Rohrachse gerichtete Düsen. Durch diese Düsen wird eine wässrige Zementsuspension («Zementmilch ») seitlich in den Baugrund injiziert. Durch langsame Rotation und gleichzeitigen Rückzug der Rohrlanze entsteht ein säulenförmiger, mit Zementsuspension gesättigter Bereich im Baugrund. Nach der Erhärtung der Zementsuspension weisen die so entstandenen Jettingsäulen, die Durchmesser von über zwei Meter erreichen können, eine wesentlich höhere Festigkeit und Tragfähigkeit auf als der unverfestigte Baugrund.
Je nach den gewählten Herstellungsparametern der Jettingsäule wird der Baugrund lediglich verdichtet, teilweise oder auch ganz ausgetragen und durch Zementstein ersetzt. Jettingsäulen können, je nach Funktion, vertikal oder in beliebigen Winkeln hergestellt werden. Sie werden als einzelne Säulen (Pfähle), eindimensional überschneidend als Jettingwände oder zweidimensional überschneidend als Jettingsohlen angeordnet.
[Aldo Rota]TEC21, Fr., 2011.07.01
01. Juli 2011 Hermann Kaeser, Jörg Meier