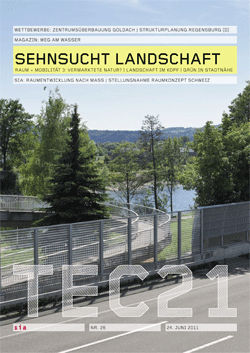Editorial
Die Schweizer Landschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant verändert. Wo sich vor fünfzig Jahren ländliche Gebiete ausbreiteten, die in ihrem Charakter deutlich von den Städten unterscheidbar waren, wuchern heute vielerorts gesichtslose Agglomerationen. Als Reaktion auf diese Entwicklung wächst einerseits das Unbehagen und wird der Ruf nach einer wirksameren Raumplanung lauter. Auf der anderen Seite wächst auch die Sehnsucht nach «schöner» Landschaft. Ein Grossteil der Bevölkerung versteht darunter unberührte Natur- bzw. traditionelle Kulturland-schaften. Die Alltagsumgebung vieler Schweizer hat mit dieser Vorstellung nicht mehr viel zu tun. Entsprechend fühlen sie sich dieser auch kaum emotional verbunden. Diese zwiespältige Raumwahrnehmung zeigt sich in einer in Glarus Süd durchgeführten Untersuchung, die wir in diesem Heft vorstellen («Die Landschaft im Kopf»).
Als Konsequenz daraus streben Stadt- und Agglobewohner in ihrer Freizeit in jene Ecken der Schweiz, wo die reale Landschaft noch ihrem Idealbild zu entsprechen scheint, und würden diese verbliebenen heilen Landschaften gern konservieren. Dass die damit verbundene Freizeit-mobilität gerade jene unberührte Natur gefährdet, vor allem aber zur weiteren Zerstörung der näher gelegenen Landschaftsreste beiträgt, ist die gern verdrängte Folge.
Die Artikel in diesem Heft beleuchten, wie sich diese Entwicklung durchbrechen und in nachhaltigere Bahnen lenken lässt. Wir bewegen uns dabei in einer Art Gradient von den noch weitgehend «heilen», abgelegenen Landschaften in zunehmend urbaneres Gebiet. So zeigt der Artikel über die 2007 eingeführten «Parks von nationaler Bedeutung», dass es dort zwar sehr wohl um die Erhaltung von Natur und Landschaft geht, die menschliche Nutzung und die Weiterentwicklung des ländlichen Raumes jedoch nicht ausgeblendet werden dürfen («Vermarktete Natur»).
In Glarus Süd ist die «heile» Landschaft zwar ebenfalls nicht weit; aber auch die zunehmend urbane Alltagslandschaft im Tal lässt sich aufwer-ten, sodass sie vom blinden Fleck wieder zur Heimat wird, mit der sich die Bewohner identifizieren können. Ansätze dafür stellt der Artikel «Die Landschaft im Kopf» vor.
Auch im Einzugsgebiet der grössten Stadt der Schweiz gibt es noch zahlreiche Landschaften, die zu entdecken sich lohnt. Damit diese trotz zunehmender Verdichtung erhalten bleiben, wurde der Agglomerationspark Limmattal ins Leben gerufen («Grünraum in Stadtnähe»). Neben einer Aufwertung und besseren Vernetzung der Freiräume zwischen Baden und Zürich ist dessen Ziel auch, diese Landschaft besser bekannt zu machen – auf dass wir in unserer Sehnsucht nach Landschaft das Naheliegende wieder wahrzunehmen lernen.
Claudia Carle
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Zentrumsüberbauung Goldach | Strukturplanung Regensburg (D)
14 MAGAZIN
Weg am Wasser
22 VERMARKTETE NATUR?
Stefan Forster In allen Teilen der Schweiz entstehen neue Parks. Die Naturwerte der Regionen sollen damit erhalten und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung gefördert werden.
26 DIE LANDSCHAFT IM KOPF
Christine Meier Eine Untersuchung in Glarus Süd zeigt, dass Landschaft nur dort Identität stiften kann, wo die wahrgenommene und die reale Landschaft übereinstimmen. Ein wertvoller Hinweis für die Raumentwicklung.
31 GRÜNRAUM IN STADTNÄHE
Sigrun Rohde Beim Agglomerationspark Limmattal arbeiten 17 Städte und Gemeinden zusammen daran, die Freiräume zwischen Zürich und Baden aufzuwerten und als Naherholungsgebiet bekannter zu machen.
38 SIA
Raumentwicklung nach Mass | Wem gehört der Mehrwert? |Stellungnahme Raumkonzept Schweiz | Geodaten in der Nutzungsplanung | Berufshaftpflicht-Versicherung
42 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Vermarktete Natur?
Regionale Naturparks und Naturerlebnisparks können regionalökonomische Entwicklungsinstrumente sein. Und sie müssen dazu beitragen, dass ihr Kapital – intakte Natur- und Kulturlandschaft – erhalten und aufgewertet wird. Parks verstärken aber auch eine romantische Naturwahrnehmung, die menschliche Nutzung ausblendet und eine nachhaltige Entwicklung behindern kann. In diesem Spannungsfeld bewegen sich die partizipativen Entwicklungsprozesse der Parkprojekte.
Dutzende von Parkprojekten werden in Schweizer Regionen diskutiert und entwickelt. Ermöglicht hat dies eine Teilrevision des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG). Damit wurde 2007 die rechtliche Grundlage für den Aufbau und den Betrieb von Parks gelegt. Die drei Parkkategorien Regionale Naturparks, Nationalparks und Naturerlebnisparks werden durch den Bund gefördert und finanziell unterstützt (vgl. Abb. 1 und Kasten). Regionale Naturparks und Naturerlebnisparks sollen zur Wertschöpfung in der Region beitragen. Der Betrieb eines Parks schafft Arbeitsplätze im Parkmanagement, in der Beratung und in der Bildung. Daneben können indirekt Arbeitsplätze im Bereich touristischer Angebote, in der Landwirtschaft, im Gewerbe und in der Gastronomie erhalten und geschaffen werden. Von der effizienteren Vermarktung der Region durch das Label «Park von nationaler Bedeutung»[1] profitiert nicht nur der Tourismus. Auch andere Branchen können durch verstärkte Kooperationsbemühungen in den verbesserten Wertschöpfungskreislauf eingegliedert werden. So können beispielsweise aus dem einheimischen Rohstoff Holz, der vermehrt vor Ort verarbeitet und veredelt wird, neue regionale Produkte gefördert und auf der Parkplattform vermarktet werden. Im internationalen Tourismus ist der Begriff Park gut eingeführt. Es besteht ein etablierter Parktourismus. Der Schweizerische Nationalpark ermöglicht den 16 angrenzenden Gemeinden eine direkte touristische Wertschöpfung von 8.8 bis 12.8 Mio. Franken.[2] Die italienischen Nationalparks und Schutzgebiete wurden 2005 von 76 Millionen Gästen besucht. Daraus resultierte ein Umsatz von mehr als 8 Mrd. Euro.[3] Der Blick über die Landesgrenzen zeigt, dass geschickte, kooperative Strategien Gewinne für die Regionen bringen.
Chancen für die Regionalentwicklung
Die Erfahrungen aus dem Ausland und aus der bisherigen Entwicklungsarbeit in der Schweiz zeigen wichtige Erfolgsfaktoren:
1. Parkentwicklungen basieren auf einem Konsensfindungsprozess zwischen Naturschutz und diversen Nutzungsansprüchen. Parks können nicht über die Köpfe der Bevölkerung hinweg realisiert werden. Ein oft mühsamer Gestaltungs- und Bewusstseinsprozess erfordert viel Zeit und Ausdauer von den verantwortlichen Akteuren.
2. Machbarkeitsstudien, Landschaftsbewertungen, Managementpläne und Umweltbildungskonzepte sind wichtige Grundlagen, um den potenziellen Parks Leben einzuhauchen. Sie brauchen möglichst sichtbare Inhalte. Sichtbar werden diese beispielsweise durch buchbare Tourismusangebote, durch regional produzierte Landwirtschaftsprodukte oder durch Informationspunkte im Parkgebiet. Gerade, wenn es um die Akzeptanz der Bevölkerung geht, um die ökonomischen Potenziale eines möglichen Parks und um die strukturelle Zusammenarbeit zwischen den touristischen Leistungsträgern, der Land- und Forstwirtschaft, des regionalen Gewerbes und der Natur- und Kulturinstitutionen, ist es entscheidend, dass mit gemeinsamen Angeboten möglichst konkrete Umsetzungen angestrebt werden. Das erhöht die Identifikation mit dem Projekt, macht die Inhalte für Gäste erlebbar und bringt alle Akteure über die ideologischen Gräben hinweg pragmatisch zusammen.
3. Parks sind keine reinen Wirtschaftsprojekte für die Regionen. Der Natur- und Kulturschutz spielt eine entscheidende Rolle. Die Parkkategorie «Regionaler Naturpark» stützt sich auf die bestehende Gesetzgebung (z. B. in der Landwirtschaft oder in der Jagd und Fischerei). Sie ist bei den Regionen am beliebtesten, weil das Konfliktpotenzial zwischen den verschiedenen Nutzungsgruppen am kleinsten ist. Trotzdem verspricht auch ein Regionaler Naturpark eine gelebte Sensibilität für die Natur- und die Kulturwerte. Sowohl bezüglich Landwirtschaft als auch bezüglich Tourismus ist ein Park eine klare Positionierung.
Ein Park weckt bei den Gästen verschiedene Erwartungen, zum Beispiel aktive und echte Naturschutzbemühungen von den Parkbetreibern. Ein authentischer natur- und kulturnaher Tourismus verträgt keine Mogelpackungen. Hinter einem Park steht eine langfristige, regionale Strategie, die von einer überzeugten Bevölkerung und den Leistungsträgern mitgetragen werden muss. Neue Parks sind für die nachhaltige Regionalentwicklung in der Schweiz eine grosse Chance. Besonders wenn Parks als Lern- und Innovationsräume verstanden werden, wo neue Produkte und bestehende Angebote die Natur- und die Kulturwerte erhalten, vermitteln und weiterentwickeln.
Kritik und Perspektiven
Natürlich gibt es auch Kritik an den Parks. Kritik, die Parkprojekte in demokratischen Prozessen scheitern liess oder zu Perimeterverkleinerungen führte, weil die Gemeinden Parkentwicklungen ablehnten. In der öffentlichen Diskussion lassen sich zwei konträre Kritiklinien unterscheiden:
Aus politisch eher rechts-konservativen Kreisen wird kritisiert, dass Parks die Entwicklungsmöglichkeiten von Randregionen einschränken. Sie würden die Selbstbestimmung der Bevölkerung untergraben, weil sie auf dem Naturschutzmotiv aufbauen und somit Entwicklungsoptionen für die Zukunft verhindern würden. Eine weitere Facette dieser Kritiklinie ist die Idee, dass über die Parks neue – von der EU gesteuerte – Entscheidungsebenen in den Regionen eingeführt werden sollen.
Vor allem aus Naturschutzkreisen kommt dagegen die Kritik, dass Parks zu reinen Wirtschaftsprojekten verkommen. Das alleinige regionalökonomische Motiv greife zu kurz, denn es müsse auch ein deutlicher Mehrwert für die Natur und die Landschaft erreicht werden, was bisher nicht der Fall sei. Beide Kritikansätze sind Grundsatzpositionen am Rand der tatsächlichen Entwicklungen und können im Dialog entkräftet werden. Viele der laufenden Projekte zeigen, dass der Mitbestimmung der Bevölkerung und der Aufwertung von Natur und Landschaft ein hoher Stellenwert beigemessen werden. Für eine abschliessende Bilanz ist es jedoch zu früh, weil der Aufbau von Parks in der Schweiz noch am Anfang steht.
Sehnsucht nach der heilen Welt
Es gibt weitere relevante Kritikpunkte, die kaum öffentlich diskutiert werden. Die Parkentwicklung widerspiegelt auch den gesellschaftlichen Wertewandel, der zum Teil zu wenig kritisch analysiert wird. Heute entscheiden viele Menschen nach immateriellen, ethischen und ökologischen Grundsätzen. Die Konsumforschung spricht in diesem Zusammenhang vom wachsenden «Lifestyle of health and sustainability» (Lohas). Dies hat Konsequenzen für viele Bereiche der Wirtschaft und der Gesellschaft: von der Architektur über das Produktedesign bis hin zum Freizeit- und Tourismusangebot. Die Attribute «gesund», «fair», «ökologisch » und «nachhaltig» werden künftig zu Handlungsmotiven in vielen Lebensbereichen. Diese Motive werden auch in die Freizeit verlagert. Gefragt sind Selbstverwirklichung, Sinn und Glück, schöne Landschaften und authentische Naturerlebnisse, die uns aus der zunehmend virtuellen, ortlosen Welt auf den «Boden» zurückbringen.[4, 5, 6] Diese Entwicklung führt tendenziell dazu, dass Naturräume als «heile Welt» und Naturkonsum als «Grüner Lifestyle» verklärt werden. Die räumlichen Konsequenzen dieser gesellschaftlichen Entwicklung spiegeln sich auch in den Parkprojekten. Parks sind in diesem gesellschaftlichen Umfeld urbane, naturromantische Konzepte, die eine dualistische Raumwahrnehmung fördern. Die Agglomerations- und Metropolitanräume entwickeln sich zu zugebauten und «identitätslosen » Alltagswelten. «Heile Naturwelten» sollen jedoch Regionalität und Identität bewahren (vgl. «Landschaft im Kopf», S. 26). Die Umsetzung von Nachhaltigkeit wird erschwert, weil durch diese «Schwarz-Weiss-Betrachtung» das ganzheitliche Verständnis für die nachhaltige Raumentwicklung verschlossen bleibt. Parks fördern die Tendenz, den ländlichen Raum museal zu romantisieren. Nachhaltiges Handeln ist nicht möglich, weil wir unseren Raum plakativ in «Gut und Böse» einteilen. Im Gegensatz zur «grauen Stadt» wird das «grüne Land» als das vermeintlich «Natürliche und ewig Gute» verklärt. Der emotionale Zugang zur Natur erhöht zwar das Bewusstsein für eine umweltverträgliche Lebensweise, aber durch das Verniedlichen der Natur wird eine nachhaltige Entwicklung behindert, vor allem weil die menschliche Nutzung und die Weiterentwicklung des ländlichen Raumes ausgeblendet werden. Diese Fragen müssen erkannt und diskutiert werden, damit Parks auch einen gesellschaftlich bedeutenden Bildungs- und Aufklärungsbeitrag leisten können.
Anmerkungen/Literatur:
[01] Das Bafu überprüft die Qualität der Parks und ihre Programme, insbesondere die Charta für die erste zehnjährige Betriebsphase. Es verleiht das Label «Park von nationaler Bedeutung», wenn ein Parkprojekt die Anforderungen erfüllt
[02] Küpfer, I.: Die regionalwirtschaftliche Bedeutung des Nationalparktourismus untersucht am Beispiel des Schweizerischen Nationalparks. Nationalpark- Forschung in der Schweiz, Nr. 90. Zernez. Dissertation Universität Zürich, 2000
[03] Ecotour: Rapporto sul Turismo Natura. Agra, 2006
[04] Wenzel, E., Rauch, C., Kirig, A.: Zielgruppe Lohas. Zukunftsinstitut GmbH. Kelkheim, 2007
[05] Romeiss-Stracke, F.: Abschied von der Spassgesellschaft. Freizeit und Tourismus im 21. Jahrhundert. Büro Wilhelm Verlag. Amberg, 2003
[06] Forster, S., Göpfert, R.: Natur- und kulturnaher Tourismus in Graubünden. Analyse und Strategie. ZHAW Fachstelle Tourismus und Nachhaltige Entwicklung, Studie im Auftrag des Amtes Wirtschaft und Tourismus AWT Graubünden, Chur, 2007
– Bosshart, D., Frick, K.: Die Zukunft des Ferienreisens – Trendstudie. Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) im Auftrag von Kuoni, 2006
– Job, H., Metzler, D., Vogt, L.: Inwertsetzung alpiner Nationalparks. Münchner Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeografie. Verlag Michael Lassleben Kallmünz. Regensburg, 2003
– Kappler, A., Forster, S., Siegrist, D.: Wertschöpfung in Naturpärken durch Tourismus. Ein praxisorientierter Leitfaden von der Strategie zum marktgerechten Angebot. Staatssekretariat für Wirtschaft Seco. Bern, 2008
– Siegrist, D., Stremlow, M. (Hg.): Landschaft Erlebnis Reisen. Naturnaher Tourismus in Pärken und Unesco-Gebieten. Rotpunkt-Verlag. Zürich, 2009
– www.umwelt-schweiz.ch (Bundesamt für Umwelt, Bafu)
– www.netzwerk-paerke.ch (Netzwerk Schweizer Pärke)
– www.iunr.zhaw.ch/tne (ZHAW Fachstelle Tourismus und Nachhaltige Entwicklung, Center da Capricorns, 7433 Wergenstein GR)
– www.naturpark-beverin.ch (Regionaler Naturpark Beverin – Kandidat Park von nationaler Bedeutung)TEC21, Fr., 2011.06.24
24. Juni 2011 Stefan Forster
Die Landschaft im Kopf
Wahrgenommene und reale Landschaft sind oft nicht identisch. Aber nur dort, wo sie übereinstimmen, kann Landschaft Identität stiften. Eine Untersuchung in Glarus Süd bestätigt diese Annahme: die Landschaft «im kopf» der Glarner besteht aus unberührter Natur- und traditioneller Kulturlandschaft ; ihr fühlen sie sich emotional verbunden, während sie die moderne Alltagslandschaft weitgehend ignorieren. Eine Landschaftsorientierte Raumentwicklung muss bei diesem blinden Fleck ansetzen.
Wahrgenommene und reale Landschaft sind oft nicht identisch. Aber nur dort, wo sie übereinstimmen, kann Landschaft Identität stiften. Eine Untersuchung in Glarus Süd bestätigt diese Annahme: die Landschaft «im kopf» der Glarner besteht aus unberührter Natur- und traditioneller Kulturlandschaft ; ihr fühlen sie sich emotional verbunden, während sie die moderne Alltagslandschaft weitgehend ignorieren. Eine Landschaftsorientierte Raumentwicklung muss bei diesem blinden Fleck ansetzen.
Landschaft und Identität werden in der Planung und der Forschung zunehmend miteinander in Verbindung gebracht. In Entwicklungskonzepten der Raum- und Regionalentwicklung wird die Bedeutung der Landschaft für die Identität einer Region respektive die Identifikation gerne in Leitsätzen angeführt. Doch wie lassen sich diese Grundgedanken konkret in Planungsprozesse einbeziehen und für eine landschaftsorientierte Raumentwicklung nutzen? Und lässt sich die identitätsstiftende Funktion der Landschaft wissenschaftlich nachweisen?
Diese Fragen standen im Zentrum einer dreijährigen Studie[1], die sich mit Landschaft, Landschaftsbewusstsein und landschaftlicher Identität befasste und dies am Beispiel der Region Glarus Süd empirisch untersuchte. Diese periphere Bergregion eignete sich als Modellregion sehr gut, weil die Frage nach der Identität im Zuge der Fusion zur Einheitsgemeinde besonders interessant ist und weil sie auf engem Raum grundsätzliche Probleme der Kulturlandschaftsentwicklung aufweist: Einerseits Zersiedelungsphänomene und gefährdetes kulturelles Erbe in den gut erschlossenen Talgebieten, andererseits Tendenzen der Nutzungsaufgabe in den ausgedehnten Alpgebieten der höheren Lagen. Diese gegenläufigen Trends reduzieren die Vielfalt der Kulturlandschaften.
Emotionale Qualität berücksichtigen
Landschaft wird heute nicht mehr als rein geografischer Raum verstanden, der das dynamische Ergebnis natürlicher und kultureller Prozesse ist. Vielmehr beinhaltet der Begriff auch innere Vorstellungsbilder der Menschen. Die Europäische Landschaftskonvention (ELC)[2] definiert: «Landscape means an area, as perspectived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors», und räumt den gesellschaftlichen Leistungen der Landschaft, die sie als Kultur-, Lebens- und Identifikationsraum erbringt, einen hohen Stellenwert ein. Ihre Forderung nach einer nachhaltigen Landschaftsentwicklung bedeutet daher in der planerischen Umsetzung, auch die ästhetischen und emotionalen Qualitäten von Landschaften zu berücksichtigen.
Ausgehend von diesem transdisziplinären Landschaftsverständnis kommt die «Landschaft im Kopf» ins Spiel. Diese ist von kulturellen Idealen, Werten, Gefühlen und Erfahrungen geprägt und wird durch unsere sinnliche Wahrnehmung vermittelt. Was wir an inneren Bildern von Landschaft produzieren, stimmt daher oft kaum mit unserer realen Landschaft überein. Idealisierte Alpenblüemli-Berge-Heidi-Postkarten können als ein Ausdruck dieses «Bruchs» im Landschaftsverständnis verstanden werden.
Die Studie ging von der Hypothese aus, dass sich landschaftliche Identität[3] respektive Identifikation mit der Landschaft dort entwickeln kann, wo sich reale und vorgestellte Landschaft überlagern (Abb. 1). Im ersten Teil der Studie wurden die theoretischen Grundlagen für die Arbeit mit einem umfassenden Landschaftsverständnis geschaffen – ein etabliertes Theoriekonzept gab es dafür bisher nicht. Der zweite Teil umfasst die Fallstudie in Glarus Süd, mit der die Zusammenhänge zwischen Landschaft, Landschaftsbewusstsein und Identität empirisch untersucht wurden. Dafür wurde die physische Gestalt der Landschaft analysiert und beschrieben und das Landschaftsbewusstsein der Bevölkerung mit einer quantitativqualitativen Telefonbefragung ermittelt. Geografische Landschaft und innere Bilder der Bevölkerung wurden so sichtbar gemacht, miteinander in Bezug gesetzt und auf ihr Identifikationspotenzial untersucht. Daraus wurden im dritten Teil Ansätze für die landschaftsorientierte Raumentwicklung formuliert und die Übertragbarkeit auf ähnliche Anwendungsfelder diskutiert. Im Folgenden werden einige dieser Ansätze sowie Auszüge aus den Ergebnissen der Fallstudie vorgestellt.
Romantisiertes Idealbild
Um Landschaftsvorstellungen und -bindungen der Bevölkerung zu ermitteln, wurden in Glarus Süd 324 zufällig ausgewählte, in der Region wohnhafte Personen telefonisch befragt.[6] Dies ergab ein gutes Gesamtbild im Sinne der Repräsentation. Die Befragung war primär quantitativ ausgerichtet und die meisten Fragen standardisiert. Sie bezogen sich auf die vier Themenfelder: Wohlbefinden und Raumbezug / Landschaftsverständnis / Wirkung der Landschaft / Wahrnehmung und Beurteilung von Landschaftsveränderungen. Für die Befragung wurde ein Fragebogen entwickelt, der auf die spezifischen Landschaftstexturen[7] von Glarus Süd Bezug nahm, um das Landschaftsbewusstsein auch im Hinblick auf die reale Umgebung interpretierbar zu machen.
Die Frage «Was gehört für Sie persönlich zu Landschaft?» zielte aber zunächst auf die generellen inneren Bilder von Landschaft. Die Antworten darauf machten deutlich, dass Elemente der wilden, unberührten Naturlandschaft und der traditionellen Kulturlandschaft das Landschaftsverständnis klar dominieren: Sie machten drei Viertel aller Nennungen aus. Als natürliche Elemente wurden am häufigsten Berge, Wald, Gewässer und Natur genannt, bei den Elementen traditioneller Kulturlandschaften waren es Wiesen, Weiden, Alpen und Landwirtschaft. Auch ästhetische und emotionale Landschaftsqualitäten wie Einfachheit, Schönheit, Ruhe, Heimat, Freiheit, Ursprünglichkeit, Naturbelassenheit oder Abgeschiedenheit kamen häufig vor. Hingegen fielen zivilisatorische Elemente wie Siedlungen, Infrastruktur- anlagen oder Industrie deutlich ab.
Es zeigt sich eine schöne, heile, ländliche Kulturlandschaft in den Köpfen der Befragten. Diese romantisierte Vorstellung von Landschaft ist jedoch keineswegs spezifisch für Glarus Süd. Auch andere Befragungen[8,9] haben dieses Idealbild ländlicher Kulturlandschaft als innere Bilder in ihren Ergebnissen gespiegelt. Es scheint, dass ein Zwiespalt zwischen der realen modern-zivilisatorisch geprägten Landschaft und der verbreiteten Vorstellung von Landschaft besteht, die – etwas pointiert ausgedrückt – beiden agrarisch geprägten Landschaften der 1950er-Jahre stehengeblieben ist.
Ein ähnliches Ergebnis ergab auch die Frage nach der Wahrnehmung der spezifischen Landschaft von Glarus Süd. Dabei konnten die Befragten insgesamt 27 Landschaftselemente, -faktoren sowie Produkte, die einen Bezug zur Landschaft Glarus Süd haben, den Kategorien «einzigartig», «typisch», «normal»[10] oder «nicht zur Landschaft gehörend», zuordnen (Abb. 4). Interessant waren insbesondere die Zuschreibungen zur typischen beziehungsweise zur normalen Landschaft:
Die typische Landschaft erscheint in den Vorstellungen als heile, von der Geschichte geprägte Ideallandschaft mit Heu- und Viehalpen, Bergen und Tälern, Felsen, Dörfern, Textilfabriken und Fabrikantenvillen, aber auch Wasser, Streusiedlungen und alten Dorfkernen. Die normale Landschaft hingegen ist im Verständnis der Befragten die funktions- und nutzungsbezogene Alltagslandschaft, die vorwiegend von der Gastronomie, Verkehrs-, Erholungs- und Energieinfrastruktur geprägt ist, aber auch von Kleinstrukturen und Naturereignissen.
Die Ergebnisse zeigen eine Spaltung von wahrgenommener schöner, naturnaher Landschaft und wahrgenommener funktionaler Alltagslandschaft, die nachfolgend auch beider empfundenen Wirkung der Landschaft deutlich wird.
Emotionale Wirkung der Landschaft
Über 90 Prozent der Befragten empfinden die Wirkung ihrer Landschaft als positiv. Das bestätigt die Bedeutung der Landschaft als emotionale Ressource. Dieses Ergebnis wurde mit einer offenen Frage nach den persönlich wichtigsten Elementen ihrer Landschaft konkretisiert. Es zeigte sich, dass den Befragten die Naturlandschaft von Glarus Süd am wichtigsten ist. Topografie, Klima und Gewässer machten rund die Hälfte aller Nennungen aus. Darauf folgten Elemente der traditionellen agrarischen Kulturlandschaft. Dem schloss sich die Frage an, welche Gefühle diese für die Befragten wichtigen Landschaftselemente und -eigenschaften bei ihnen auslösen. Von den Antworten, die tatsächlich emotionale Wirkungen betrafen, waren wiederum 635 Nennungen positiv und lediglich 32 negativ. Es liessen sich klar drei Wirkungsfelder der Landschaft herauskristallisieren, die am häufigsten genannt wurden:
1. Identifikation (Verbundenheit – Zuhausefühlen – Heimatgefühl)
2. Zufriedenheit – Friede – Glück
3. Ruhe – Stille – Abgeschiedenheit
Den höchsten Stellenwert hatte die identitätsstiftende Wirkung der Landschaft. Doch auch Zufriedenheit und Ruhe können sich stabilisierend und damit positiv auf die persönliche Identität auswirken. Diese positiven Empfindungen schreiben die Befragten jedoch überwiegend der Natur- und der traditionellen Kulturlandschaft zu, also der als typisch wahrgenommenen Landschaft. «Normale», moderne Alltagslandschaften werden im Zusammenhang mit Gefühlen weitgehend ignoriert – sie haben bisher kaum emotionales Bindungspotenzial.
Innere Landschaftsbilder in Planungsprozesse einbeziehen
Die empirischen Untersuchungen bestätigten die These der Studie, dass Identifikation dort stattfinden kann, wo die geografische Landschaft und die inneren Bilder einer schönen Natur- und traditionellen Kulturlandschaft korrespondieren. Die Befragung hat gezeigt, dass dort positive Gefühle ausgelöst werden und dass die Bevölkerung diese Landschaften für die Identifikation und das Wohlbefinden sehr schätzt. Dies ist ein wichtiger Schlüssel, der in Planungsprozessen neue Potenziale eröffnen kann. Die Studie hat aber auch die blinden Flecken im Landschaftsbewusstsein zum Vorschein gebracht: Wenn die Befragten zum Bei spiel historische Industriegebäude trotz ihrer geschichtlichen Bedeutung zwar als typisch, aber nicht als wichtig beurteilen oder moderne Industriegebäude und landschaftliche Kleinstrukturen aus der Landschaft ausschliessen.[10]
Bezogen auf die Alltagslandschaften bedeutet dies, dass es einerseits ihre emotionalen Qualitäten zu fördern gilt und andererseits innere Bilder und Gefühle der Bevölkerung in Bezug auf ihre Landschaft sichtbar und diskutierbar gemacht werden müssen. Dazu gehört auch, dass Landschaftsentwicklungen erfahrbar und vorstellbar werden und dass ihr Einfluss auf die emotionale Wirkung der Landschaft in die Diskussion um die zukünftige Raumentwicklung einfliessen muss.
Ansätze für die landschaftsorientierte Raumentwicklung
Auf der Basis dieser Ergebnisse lassen sich folgende Ansätze für die landschaftsorientierte Raumentwicklung und die Stärkung landschaftlicher Identität formulieren, die sich auch auf andere Kulturlandschaften anwenden lassen: 1. Natur- und traditionelle Kulturlandschaften haben eine wichtige Funktion für die Verbundenheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung. Sie in den Alltagsumgebungen als Identifikations- und Erholungsräume zu stärken – auch im Bewusstsein der Bevölkerung – , ist eine zentrale Herausforderung der Raumentwicklung. In der neuen Einheitsgemeinde Glarus Süd würde das unter anderem bedeuten, der fortschreitenden Zersiedelung im Talgebiet entgegenzuwirken, indem Grünräume zwischen den Ortschaften raumplanerisch freigehalten und als attraktive Erholungsräume gestaltet werden. Dies bedingt auch einen Dialog mit der Bevölkerung über die Bedeutung der Grünräume im Rahmen der nun anzugehenden Nutzungsplanung für die fusionierte Gemeinde. So lassen sich auch die Standortfaktoren Wohnen und Erholung in Glarus Süd stärken.
2. Naturnahe Gewässer haben eine sehr positive emotionale Bedeutung für die Bevölkerung. Durch die Freihaltung und Renaturierung von Flussabschnitten und Bächen können Forderungen des präventiven Hochwasserschutzes ideal mit der Schaffung naturnaher Erholungsräume verbunden werden. Die Gefahrenkarte von Glarus Süd weist die Gebiete mit erheblichem oder mittlerem Gefahrenpotenzial für Überschwemmungen aus. Dort Retentionsräume zu schaffen, die konsequent freigehalten und als naturnahe Erholungsräume gestaltet und zugänglich gemacht werden, ermöglicht Gefahrenprävention und zugleich Attraktivitätssteigerung für die Bevölkerung.
3. Im Umgang mit kulturellem Erbe steckt ein hohes Identifikationspotenzial: Kulturell bedeutende Landschaftselemente wie historische Industriegebäude können eine positive Symbolwirkung erzeugen, wenn ihr Wert kommuniziert, ihre Besonderheit erhalten und sie mit neuen Funktionen verbunden werden können. In Glarus Süd sind diese eindrücklichen Industrieensembles in einer alpinen Landschaft noch erhalten. Auch wenn sie heute von der Bevölkerung eher als Mahnmale des wirtschaftlichen Niedergangs empfunden werden und vom Abriss bedroht sind, sind sie Ausdruck der Geschichte des Glarnerlandes und damit bedeutendes kulturelles Erbe. Sie könnten eine Neubelebung und Neuinterpretation erfahren, die für die Identität von Glarus Süd Zeichen setzt – nach innen und nach aussen; beispielsweise durch den Aufbau eines Angebots im Segment Industrietourismus. Um die Bedeutung der Landschaft als Ressource für Identität und Wohlbefinden in konkreten Planungen zu stärken, sind partizipative Prozesse[11] mit der Bevölkerung und mit politischen Entscheidungstragenden notwendig.
Anmerkungen:
[01] Christine Meier und Annemarie Bucher: Die zukünftige Landschaft erinnern. Eine Fallstudie zu Landschaft, Landschaftsbewusstsein und landschaftlicher Identität in Glarus Süd. Bristol Stiftung, Zürich; Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 2010
[02] Council of Europe: European Landscape Convention (ELC). Strassburg, 2000
[03] Den Begriff «Landschaftliche Identität» lehnen die Autorinnen an denjenigen der «räumlichen respektive der raumbezogenen Identität» an, wie ihn Weichhart[4] und Ipsen[5] verwenden, beziehen ihn jedoch auf eine konkrete Landschaft
[04] Peter Weichhart: Raumbezogene Identität. Bausteine zu einer Theorie räumlich-sozialer Kognition und Identifikation. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1990
[05] Detlev Ipsen: Regionale Identität. In: Lindner, R. (Hg). Die Wiederkehr des Regionalen. Über neue Formen kultureller Identität. Campus Verlag, Frankfurt am Main, 1994
[06] Die Befragung wurde vom Institut cultur prospectiv, Zürich, wissenschaftlich begleitet
[07] Die Gestalt der geografischen Landschaft, deren verschiedene Aspekte durch natürliche und kulturelle Prozesse entstanden sind, kann als Gesamtgewebe verstanden werden. Die Autorinnen bezeichnen und beschreiben diese Aspekte als Landschaftstexturen und verstehen sie als landschaftliche Oberflächen, wie sie beispielsweise das Wasser, die Industriekultur oder die Siedlungstätigkeit geschaffen haben. Sie ergeben gemeinsam die Gesamttextur der Landschaft, die wie beim Textilstoff aus dem Zusammenweben verschiedener «Fäden» entstanden ist
[08] Gerhard Hard: Landschaft und Raum. Aufsätze zur Theorie der Geographie. Band 1. Osnabrücker Studien zur Geographie, 22. Universitätsverlag Rasch, Osnabrück, 2002
[09] Olaf Kühne: Landschaft der Postmoderne. Das Beispiel des Saarlandes. Dissertation Fernuniversität Hagen. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden, 2006
[10] Unter «normal» verstehen wir Elemente, die nichts Spezielles sind für Glarus Süd, sondern überall vorkommen
[11] Christine Meier und Matthias Buchecker: Soziokulturelle Aspekte der Landschaftsentwicklung. Grundlagen für das Projekt Landschaft 2020 des Buwal. Schriftenreihe Umwelt und Natürliche Ressourcen der ZHAW Wädenswil, Nr. 1, 200TEC21, Fr., 2011.06.24
24. Juni 2011 Christine Meier