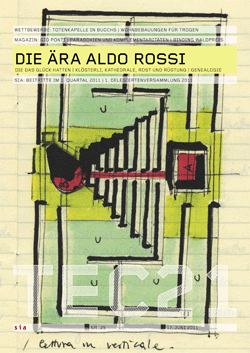Editorial
Es gilt als Binsenweisheit, dass die Mailänder Architektur eine Sogwirkung auf die Deutschschweizer Baukunst ausübte. Welche Folgen aber zeitigte sie? archi und TEC21 widmen sich je einem Protagonisten aus der Gilde jener Architekten, die der «Italianità» in der Schweiz Tür und Tor geöffnet haben: Luigi Moretti und Aldo Rossi. Während die Studierenden an der ETH nach Mailand und ins Umland pilgerten, um die Werke des «Razionalismo» in Augenschein zu nehmen, «emigrierte» Aldo Rossi in den 1970er-Jahren nach Zürich zu zwei Gastspielen an der ETH, die als legendär überliefert sind: «Aldo Rossis Auftritt an der ETH schlug ein wie eine Bombe», erinnert sich etwa Peter Märkli, der dem Urheber von «L'architettura della città» und «La città analoga» attestiert, ein Vakuum gefüllt zu haben. Märkli schliesst seinerseits in unseren beiden Zeitschriften gleichsam eine Lücke («Al piano nobile passando dalla scala di servizio» – «Über die Hintertreppe in das piano nobile», archi, S. 62–67): Obwohl oder gerade weil nicht eigentlich in Rossis Bann geschlagen und nicht auf dem kürzesten Weg nach Mailand gelangt, weiss er um beider Wirkung. Auf einen konzisen Nenner bringt sie auch der gleichaltrige Miroslav Šik: «Das Hin und Her zwischen Aldo Rossi und einer als Rationalismus des Mittelmeerraums verstandenen Moderne charakterisiert unsere zweite Rossi-Generation. Einerseits lesen wir Rossis Theorie und befolgen seine Entwurfsmethode, mischen jedoch andererseits und in zunehmendem Mass Rossis Formen mit der Architektur von Giuseppe Terragni und anderen Rationalisten.»[1] Er tut dies in dem Buch «Aldo Rossi und die Schweiz», das in Kürze im gta Verlag erscheint und von dem wir hier Auszüge publizieren dürfen. Sie befassen sich mit der Lehre («Die das Glück hatten, ihn zu kennen»), mit einem vergessenen Projekt des Meisters in Bern («Klösterli, Kathedrale, Rost und Rüstung») und mit seiner Nachwirkung («Genealogie – Aldo Rossi und Herzog & de Meuron»).
Sie legen Zeugnis ab vom Faszinosum Aldo Rossi, der das paradox anmutende Kunststück fertigbrachte, mittels Architektur jene politischen Wogen im Nachgang der 1968er-Jahre zu glätten, zu deren Strom er in Italien auch gehört hatte. Sie ziehen uns in «seine labyrinthische Welt unzähliger Lektüren und Kuriositäten»[2]. Und sie erweisen ihm vielleicht die grösste Ehre durch den «symbolischen architektonischen Vatermord»: «Heute ist Aldo Rossi gestorben.»[3] Es lebe Aldo Rossi!
Rahel Hartmann Schweizer
Anmerkungen:
[01] Miroslav Šik, «Lernen von Rossi», in: Ákos Moravánszky, Judith Hopfengärtner (Hg.): Aldo Rossi und die Schweiz – Architektonische Wechselwirkungen. gta Verlag, Zürich 2011, S. 69–76
[02] Bruno Reichlin, «Amarcord» – Erinnerung an Aldo Rossi». Ebd. S. 29–44
[03] Diogo Seixas Lopes, «South of No North» – Rossi und Portugal». Ebd., S. 131–142