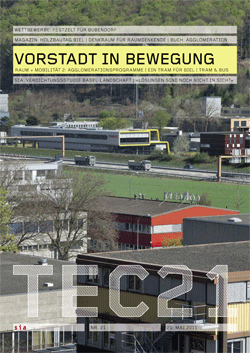Editorial
Drei Viertel der Bevölkerung in der Schweiz leben in der Agglomeration. Trotz ihrer Bedeutung als Lebens- und Arbeitsraum wird diese erst ansatzweise als Realität anerkannt. In den letzten zehn Jahren ist immerhin das Bewusstsein für die Probleme der Agglomeration gewachsen. Im April 2011 hat sich der Bundesrat dafür ausgesprochen, die bisherige Agglomerationspolitik weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck hat er das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) und das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) beauftragt, ihm 2014 einen Vorschlag zu unterbreiten, wie die Agglomerationspolitik des Bundes ab der Legislaturperiode 2016–2019 ausgerichtet sein soll.
Es gibt indes ein Planungsinstrument, das bereits jetzt einiges in Bewegung gebracht hat: Mit den Agglomerationsprogrammen sollen Siedlungs- und Verkehrskonzepte über politische Grenzen hinweg aufeinander abgestimmt werden. Die Gewährung der Bundesmittel aus dem Infrastrukturfonds ist an die Voraussetzung gebunden, dass die Regionen jeweils ein verbindliches und in sich stimmiges Agglomerationsprogramm vorlegen. Neu in der schweizerischen Planungsgeschichte ist, dass die Wirksamkeit der Bundesfranken geprüft und sie nicht einfach mit der Giesskanne verteilt werden. Im September 2010 entschied das Parlament über die Freigabe der Mittel. Es bestand das Risiko, dass aufgrund regionalpolitischer Interessen das Paket aufgeschnürt würde, doch dem war nicht so: Dank der Transparenz in Bearbeitung und Bewertung wurde das Programm als ausgewogen angesehen und ohne grosse Diskussionen genehmigt.
Was sich hinter dem trockenen Begriff «Agglomerationsprogramm» verbirgt, was sich in den letzten zehn Jahren bewegt hat und wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll, zeigt der Artikel «Ein Programm für die Agglomerationen» auf. Wie sind Siedlung und Verkehr aufeinander abzustimmen? Wie kann man den wachsenden Mobilitätsansprüchen in der Agglomeration gerecht werden? Welches ist das richtige Verkehrsmittel für den richtigen Ort? Hier gibt es grosse Unterschiede zwischen der subjektiven Wahrnehmung der Nutzerinnen und Nutzer und den technischen Möglichkeiten. «Mit Bus und Tram durch dichte Räume» vergleicht Vor- und Nachteile von Bus- und Tramsystemen. Vor der Frage «Bus- oder Tram-» steht auch die Stadt Biel. Vor rund 70 Jahren wurde hier das Tram aus der Stadt verbannt, weil man es für zu altmo-disch befand. Heute wird darüber diskutiert, ob es zurückkommen soll (vgl. «Tramrenaissance in der Autostadt Biel?»). Vielleicht kann ein iden-titätsstiftendes Tram dazu beitragen, die Umgebung von Biel nicht zu einer gewöhnlichen Agglomeration, sondern zur Vorstadt werden zu lassen.
Daniela Dietsche