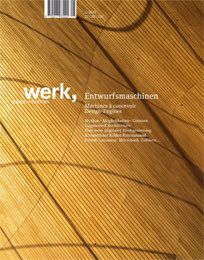Editorial
Entwurfsmaschinen
«Für den Bereich der Architektur sind die Symbolsysteme, die elektronisch gespeist und gesteuert werden, wesentlich wichtiger als die wissenschaftlich-technischen Grundlagen der Elektronik selbst. Das drängendste technologische Problem unserer Zeit stellt sich überall dort, wo es gilt, ein humaneres Ineinandergreifen fortgeschrittener wissenschaftlich-technischer Systeme und unserer unperfekten und erschöpften menschlichen Systeme zustande zu bringen…» In Robert Venturis 1972 erschienener Untersuchung zur Ikonographie von Las Vegas ist diese zitierte Stelle nur eine Nebenbemerkung. Vor dem heutigen Hintergrund einer mit Beliebigkeit ringenden Architektur erscheint sie jedoch wie ein Menetekel: Der Einsatz des Computers hat dazu geführt, dass fast jede Form in der Architektur machbar geworden ist – eine Situation, die für die Zeit, als «Learning from Las Vegas» erschien, durch Venturi ähnlich diagnostiziert worden ist. Heutige Gebäude erinnern in ihrer oft autistischen Formensprache stark an Venturis «Enten».
Es erstaunt daher nicht, dass – vorwiegend junge – Architekten nach Mitteln suchen, um das gestalterische Einerlei zu überwinden. Und gerade hier verspricht der Computer einen möglichen Ausweg. Technik und Programmalgorithmen sind inzwischen so weit entwickelt, dass einfache Entwurfsaufgaben durch Automaten gelöst werden können. Das Versprechen, das sich hinter der fortgeschrittensten Technik verbirgt, zielt nicht zuletzt darauf, den Architekten als Demiurg moderner Enten zu entmachten und der Architektur etwas von der Unschuld der Bauhütte zurückzugeben – eine Hoffnung, die der Arbeitsteilung zwischen Ingenieur und Architekt seit der Moderne innewohnt. Doch jenseits von romantisch verklärendem Zukunftsglauben ist der Computer tatsächlich zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel im Entwurf geworden und vermag unsere «unperfekten und erschöpften menschlichen Systeme» sogar gut zu unterstützen.
In den Gesprächen zur Vorbereitung des vorliegenden Hefts war stets von Qualität die Rede. Von der Art und Weise, das Versprechen unbegrenzter technischer Machbarkeit zu hinterfragen und architektonische Qualität zu wahren, handelt der einleitende Beitrag von Georg Vrachliotis. Dass Qualität in der Architektur etwas mit kreativer und rechnerischer Optimierung zu tun hat, zeigt Fabian Scheurer. Urs Hirschberg demonstriert anhand mehrerer Forschungsprojekte, dass – um entwerferische Qualität zu erhalten – wir nicht umhin kommen, bewusst zu bestimmen, wie und womit wir entwerfen. Jörg Gleiter legt dar, dass gerade das computergenerierte Entwerfen in seiner vordergründigen Zukunftsorientierung dringend sein Verhältnis zur Geschichte klären muss. Und im Gespräch mit Ede Andràskay, Dieter Dietz und Steffen Lemmerzahl wird deutlich, worum sich die Suche nach einem qualitativ besseren Umgang mit dem Computer zu drehen hat, ganz im Sinne Robert Venturis: um Selbstverständlichkeit und Normalität.