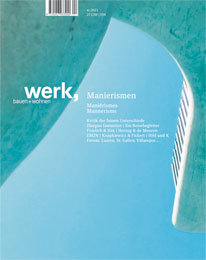Editorial
Manierismen
Genügend zeitliche Distanz erlaubt in der Regel eine verlässlichere Bewertung vergangener Ereignisse. So sehr wir uns um Objektivität bemühen mögen, bleibt doch jedes Urteil in unserer eigenen Zeit verhaftet, und der Blick in die Geschichte deshalb alles andere als vorurteilsfrei. Diesem Phänomen begegnen wir auch in der Architekturgeschichtsschreibung, die von Epoche zu Epoche, ja von Generation zu Generation das in der Gegenwart der Architektur verkörperte Vergangene mit neuen Augen betrachtet. Solche historische Prozesse sind träge und dauern lange. Anders verhält es sich bei der Architekturkritik, die sich in schnellerem Rhythmus äussert. Sie beobachtet, analysiert, wertet, ergreift Partei und dient im besten Fall einem in Fachkreisen und öffentlich geführten Diskurs. Dies entbindet die Kritiker jedoch nicht, sich im Labyrinth der Architekturgeschichte zurecht zu finden, die sie zu Vergleichszwecken immer wieder konsultieren müssen. Sensible Architekturkritik ergründet Qualitäten und entlarvt Schaumschlägerei. Sie erkennt unter Umständen Tendenzen ohne dabei zum modischen Trendsetter zu werden. Im vorliegenden Heft ist nicht von einem Trend die Rede, aber wir wagen, mit den "Manierismen" einen Jahrhunderte alten Ansatz und künstlerischen Ausdruck aufzugreifen, der in Strategien und formalen Konzepten gegenwärtiger Architektur zunehmend eine Rolle zu spielen scheint. Dabei haften den Manierismen kaum negative Konnotationen an, wie sie die Kritik der letzten fünf Jahrhunderte zuweilen formuliert hat.
Michael Gnehm erinnert in seinem einleitenden Aufsatz daran, wie über die Zeit hinweg Anerkennung und Geringschätzung dessen, was gute zwei Jahrhunderte nach Vasaris "maniera" als "Manierismus" in die Kunstgeschichte Eingang fand, wechselten. Mit aufgesetzter Manieristenbrille sichtet Martin Saarinen die zeitgenössische Architektur und ortet mit beherzt gesetzten Begriffen, wo "gestalterische Urgebärden" aufeinander treffen oder mit Manierismen Konventionen unterwandert werden. Analytisch und assoziativ zugleich haben Architekturstudenten in Winterthur unter der Leitung von Tibor Joanelly einen Reisebegleiter zu den Charakteristiken der Manierismen zusammengestellt. In einem Gespräch erläutern Andreas Hild und Dionys Ottl von HildundK wie ihre Suche nach entwerferischen Spielräumen häufig zu Strategien führt, die der ursprünglichen «maniera» ähnlich sind.
Wir stellen schliesslich eine Reihe von Bauten vor, bei denen wir – im Einklang mit den Architekten – unterschiedlich begründete und verschieden artikulierte Manierismen aufzuspüren meinen: Eine grosse Wohnsiedlung von Knapkiewicz & Fickert in Zürich, ein Hotel von EM2N in Zug, ein Parkhaus von Herzog & de Meuron in Miami, und ein Kabinettstück von Froelich & Hsu in Brugg.
Manierismen sprechen eine eigene Sprache, die fern jeder Manieriertheit offenbar mehr und mehr an Terrain gewinnt. Aber Kategorisierungen sind inspirierend und fragil zugleich. Auch diese Einsicht mag dieses Heft einmal mehr bekräftigen.
Die Redaktion