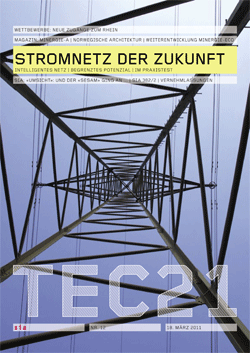Editorial
Selten gehen die Meinungen zu einem Heftthema innerhalb der Redaktion so auseinander, wie es beim beginnenden Umbau des heutigen Stromnetzes zu einem intelligenten Netz, auch Smart Grid genannt, der Fall ist. Die Aussicht, dass der eigene Energieverbrauch künftig laufend an den Energieversorger übermittelt wird und wir als Stromkunden angehalten sind, unseren Verbrauch der Erzeugungskurve anzupassen, weckt bei den einen Faszination angesichts neuer Technologien sowie Spielfreude beim Umgang mit intelligenten Anzeigen und Haushaltsgeräten. Bei den anderen ruft diese Vision hingegen eine vehemente Ablehnung solcher Eingriffe in die persönliche Freiheit hervor und schürt Ängste vor der Überwachung der Lebensgewohnheiten.
Fakt ist, dass die Liberalisierung des Strommarktes und der steigende Anteil erneuerbarer Energie diesen Markt grundlegend verändern. Zunehmende Stromtransporte über weite Entfernungen sowie die schwankende und dezentrale Einspeisung aus Anlagen für die Erzeugung erneuerbarer Energie erfordern einen Um- und Ausbau des Stromnetzes (vgl. «Intelligentes Netz»). Das sind lukrative Aussichten für alle, die an den dafür notwendigen Invesititionen verdienen. Entsprechend stark engagieren sich die betroffenen Branchen für Smart-Grid-Aktivitäten. Auch die Politik hat deren wirtschaftliche Bedeutung erkannt und fördert die Realisierung von Smart Grids beispielsweise durch die Finanzierung von Pilotprojekten (vgl. «Im Praxistest»).
Die Erfahrungen aus diesen Projekten zeigen, dass für den Erfolg von Smart Grids die erforderliche Technologie nur ein Faktor ist. Genauso wichtig, wenn nicht ausschlaggebend, ist die Akzeptanz durch die Stromkunden. Die Synchronisation von Energieerzeugung und -verbrauch lässt sich nur umsetzen, wenn der Kunde bereit ist, mitzuwirken und z.B. den Rasen erst mittags zu mähen, wenn die Fotovoltaikanlage auf Hochtouren läuft – etwas, um das er sich bisher nie kümmern musste und das ihm bei den derzeitigen Strompreisen auch nur minimale finanzielle Vorteile bringt.
Seriöse Kosten-Nutzen-Abwägungen braucht es auch auf Seite der Energieversorger: Wie gross ist das Potenzial zur Verschiebung von Lastspitzen im Vergleich zum zusätzlichen Stromverbrauch der intelligenten Komponenten und zum finanziellen Aufwand für die Umrüstung (vgl. «Begrenztes Potenzial»)?
Schliesslich müssen auch die Ängste betreffend Datenschutz und Störanfälligkeit solcher Systeme ernst genommen werden. Je mehr das Stromnetz über Informations- und Kommunikationstechnolo-gie gesteuert wird, umso gravierender wirken sich Computerpannen aus und umso anfälliger wird das System für Hacker-Angriffe. All diesen Ängsten und Gefahren lässt sich nur begegnen bzw. vorbeugen, wenn die Einführung von Smart Grids nicht überstürzt, sondern sorgfältig und umfassend angegangen wird.
Claudia Carle
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Neue Zugänge zum Rhein
12 MAGAZIN
Mit Minergie-A zum Nullenergiehaus | Norwegische Architektur 1945–1965 | Weiterentwicklung von Minergie-Eco
20 INTELLIGENTES NETZ
Thilo Krause Die Liberalisierung des Strommarktes und die zunehmende Einbindung erneuerbarer Energiequellen werden Energieerzeugung und -verteilung in den nächsten Jahren grundlegend verändern.
24 BEGRENZTES POTENZIAL
Lukas Küng Das Potenzial für Lastmanagement, also die aktive Steuerung bzw. zeitliche Verschiebung des Stromverbrauchs, ist begrenzt und für die Kunden teilweise mit Kompromissen verbunden.
27 IM PRAXISTEST
Claudia Carle Beim deutschen Pilotprojekt «MeRegio» wird stufenweise ein Smart Grid aufgebaut, um Erfahrungen mit dem Verhalten der angeschlossenen Kunden und den technischen Komponenten zu sammeln.
31 SIA
Und der «Sesam» ging an ... | Paradigmenwechsel mit der SIA 382/2 | Vernehmlassungen
35 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Intelligentes Netz
Die Liberalisierung des Strommarktes und die zunehmende Einbindung erneuerbarer Energiequellen mit ihrer schwankenden Einspeisung werden Energieerzeugung und -verteilung in den nächsten Jahren grundlegend verändern. Um die Netze auch unter neuen Rahmenbedingungen sicher und stabil betreiben zu können, müssen Stromerzeuger und -verbraucher über Informations- und Kommunikationstechnologien zu einem Smart Grid, einem intelligenten Stromnetz, miteinander vernetzt werden.
Traditionell waren Energieversorgungssysteme von «zentralistischen» Strukturen geprägt: Elektrizität wurde in Grosskraftwerken (Kernkraftwerke, Wasserkraftwerke etc.) produziert, dann über das Übertragungsnetz über weite Strecken transportiert, um schliesslich in Verteilnetzen kleinflächig bis zum Endkunden zu gelangen (Abb. 1). Vor der Liberalisierung waren sowohl Kraftwerke als auch Netze meist in der Hand eines Unternehmens, des Gebietsmonopolisten. Heute hingegen sind Kraftwerks- und Netzinfrastruktur grösstenteils buchhalterisch oder eigentumsrechtlich voneinander getrennt. Aufgrund des damit verbundenen freien Netz- und Marktzugangs haben sich die Strukturen im Energieinfrastrukturbereich weltweit verändert. Elektrizität wird an Strombörsen angeboten bzw. ersteigert. Auch der ökologische Mehrwert von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen wird heutzutage über Herkunftsnachweise oder indirekt über Emissionszertifikate flexibel gehandelt. Zudem wurden weitgreifende Anreizsysteme zur Förderung von erneuerbaren Energien geschaffen, um der Endlichkeit fossiler Energieträger und dem Klimawandel Rechnung zu tragen. In der Summe aller Massnahmen haben die Stromeinspeisungen aus Wind, Fotovoltaik, Biomasse etc. signifikant zugenommen.
Die vermehrte Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien ist dabei nicht an eine einzelne Netzebene gebunden (Abb. 1). Grosse Windparks (off-shore und on-shore) werden direkt ans Übertragungsnetz (die «Stromautobahnen») angeschlossen, während kleinere Anlagen in tiefere Netzebenen integriert werden. Fotovoltaik- und Kraft-Wärme- Kopplungsanlagen beispielsweise findet man bis hinunter ins Verteilnetz (die «Quartierstrassen des Stroms»).
Der Stromkunde wird zum Stromlieferanten …
Damit wird zunehmend auch dort Strom erzeugt, wo bisher ausschliesslich die Stromnachfrage der Endkunden zu decken war. Die Einspeisung auf niedrigeren Netzebenen kann dazu führen, dass sich der Lastfluss umkehrt, d. h., dass aus tieferen Spannungsebenen (Verteilnetz) an höhere Netzebenen (Übertragungsnetz) zurückgespeist wird, entgegen dem ursprünglichen Systemverhalten mit Lastfluss nur in eine Richtung, von den Grosskraftwerken zum Kunden. Da Stromproduktion und -verbrauch immer im Einklang sein müssen, wird die Aufrechterhaltung der Netzstabilität und der Versorgungssicherheit mit einer zunehmenden Anzahl von Erzeugern auf verschiedenen Ebenen und mit einem hohen schwankenden Erzeugungsanteil aus erneuerbaren Quellen wesentlich komplexer. Sie bedingt den ständigen Austausch von Informationen zwischen allen beteiligten Stromerzeugern und -verbrauchern sowie den nur begrenzt vorhandenen Stromspeichern. Dieses Netz der Zukunft, in dem Informations- und Kommunikationstechnologien eine zentrale Rolle spielen, wird als «intelligentes Netz» oder «Smart Grid» bezeichnet (Abb. 2).
… Und Trägt zum sicheren Netzbetrieb bei
Ein Element intelligenter Netze sind Smart Meters, intelligente Stromzähler, mit denen es nicht nur möglich ist, den Energieverbrauch privater und gewerblicher Stromkunden detail liert aufzuschlüsseln, sondern teilweise auch Einfluss darauf zu nehmen, um Lastspitzen zu vermeiden oder Elektrizität dann zu verbrauchen, wenn sie gerade günstig aus lokalen Quellen erzeugt wird. Der flächendeckende Einsatz von Smart Meters wird in einigen Ländern (z. B. Italien und Schweden) bereits umgesetzt. Auch Entwicklungen in anderen Bereichen werden die Struktur der Verteilnetze beeinflussen. Dies betrifft insbesondere die Elektromobilität: Im Zusammenspiel mit den Batterien von Elektroautos und intelligenten Haushaltgeräten sind die Kunden nicht mehr passive Netznutzer, sondern leisten einen Beitrag zum sicheren Netzbetrieb (vgl. «Begrenztes Potenzial» S. 24 und «Im Praxistest» S. 27).
Übertragungsnetz muss ausgebaut werden
Ins Stromnetz der Zukunft sollen nicht nur kleine, regionale Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie eingebunden werden, sondern auch grosse Windparks in der Nordsee oder Solarstrom aus Nordafrika. Die 2009 von zwölf Unternehmen gegründete Allianz mit dem Namen Desertec[1] will massiv in solarthermische Stromerzeugungsanlagen in Nordafrika investieren und bis 2050 100 Gigawatt an zusätzlicher elektrischer Leistung installieren. Damit stellt sich die Frage, wie die Elektrizität in Afrika oder auch nach Europa transportiert wird. Eine Möglichkeit ist ein sogenanntes Super Grid, ein Stromnetz, das eine grosse Zahl erneuerbarer Erzeugungsanlagen in Europa und im Norden von Afrika miteinander verbindet (Abb. 3).
Die Vision beinhaltet den Einsatz einer Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), im Gegensatz zum bisherigen kontinentaleuropäischen Netz, das bis auf einzelne Leitungen auf Wechselspannung beruht. Mittels HGÜ lässt sich elektrische Energie über längere Strecken mit niedrigeren Verlusten übertragen, allerdings gibt es bisher praktisch keine Erfahrungen mit HGÜ-Netzen. Die meisten HGÜ-Leitungen sind Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, z. B. zwischen grossen Kraftwerken und Städten als Lastzentren.
Aber auch ohne die Desertec-Vision sind der Ausbau und die Erneuerung des europäischen Übertragungsnetzes von höchstem Interesse. Neue Netztechnologien[2] ermöglichen es, Daten über den aktuellen Netzzustand (grenzüberschreitende Flüsse, Frequenzabweichungen etc.) in Echtzeit zu erfassen. Diese Gesamtsicht des Systems kann man benutzen, um in kritischen Situationen präventive Massnahmen gegen Blackouts zu ergreifen. Hier wird erneut die wichtige Rolle von Informations- und Kommunikationstechnologien deutlich, insbesondere auch für die Koordination der Märkte und des Netzes. Erzeugungs- und Versorgungsunternehmen, die Strom handeln, sind daran interessiert, dass ihre Aktivitäten nicht durch Netzengpässe eingeschränkt werden. Auf der anderen Seite sind die Übertragungsnetzbetreiber jederzeit für den stabilen und sicheren Netzbetrieb verantwortlich. Die zur Koordination nötigen Datenmengen sind immens und können nur mittels spezifischer Konzepte und Regeln verarbeitet werden. Dazu gehören beispielsweise Methoden zur Engpassvermeidung im europäischen Netz, zur Frequenzregelung oder zur Analyse von Versorgungssicherheit (kurzfristig) und Versorgungszuverlässigkeit (langfristig).
Hohes Investitionspotenzial
Diese Überlegungen zeigen, dass es momentan vielfältige Problemstellungen im Netzbereich gibt, wobei das Ziel sein muss, ein Netz zu bauen, das ökologische, technische und ökonomische Ansprüche gleichermassen erfüllt. Dazu gehört ein stabiler, sicherer und zuverlässiger Betrieb genauso wie Emissionsvermeidung und Kosten- und Ressourceneffizienz. Da Netzbetriebsmittel hohe Nutzungsdauern aufweisen – Freileitungen, Kabel oder Transformatoren werden über 40 Jahre und länger genutzt –, definieren heutige Investitionsentscheidungen das Netz der Zukunft. In diesem Sinne ist es nötig, ein nachhaltiges Netz zu bauen. Es ist zu hoffen, dass die verschiedenen Facetten eines Smart Grid – in das Einspeisungen aus Grosskraftwerken, verteilte Erzeugung sowie Gross- und Kleinkunden gleichberechtigt eingebunden sind (Abb. 4) – genau diesem Anspruch gerecht werden.
Die Weichen dazu werden in vielen Ländern bereits gestellt. So betonte Barack Obama in seiner Rede zur wirtschaftlichen Lage Amerikas im Januar 2009, dass die Ausrichtung Amerikas auf eine globale Wirtschaft auch die Modernisierung der Elektrizitätsversorgung erfordere und somit den Aufbau eines Smart Grid, das kostengünstiger sei, die Energiequellen vor Ausfällen oder Angriffen schütze und saubere, alternative Energieformen in jeden Winkel der Nation liefere.[3] Eine Studie der Energieconsulting-Firma KEMA beziffert das US-amerikanische Investitionspotenzial für Projekte im Smart-Grid-Bereich auf 64 Milliarden US-Dollar und 216 000 neue Arbeitsplätze.[4] In Deutschland wurde Ende 2008 das Forschungsprogramm «E-Energy – Smart Grids made in Germany» gestartet, das Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgrund seiner herausragenden innovations- und wirtschaftspolitischen Bedeutung zum «nationalen Leuchtturmprojekt» erklärt hat (vgl. «Im Praxistest» S. 27).[5] Auch das Bundesamt für Energie (BFE) widmet sich dem Thema Smart Grids als Teilbereich des nationalen Forschungsprogramms «Netze», das sowohl privatwirtschaftlichen wie auch akademischen Institutionen Forschungsgelder für Projekte im Netzinfrastrukturbereich zur Verfügung stellt (vgl. Kasten S. 27).[6]
[ Thilo Krause, Dr. sc. techn., Diplom-Wirtschaftsingenieur, Power Systems Laboratory der ETH Zürich ]TEC21, Fr., 2011.03.18
Anmerkungen
[1] Desertec Foundation, www.desertec.org
[2] zum Beispiel Phasor Measurement Units (PMUs) in Verbindung mit Wide Area Monitoring and Control Systems (WAMS)
[3] Barack Obama, «Speech on the Economy», Januar 2009, www.nytimes.com/2009/01/08/us/ politics/08text-obama.html?pagewanted=1&_r=2
[4] KEMA, «The U.S. Smart Grid Revolution, KEMA’s Perspectives for Job Creation», Dezember 2008, www.smartgridnews.com/artman/uploads/1/KEMA_s_Perspectives_for_Job_Creation.pdf
[5] E-Energy – Smart Grids made in Germany, www.e-energy.de
[6] Bundesamt für Energie (BFE), Informationen zum Forschungsprogramm Netze, www.bfe.admin.ch/forschungnetze
18. März 2011 Thilo Krause
Begrenztes Potenzial
Im Zusammenhang mit Smart Grids wird das Lastmanagement propagiert, also die aktive Steuerung bzw. zeitliche Verschiebung des Stromverbrauchs bei den Kunden. In der Stadt Zürich wird dies wie in vielen anderen Schweizer Gemeinden schon seit Jahrzehnten in Form einer Rundsteuerung für Warmwasserboiler praktiziert. Das darüber hinausgehende Potenzial ist jedoch begrenzt und für die Kunden teilweise mit Kompromissen verbunden.
Beim Lastmanagement (demand-side management) werden alle Verbraucher, die nicht kontinuierlich Strom benötigen, wie Kühlschränke, Warmwasserboiler, Wärmepumpen etc., bei einem Über- bzw. Unterangebot von Energie ein- bzw. ausgeschaltet. Die nicht verschiebbaren Anwendungen wie Licht in der Nacht oder Computer während der Arbeitszeit bleiben dabei unberührt.
Die Idee des Stromlastmanagements ist allerdings nicht neu. In vielen Schweizer Gemeinden ist seit Jahrzehnten eine Rundsteuerung in Betrieb – in Zürich seit 1953 –, die ein sehr robustes und einfaches Lastmanagement ermöglicht. Mittels dieser Signale werden Warmwasserboiler nachts gestaffelt ein- und wieder ausgeschaltet. Einen Anreiz, auch den sonstigen Stromverbrauch in Schwachlastzeiten zu verschieben, erhalten sämtliche Kunden durch die tageszeitabhängige Unterteilung des Strompreises in Nieder- und Hochtarif. Der Grund für die Einführung dieser Massnahmen war aber nicht die schwankende Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energiequellen, sondern die optimale Auslastung der kostenintensiven lokalen Netze.
Potenzial bei den Haushalten in Zürich
Der Beitrag der Warmwasserboiler zum Stromverbrauch ist allerdings relativ gering: Die Haushaltskunden benötigen in Zürich ca. 20 % der maximalen Last, der Anteil der Warmwasserboiler beträgt davon maximal etwa einen Drittel oder ca. 35 MW. Weiteres Potenzial für den Ausbau des Lastmanagements bei den Haushalten der Stadt Zürich bieten Wärmepumpen mit einer Leistung von ca. 6 MW (ca. 550 Anlagen), ebenso Waschmaschinen, Tumbler, Abwaschmaschinen und Kühlschränke mit insgesamt ca. 50 MW. Das Potenzial ist aber auch hier beschränkt, da zum Beispiel Waschmaschinen in der Nacht wegen des Lärms nicht betrieben werden dürfen sowie effiziente Wärmepumpen oder Kühlschränke auf Dauerbetrieb ausgelegt sind und eine Steuerung daher wenig sinnvoll ist.
Einen grossen Anteil an schaltbaren Lasten können in Zukunft wahrscheinlich batteriebetriebene Elektrofahrzeuge liefern, die als Stromspeicher fungieren können. Bei einem Überangebot an Strom werden sie geladen, bei einem Unterangebot wird ein Teil des gespeicherten Stroms wieder an das Netz abgegeben. Wenn 10 % des städtischen Individualverkehrs elektrisch betrieben würden und alle diese Fahrzeuge an der Steckdose wären, ergäbe das ein Potenzial von ungefähr 30 MW. Auch hier geht der Kunde aber mit Lastmanagement einige Kompromisse ein: So kann er die Kapazität seiner Batterie nicht jederzeit ausnutzen, und die zusätzlichen Ladezyklen verkürzen die Batterielebensdauer. In Zürich sind insgesamt maximal 20 % des Stromverbrauchs schaltbar bzw. für eine gewisse Zeit aufschiebbar, dies aber zum Teil nur mit hohem Aufwand.
Potenzial bei den Geschäftskunden in Zürich
Bei den Geschäftskunden sind die Möglichkeiten von Lastmanagement gering. Zum einen, da in der Stadt Zürich hauptsächlich Dienstleistungsunternehmen angesiedelt sind. Diese Unternehmen bringen mit ihren Rechenzentren eine kaum beeinflussbare Dauerlast. Die Mit- arbeitenden benötigen während der Geschäftszeiten ihre Computer und Drucker – wegen Stromknappheit lässt man die Kunden kaum warten. Im Gegenteil investieren diese Unternehmen in eine höhere Verfügbarkeit der Energieversorgung. Da durch Hoch- und Niedertarif bereits heute ein starker finanzieller Anreiz besteht, in die Schwachlastzeiten auszuweichen, ist das finanziell interessante Potenzial zudem wahrscheinlich bereits ausgeschöpft. In den meisten Betrieben in der Schweiz sind die Kosten für den Strom heute nicht der Hauptfaktor für die Wirtschaftlichkeit. Eine Verschiebung der energieintensiven Aktivitäten auf relativ kurzfristige Energiepreisangebote dürfte nur in Einzelfällen wirtschaftlich sinnvoll sein. Lastmanagement all ein genügt nicht
Trotz Lastmanagement werden mit der Zunahme des Anteils an erneuerbarer Energie die Schwankungen im Stromnetz zunehmen, denn mit Lastmanagement lassen sich nur kürzere Lastspitzen glätten. Bei einer ausschliesslichen Versorgung durch lokale Windenergie müssten aber Wochen oder zumindest Tage überbrückt werden, was wahrscheinlich nur mit einem Speicher funktioniert.
Werden möglichst grosse Gebiete gekoppelt (Solarstromproduktion in Südeuropa, Speicherung in den Alpen, Windstrom aus Nordeuropa), werden die Perioden von Überfluss und Knappheit natürlich kürzer, und Lastmanagement wird sinnvoll. Dazu müssen aber diese Gebiete mit neuen Leitungen, die auch Super Grid genannt werden, gekoppelt werden (vgl. «Intelligentes Netz», S. 20).
Bei einer ausschliesslichen Versorgung mit Sonnenenergie müssten sowohl die tages- als auch die jahreszeitlichen Schwankungen ausgeglichen werden. Dazu ein Beispiel: Ein Schweizer Haushalt verbraucht durchschnittlich 4500 kWh. Diese Energie könnte mit einem Solarpanel von etwa 40 m² erzeugt werden. Allerdings braucht es dazu mindestens einen Speicher von 1400 kWh, um den Tages- und Jahresgang auszugleichen. Mit heute verfügbaren Bleibatterien würde das ein Batterievolumen von ca. 20 m³ mit einem Gewicht von 40 t und Kosten von mehreren hunderttausend Franken bedeuten. Ein Lastmanagement bringt in diesen Zeiträumen wenig, höchstens um die Batterie zu schonen. Das bedeutet, dass die Netze ausgebaut werden müssen. Eine Studie des Bundesamtes für Energie (BFE) geht davon aus, dass die Netzkosten bei einem Vollausbau von erneuerbarer Energie in der Schweiz um ca. 10 % steigen werden.1 Ein Kunde, der seine Nachfrage weitgehend nach dem Angebot richten kann, wird in Zukunft eine tiefere Stromrechnung haben, alle anderen werden aber mehr bezahlen müssen.
Technische Hürden
Bei den technischen Hürden, die es für die Realisierung von Smart Grids noch gibt, werden häufig nur die noch fehlende Standardisierung aller Komponenten oder die Herausforderung der Datensicherheit erwähnt. Vergessen wird oft die Zuverlässigkeit dieser Systeme: Beim Smart Grid sitzt an jedem intelligenten Knoten ein Minicomputer, der das Netz aktiv steuert. Stürzt dieser Minicomputer ab, so wird beispielsweise das Bier warm oder die Wohnung kalt. Falls das Stromnetzwerk nur die Verfügbarkeit eines Computernetzwerkes erreicht, dürfte das Smart Grid von den Kunden kaum akzeptiert werden. Ausserdem ist der Stromverbrauch aller Komponenten des Smart Grid, also für die Minicomputer, die Kommunikation mit der Leitstelle, diverse Server etc., nicht zu vernachlässigen: Heutige Systeme verbrauchen teilweise bereits im Betrieb mehr Energie, als sie einsparen können.
Auch die Anstrengungen zur Energieeffizienz stehen in Konkurrenz zum Smart Grid: Effiziente Geräte (Kühlschränke, Wärmepumpen) sind nicht überdimensioniert und daher für den Dauerbetrieb ausgelegt. Das Abschalten ist deshalb kaum noch sinnvoll. Dies gilt generell auch für Industrieprozesse, wo elektrische Antriebe dominieren (ca. 50 % des weltweiten Energieverbrauchs): Das grösste Energiesparpotenzial liegt in der Reduktion der Überdimensionierung, aber nur überdimensionierte Anlagen lassen ein wirtschaftliches Lastmanagement zu.
Nüchtern betrachtet geht es bei vielen Diskussionen über Smart Grids mehr um das Marketing von Produkten oder Visionen als um in den nächsten Jahren realisierbare Produkte oder um Kundenwünsche. Einzelne Projekte mit einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis werden sicher bald realisiert. Die Steuerung von Kleinverbrauchern ist aber wohl eher eine Vision für die Zukunft.
[ Lukas Küng, Dr., El.-Ing. ETH, Leiter Verteilnetz, Elektrizitätswerke der Stadt Zürich ]TEC21, Fr., 2011.03.18
Anmerkung
[1] Bundesamt für Energie: Wirtschaftlichkeit dezentraler Einspeisung auf die elektrischen Netze der Schweiz, März 2010
18. März 2011 Lukas Küng