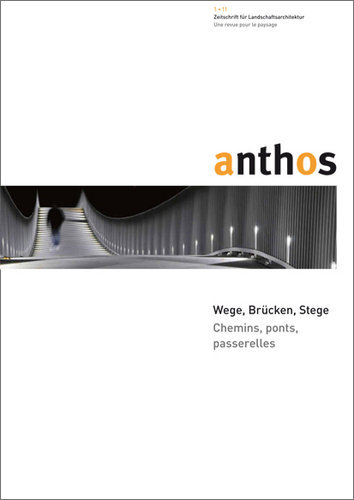Editorial
Wenn der Weg das Ziel ist, kann es kaum ohne Brücken, Wege und Stege erreicht werden. Sie sind identitätsstiftende Merkzeichen und prägen das Bild der Landschaft. Sie haben eine eigene Geschichtlichkeit und bezeugen lokale, regionale oder nationale Baukunst. Sie verbinden Orte miteinander, überwinden Tiefen und Höhen. Sie verlaufen in und über der Landschaft, stellen sie aus oder machen sie erst erfahrbar. Sie erschliessen die Landschaft, und werden eingesetzt zu ihrer Inszenierung. Im Lauf der Zeit haben sich Materialien ebenso geändert wie Konstruktionspraktiken, was Restaurationsarbeiten vielfach so aufwendig macht. Aber es gibt auch heute noch neue Forschungsansätze, beispielsweise für den Steg der Zukunft.
Die Konzentration der Ausgabe gilt dem Langsam- und Fussverkehr, denn hier muss der Wegeführung, der Abfolge der Räume und dem Detail besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Wie wichtig die richtige Wegeführung für die bewusste Wahrnehmung der Landschaft ist, wusste schon Louis XIV. Eigenhändig entwarf er, worauf Doris Kolesch 2006 hinwies, zwischen 1689 und 1705 sechs Manuskripte der «Manière de montrer les Jardins de Versailles», einer Anleitung, wie – auf welchen Routen, in welcher Reihenfolge, in welchen Geschwindigkeiten und aus welchen Perspektiven – die Anlagen von Versailles wahrzunehmen seien. Mit Gästen oder alleine besuchte der König beinahe täglich seine weitläufigen Anlagen mit fast acht Kilometer langen Wegen. Seit 1679 hatte er seinen Fuhrpark um 15 Rollstühle erweitert, in denen er und seine Begleitung fortan spazieren fuhren. Die Mobilität des Spazierenfahrens im Rollstuhl betonte und erhöhte die Dynamik des Blicks, den die Anlagen mit ihren differenzierten Raumfolgen, Ein- und Ausblicken dem zeitgenössischen Betrachter boten. Die gleiche Landschaft konnte so auf völlig neue Weise erfahren und erlebt werden. Ludwigs präzise Regieanweisungen strukturierten die Anlagen in Bilderfolgen und -sequenzen, unterteilten sie in Wahrnehmungsbereiche und choreographierten die pure Unmöglichkeit einer kollektiven Landschaftswahrnehmung.
Damals wie heute bedeutet Promenieren, welches sich durch die bewusste Wahrnehmung der Umgebung massgeblich vom schlichten Zurücklegen einer Wegstrecke vom Start- zum Zielpunkt unterscheidet, das selten gewordene Vergnügen der Entschleunigung. Dieses Gefühl wird umso intensiver, je geschickter und einfallsreicher die Umgebung und mit ihr landschaftsarchitektonische Anlagen und Bauwerke gestaltet sind. Auch das hat sich nicht verändert.
Sabine Wolf
Inhalt
Bertram Weisshaar
- Stop and go. Zwischen Perspektive und Vorankommen
Hans Schoch
- Vision Zürichseeweg
Lukas Schweingruber, Dominik Bueckers
- Vom Bahnviadukt zum Quartier-Laufsteg
Cornel Doswald
- Wege mit Geschichte
Roland Raderschall
- Das einzig Beständige liegt im Wandel
Stephanie Bender, Philippe Béboux
- Zwischen Stadt und Natur
Hannes Schwertfeger
- Wachsende Stabilität
Christian Halm, Kurt Pock
- Fenster in die Landschaft
Thomas Widmer
- Im Frühtau zu Berge
Anouk Vogel
- Sommer und Winter
Nicole Büsing, Heiko Klaas
- Landmarke Achterbahn
Sabine Wolf
- Wenn nicht hier, wo dann: Eine Brücke für Brugg
Graziella Barsacq
- Aussöhnung von Mensch und Natur
Susanne Isabel Kröger Yacoub
- Brückenkunst in Flusslandschaft
Rubriken
- Mitteilungen des BSLA
- Wettbewerbe und Preise
- Mitteilungen der VSSG
- Schlaglichter
- Zum Gedenken an an Peter Ammann
- Agenda
- Literatur
- International Federation of Landscape Architects
- Schweizer Baumschulen
- Produkte und Dienstleistungen
- Die Autoren
Stop and go. Zwischen Perspektive und Vorankommen
Die Geschwindigkeit, mit der wir den Raum durchqueren, ist massgeblich für unsere Erfahrung der Landschaft. Und ob wir im Wahrnehmungsmodus Zwischenabschnitt oder im Modus bewusster Wahrnehmung sind, hängt auch von der Gestaltung der Landschaft ab.
«Wer geht, sieht im Durchschnitt anthropologisch und kosmisch mehr, als wer fährt», schrieb Johann Gottfried Seume 1805, drei Jahre nach seinem «Spaziergang nach Syrakus». Und mehr noch als damals wird heute das Bild, das wir von einer Gegend erhalten, geprägt durch die Art und Weise, wie wir uns durch den Raum bewegen. Ob wir mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahren, ob wir im Zug den Raum durchqueren, als Jogger oder Spaziergänger mit Muse die Strecke zurücklegen: jedesmal kommen wir zu einem anderen Gesamteindruck. Dabei ist uns – oft wurde es schon gesagt – das Gehen die sowohl ursprünglichste als auch die uns am meisten entsprechende Fortbewegungsart. Die Eindrücke wechseln in dem uns eigenen Tempo, in welchem wir voranschreiten. Wann immer wir wollen, können wir stoppen, uns einer besonderen Perspektive oder einem Detail widmen, um dann im Weitergehen über das Beobachtete eventuell noch etwas nachdenken zu können, bevor eine nächste Besonderheit unsere Aufmerksamkeit erneut weckt.
Nicht jeden Abschnitt des Vorankommens nehmen wir mit derselben Intensität wahr. Besonderen Aussichten, «Sehenswürdigkeiten» oder markanten Objekten wenden wir uns bewusst zu, wohingegen wir andere, «nur gewöhnliche» Abschnitte des Weges mitunter halbwegs blind passieren. Die Wahrnehmung entlang des Weges ist also keine kontinuierliche, sondern eher kinematografisch. Der Spaziergang gleicht in diesem Sinne einer Perlenschnur, einer Abfolge von Stationen, an die wir uns im Nachhinein erinnern und welche wir zu einem Landschaftsbild integrieren. So manche zurückgelegte «Zwischenabschnitte» vergessen wir dabei, weil als nicht relevant eingeschätzt, oder vielleicht auch, weil wir sie als störend empfanden.
Brücken, Stege und Treppen als identitätsstiftende Merkzeichen der Landschaft
Brücken, Stege und Treppenanlagen bilden beinahe von Natur aus besondere Stationen innerhalb des Spaziergangs. Sie sind niemals nur gewöhnliche Wegstrecke. Denn diese Bauwerke ermöglichen uns nicht nur Wasserflächen oder steile Steigungen zu überwinden, sie erschliessen uns darüber hinaus einen raschen und markanten Wechsel der Perspektive. Nicht selten werden Brücken oder Treppenanlagen zu Merkzeichen und Identifikationselementen einer Landschaft. In der Landschaftsmalerei bilden sie seit je her einen verbreiteten Topos. Beispielsweise in der Ruinenmalerei des Hubert Robert bilden Treppen oder Brücken häufig das eigentliche Motiv, wie auch in seinen Architekturkompositionen und Landschaftsszenen oftmals Treppen und Brücken der Steigerung der dargestellten Szenen dienen. Und schon beinahe unvorstellbar scheint beispielsweise eine Abbildung der Schöllenenschlucht auf der Route über den Gotthardpass zu zeigen, ohne dass dabei «die» Teufelsbrücke zu sehen wäre. Die Dramatik und Erhabenheit der Landschaft scheint sich geradezu in dem eingefügten Bauwerk zu entzünden.
Brücken als Element der Landschaftsarchitektur
Ein weiteres berühmtes Beispiel ist die 1779 errichtete «Iron Bridge» in Coalbroockdale, die erste aus Gusseisen gefertigte Brücke.
Zahlreiche der in der damaligen Zeit aufkommenden gedruckten Reiseführer nannten dieses Bauwerk als Sehenswürdigkeit, welches rasch weit über die Grenzen Englands hinaus bekannt wurde.
Vermutlich besuchte auch Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau auf seiner Englandreise im Jahre 1785 die Iron Bridge. Wenige Jahre später liess er diese Brücke verkleinert im Massstab 1:4 in seinem Wörlitzer Park errichten. Die Nachbildung der damals modernsten Brückenkonstruktion verdeutlicht ein Anliegen des in den Wörlitzer Anlagen realisierten Brückenprogramms. Es sollte die vielfältigen Formen und Konstruktionen und die Entwicklungsgeschichte des Brückenbaus widerspiegeln. Jeweils eingebettet in eine gestaltete Landschaftsszene führt das umfangreiche Programm beispielsweise eine Furt, einen Bach überquerenden Baumstamm, wie auch jeweils ein Beispiel einer chinesischen, venezianischen, römischen sowie einer Inkabrücke an. Bezeichnenderweise erhielt mit der Iron Bridge eine Ikone der Industrialisierung Eingang in die Gestaltung dieses Landschaftsgartens. Vermutlich war dem Fürst selbst nicht bewusst, welch treffliches Bild der Zukunft er damit in seinen Park integrierte, veränderte doch die sich in den folgenden Jahrzehnten mehr und mehr durchsetzende Industrialisierung die Verhältnisse ausserhalb des Parks grundlegend.
Vom Gestaltungselement zur «Massenware»
Zu den natürlichen, geografischen Raumwiderständen kamen überall neue, unüberwindbare Hindernisse hinzu: Bahndämme und Gleisanlagen, Schifffahrtskanäle, ausgedehnte Industrieareale, Autobahnen und so weiter. Neue Brücken und Treppen wurden daher massenhaft benötigt und gebaut. Nicht alle entstandenen Werke erlangten dabei ein Identifikationsmoment wie die Brücke in Coalbroockdale, und hie und da wurde deren Einbindung in eine gestaltete Landschaftsszene offensichtlich vergessen. Nicht überall, aber allzu oft: Massenware, ohne Anspruch.
Spazieren im Wahrnehmungs- und Eroberungsmodus
Was macht nun der Spaziergänger in dieser derart gewordenen Welt? Er folgt im Kern zwei Strategien: Nach der einen dehnt er notgedrungen den «Wahrnehmungsmodus Zwischenabschnitt», also jenes Vorankommen, das ohne Aufmerksamkeit und halb blind erfolgt, bis an die Grenze des Machbaren aus. Mit anderen Worten: Um in unserer Alltagswelt noch klarzukommen, haben wir uns eine Anästhetik, ein Wegsehen, eine Verweigerung eindringlicher Wahrnehmung antrainiert. Die zweite, entgegengesetzte Strategie ist die der Eroberung. Verlassene Industriekomplexe, stillgelegte Gleisanlagen oder gesperrte Verkehrs-Infrastrukturen werden von Fussgängern als Zonen zum Herumstrolchen und Spazieren entdeckt. Und zunehmend verbreitet sich auch eine erweiterte Sicht auf Parkhäuser: Wer mit dem Auto ins Parkhaus fährt, sieht nur freie oder besetzte Stellplätze. Wer als Fussgänger auf der obersten Plattform spazieren geht, sieht mehr, entdeckt die schöne Aussicht, die es dort schon immer gab, die jedoch lange unbeachtet blieb.
Die zeitgenössische Landschaftsarchitektur im Zeichen des «Vergnügens des Gehens»
Den Strategien der Eroberung und der Uminterpretation folgen auch Beispiele der zeitgenössischen Landschaftsarchitektur. International rezipiert wurden etwa die Parkgestaltungen «Promenade Plantée» in Paris oder der «Highline-Park» in New York, beides mehrere Kilometer lange, lineare Anlagen auf stillgelegten, über Brücken und Viadukte verlaufende Bahntrassen. In diesen Beispielen führen die Brücken nicht über ein Hindernis, nicht von hier nach dort, sondern sie tragen die Landschaft zwischen die Wohnblocks. Die sich bietenden Ausblicke und das Vorankommen sind sich hier ebenbürtig. So auch bei «Ein Steg von hier nach hier» bei Mitterretzbach, Niederösterreich. Die kontinuierlich an- und wieder absteigende Stegkonstruktion des Künstlers Max Pauly beschreibt einen halben Ovalkreis. Nach Aussen bietet sich ein weiter, erhöhter Blick über die Landschaft der Weingärten, nach innen setzt sich das Kunst- beziehungsweise Architekturwerk in eine räumliche Beziehung zu den Fundamenten einer Wallfahrtskirche aus dem 18. Jahrhundert und zu einem hier gefundenen «heiligen Stein». Dieser Steg dient allein dem Vergnügen des Gehens, der Aussicht und der Perspektivveränderung im Gehen, ohne dass dabei noch eine Distanz zurückgelegt werden möchte.anthos, Mi., 2011.03.09
09. März 2011 Bertram Weisshaar