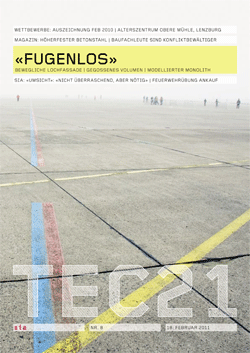Editorial
Fugen – im Speziellen Dilatationsfugen – sind vor allem im Aussenbereich unterhaltsintensiv, schadensanfällig, ausführungstechnisch heikel und planerisch herausfordernd. Man sollte diese Schwachstellen allein deshalb schon gänzlich vermeiden oder zumindest versuchen, sie in ihrer Anzahl zu reduzieren. Architektonische Konzepte, die das Gebäude als einheitliches Volumen erscheinen lassen, unterstützen diese Ausfüh-rungsweise im Hochbau. Man möchte die Fassade in einem Guss erstellen, um den monolithischen Eindruck zu verstärken und gleichzeitig robuste Flächen zu schaffen.
Dieser Fugenlosigkeit betonierter Flächen stehen die Betonverformungen infolge des Schwindens und der Temperaturänderungen entgegen. Durch Zwängungen und bei Überbeanspruchung des Materials können Spannungsrisse entstehen, welche die Gebrauchstauglichkeit und die Dauerhaftigkeit beeinträchtigen können. Um die Bauteilbewegungen dennoch aufzufangen, ohne dass Risse entstehen, entwickeln Bauingenieure alternative Konstruktions- und Ausführungslösungen, die neben den architektonischen auch die technischen Anforderungen dauerhaft erfüllen.
In dieser TEC21-Ausgabe werden drei Gebäude vorgestellt, deren Sichtbetonfassaden ohne Dilatationsfugen ausgeführt wurden. Der Grund für diese Umsetzung war im Prinzip derselbe: Man wollte unterhaltsarme und einheitliche Flächen realisieren. Bei kleineren Gebäuden kann eine monolithische Bauweise mit konstruktiver Bewehrung («Modellierter Monolith») oder durch eine speziell auf das Projekt angepasste Betonre-zeptur umgesetzt werden («Gegossenes Volumen»). Bei Gebäuden mit längeren Fassadenabwicklungen stellen erst mechanische Ansätze die konstruktive Lösung bereit. Man zwingt die Bauteile nicht in ihre feste Form, sondern gibt ihnen den notwendigen Bewegungsspielraum («Be-wegliche Lochfassade»). Von «fugenlos» zu sprechen ist allerdings trügerisch, denn die funktionalen Fugen verschwinden nicht, sie werden nur «umplatziert» – also mit architektonisch oder ästhetisch ohnehin notwendigen oder gewünschten Fugen zusammengelegt und so unsichtbar gemacht. Auch mit Arbeitsfugen wird in ähnlicher Weise umgegangen – sie werden beispielsweise aufwendig auf das Schalungsbild abge-stimmt und so kaschiert.
Ein fugenlos erscheinendes Flächen- bzw. Fassadenbild benötigt einen planerisch aufwendigen und zeitintensiven Prozess, denn das Unver-meidliche auf eine kreative und ideenreiche Weise unsichtbar zu machen, ist meist mit einem grösseren planerischen Aufwand verbunden, als das Notwendige anspruchslos und offensichtlich auszuführen. Aber der Aufwand lohnt sich.
Clementine van Rooden