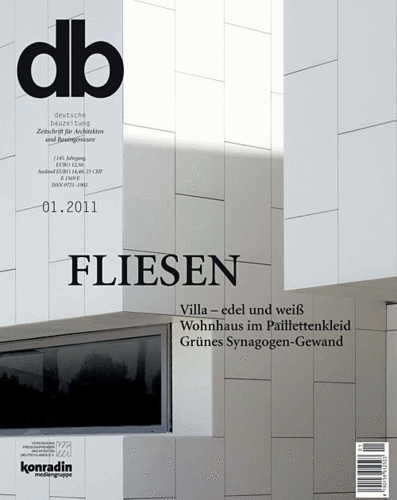Editorial
Großflächig an der Fassade oder bei der Außenraumgestaltung eingesetzt, erfreuen sich Fliesen seit einigen Jahren wieder wachsender Beliebtheit. Höchste Zeit also, den keramischen Materialien und Glasmosaik-Fliesen ein eigenes Heft zu widmen und dem Warum auf den Grund zu gehen. Anhand von internationalen Projektkritiken stellen wir die Vor-, und zum Teil auch Nachteile, dieses vielseitigen Baustoffs dar, mit dem sowohl eine zeitgemäße Gestaltung als auch eine Interpretation und überzeugende Weiterentwicklung des Vorgefundenen möglich ist. Durch besondere Formate, ungewohnte Materialkombinationen, dreidimensional geformte Elemente oder Glasierungen, die in verschiedenen Farbtönen changieren, lassen sich lebendige und abwechslungsreiche Fassadenbekleidungen gestalten, die das Gebäude eher wie ein luftiges Gewand umhüllen als wie eine eng anliegende Haut umschließen. | Ulrike Kunkel
Geflieste Stadtlandschaft
(SUBTITLE) Sporthalle mit Stadtteilzentrum in Rijeka
Große Baukomplexe mit homogenen Oberflächen zu überziehen, ist seit einigen Jahren »en vogue«. Avancierte Darstellungs- und Fertigungstechniken haben »Blobs« und »Faltungen« entstehen lassen, die Analogien zur Natur herstellen, im Stadtraum aber oft recht fremd wirken. Auch das Zamet Centar in der kroatischen Hafenstadt Rijeka, ganz in Keramik gekleidet, will mehr Landschaft sein als Gebäude. Hier ist es den jungen Architekten allerdings weitgehend gelungen, ein umfangreiches Bauprogramm in die disparate Vorstadt einzufügen und eine neue, signifikante Mitte zu schaffen.
»Gromaca« heißen die Mauern aus aufgeschichteten Felsbrocken, welche die Kulturlandschaft der Kvarner Bucht durchziehen. Früher trocken aufgeschichtet, heute meist verfugt und als Verblender vor Stahlbeton verwendet, prägen sie selbst in der Großstadt Rijeka noch das Bild vieler Hanglagen – als Stützmauern einer Bandstadt zwischen Gebirge und Meer. Wo der gewachsene Fels zutage tritt, wird die erstaunliche Analogie von geologischer Struktur und Menschenwerk deutlich. Als die Zagreber Architekten 3LHD gebeten wurden, ein multifunktionales Zentrum in einen jener weitläufig wuchernden Vororte der Stadt zu integrieren, griffen sie darum das Motiv der Gromaca auf: nicht nur als konstruktive Notwendigkeit, sondern als inhärente Logik des Orts. Entstanden ist auf diese Weise eine »topologische« Architektur, die komplexe Funktionen einem gestalterischen Gesetz unterwirft, das gleichsam aus der Landschaft erwächst. Das städtebauliche Gemenge aus Wohnhochhäusern, niedrigen Zeilenbauten, einer Schule und einem kleinen Ladenzentrum verlangte nach einer durchlässigen (die Architekten nennen es »porösen«) Anlage: Hangauf, hangab sollte man möglichst rasch überall hingelangen können. So gliedert eine der Felsstruktur analoge Streifenstruktur das Gelände und trägt dieser Durchlässigkeit Rechnung. Der langgestreckte Hang wird quer zum Gefälle in 22 Portionen geteilt, die mal als Gebäude, mal als Treppenweg Gestalt annehmen: »Faltungen«, funktional interpretiert.
Poröse Landschaft
Es war ein kluger Entschluss des Bauherrn, den Hauptprogrammpunkt einer für internationale Wettbewerbe tauglichen Sporthalle (Handball, Basketball) mit einer Reihe kleinteiliger Funktionen für den Stadtteil zu kombinieren: Ortsverwaltung, Bibliothek sowie insgesamt 13 flexibel als Laden, Bar oder Büro zu nutzende Lokale füllen nun auf zwei Etagen die kammartige Struktur zwischen den großzügigen Treppen, die in einen geräumigen Platz münden. Erst in der östlichen Hälfte, vis-à-vis der Wohnhochhäuser, türmt sich die Formation zur Sporthalle auf. Dieselben »tektonischen« Streifen rücken hier bis nah an die Quartiersstraße heran. Ihre »Verwerfungen« oder Fugen dienen dazu, Licht in die Halle zu holen, denn – das ist ein weiteres formales Prinzip der Anlage – die senkrechten Flächen zwischen den Streifen sind verglast. Es wirkt, als habe der Mensch seine Funktionen der Landschaft untergeschoben. Das »glaubt« man indes nur der niedrigeren Hälfte der Anlage mit ihren kleinteiligen Nischen und sanft abfallenden Schrägen, die übrigens gern von Kindern zum Rutschen benutzt werden. Die Sporthalle, zusätzlich von einer Tiefgarage unterbaut, ist dafür schlicht zu groß. Wer von Osten, vom Stadtzentrum Rijekas heranfährt, erfasst zunächst nicht die Landschaftslogik, denn er sieht nur wuchtige, sich ausbauchende Baumasse. Die beiden ungleichen Hälften des Projekts halbwegs zusammenzuhalten, gelingt nur über die einheitlichen Oberflächen: Fliesen und Glas.
Fliesen als Ersatz für Fels
Ein früheres Projekt, die Sport- und Stadthalle im ländlichen Bale/Istrien (s. db 1/2008), hatten die Architekten tatsächlich mit trocken aufgeschichteten Steinen nach Art der Gromaca bekleidet. Bei ihrem Projekt in Rijeka griffen sie erstmals auf keramischen »Ersatz« zurück: handelsübliche Steinzeug-Fliesen in Grau- und Beigetönen, geliefert aus dem italienischen Modena. Zu Fünfecken zugeschnitten, wurden die 11 mm dicken Fliesen zu sechseckigen Mustern zusammengesetzt. In dieser Textur überziehen 51 000 Fliesen den gesamten Komplex, nur kontrastiert von der kühl blaugrünen Industrieverglasung an den Vertikalen. Was Puristen irritiert: Die Fliesen sind mal konventionell im Mörtelbett verlegt (auf den Ortbeton-Konstruktionen am Platz), mal hinterlüftet auf eine Alu-Unterkonstruktion geklebt (an der Stahlkonstruktion der Halle). Sonderlich solide wirkt letzteres nicht, und erste Schäden durch Rempeleien und Steinwürfe sind erkennbar. Da man zugunsten der großen Linien auf Sockel oder Schutzleisten verzichtete, hat auch die Verglasung mancherorts schon gelitten. Im Hintergrund waltet Bauchemie, wohin man blickt. Von den Gromaca -Mauern ist hier nur noch ein vages Bild geblieben, eine Oberfläche, die ebenso auf die Nahtstruktur von Bällen wie auf die Haut von Reptilien anspielt. In der Praxis des nassen ersten Sommers hat sich die Oberfläche jedoch als pflegeleicht erwiesen. Besonders rutschig wurde es nicht, nur Pfützen gab es stellenweise, und es kam im Platzbereich zu unansehnlichem Algenwuchs. Dem will der Bauherr nun mit einer chemischen Beschichtung entgegenwirken, denn eine Reinigung, etwa mit Dampfdruck, könnte Schäden insbesondere an den hinterlüfteten und den silikonverfugten Konstruktionen anrichten.
Weiterer Kritikpunkt: In den kleinen Räumen am Platz wird es stellenweise zu heiß – das gewünschte Bild der abstrakten »Faltungen« ließ die Planer hier mit Öffnungen geizen. So hält man es in der sinnvoll eingerichteten, aber fensterlosen Bibliothek unter schwarzer Decke sommers nur mit Klimaanlage aus. Der »Anker« der Anlage, die Sporthalle, ist eine Welt für sich. Den internationalen Standards folgend, wendet sich die Arena mit ihren 2 380 Sitzplätzen vom Außenraum ab. Rijeka hat derzeit kein Spitzenteam zu bieten, so kooperiert man im Alltagsbetrieb mit der benachbarten Schule, die den Hallenraum – bei eingefahrener Tribüne – zweigeteilt nutzen kann. Auch als Konzertsaal oder für Konferenzen taugt der Raum. Holzfaserplatten an den Decken dämmen und dämpfen, Holzparkett sorgt im Kontrast zur kühlen Keramik draußen für eine warme Atmosphäre. Das im Hallensport gar nicht so erwünschte Tageslicht dringt nur indirekt über die Tribünen und einige Oberlichter in der gewaltigen Stahlstruktur herein (Spannweite 55 m). Die nach außen hin komplett verglaste Ostfassade ist innen völlig geschlossen – Landschaftslogik. Auch zum Platz hin im Westen mit seinem tagsüber recht regen Treiben gibt es erstaunlicherweise kaum Sichtkontakt, nur eine Lounge im Obergeschoss blickt hinaus Richtung Meer. Hätte hier, bei weniger kohärenter Gestaltung, ein offeneres Foyer nicht eine reizvolle »Bühne« im Stadtraum abgegeben, die auch die Funktion des »Gebirges« im Wortsinn durchschaubarer gemacht hätte?
Sportstätten sind inzwischen ein Schwerpunkt des Architekturbüros 3LHD. Unlängst erhielt es sogar den Auftrag für einige Hallen in Kanada. Das 1994, mitten im Balkan-Krieg, von Noch-Studenten in Zagreb gegründete Büro (3LHD bedeutet: drei Linkshänder) ist längst auch international erfolgreich. Tatsächlich war die Globalisierung im zunächst desolaten Land anfangs ihre einzige Chance zu überleben. Doch der Erfolg stellte sich dann auch daheim rasch ein: Zweimal haben sie ihr Land bereits mit originellen Expo-Pavillons repräsentiert. Für Rijeka entwarfen sie den symbolträchtigen Steg zur Erinnerung an den Jugoslawien-Krieg (wie beim Zamet Centar mit einer industriellen Oberfläche, die von weitem wie Stein wirkt), derzeit planen sie den neuen Busbahnhof, übrigens, wie das 20 Mio. Euro Projekt Zamet Centar ohne ein reguläres Wettbewerbsverfahren, wie es in der EU bei öffentlichen Aufträgen vorgeschrieben ist. Der Bauherr des Zamet Centar, Rijekasport Ltd., ist formell eine private Gesellschaft, jedoch eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Die traditionsreiche Hafenstadt leidet sichtbar unter dem Niedergang ihrer maritimen Lebensgrundlagen und versucht, mit Investitionen in große Sportanlagen ein neues Image aufzubauen. Mit niveauvoller, innovativer Architektur hofft man selbstverständlich auch hier auf eine Art »Bilbao-Effekt«. Die Bewerbung um die Mittelmeerspiele blieb indes schon mehrfach erfolglos. Wie ambivalent sich die Globalisierung auswirkt, wird auch im Œuvre des Büros deutlich: Offensichtlich folgen die vier Architekten mit ihren inzwischen 30 Mitarbeitern internationalen Trends – im Fall des Zamet Centar gibt es etwa eine formale Verwandtschaft mit Peter Eisenmans City of Culture in Galicia. Konzeptionell stark und reflektiert bringen sie damit frischen Wind in die lange Zeit ziemlich abgeschottete Architekturszene ihrer Heimat, sie riskieren aber auch, den Blick für das beträchtliche kulturelle »Kapital« ihrer Region aus den Augen zu verlieren. Wie das Zamet Centar zeigt, kann diese Gratwanderung allerdings durchaus gelingen. Trotz der genannten Schwächen ist ihnen ein zeitgeistiger, doch eigenständiger Beitrag gelungen, der bereits rund um den Globus Beachtung fand. Nicht zuletzt aber ist das lebendige kleine Zentrum ein Gewinn für die unmittelbare Nachbarschaft.db, Mo., 2011.01.17
17. Januar 2011 Christoph Gunßer
Zeichensprache
(SUBTITLE) Synagogenzentrum in Mainz
Wie eine Skulptur aus grünen Keramikelementen wächst das neue jüdische Gemeindezentrum direkt aus dem schwarzen Asphalt. Das expressive Gebäude von hoher Qualität signalisiert Selbstbewusstsein und eine gewisse Anspannung, weniger ruhige Gelassenheit.
Am Haupteingang des neuen Mainzer Synagogenzentrums ist ein grünes Keramikkästchen angebracht. Es ist eine Mesusa, eine Kapsel, die ein Pergament mit dem zentralen Glaubensbekenntnis des Judentums aus dem fünften Buch Mose enthält. Nach jüdischer Tradition findet dieses Zeichen seinen Platz an jedem Türrahmen eines Hauses. Auf dem kleinen Behälter ist die Silhouette des Neubaus eingeprägt; sie wirkt als abstrahierte Linie wie ein Schriftzug. Dass der Kubatur des Synagogenzentrums auch selbst eine Buchstabenfolge – das hebräische Qadushah: »Heiligung« – eingeschrieben ist, vermag der unkundige Betrachter allenfalls über dieses Detail zu erahnen. Auch Kenner des hebräischen Alphabets werden ihre Schwierigkeiten haben, die fünf Buchstaben Quoph, Daleth, Waw, Shin und He in der Silhouette zu erkennen. Doch auch ohne dieses Wissen kann man sich schwer der Wirkung der gezackten skulpturalen Form des Gebäudes entziehen. Wie eine vieltürmige expressionistische Stadt legt sich der langgezogene Baukörper bandartig um einen geschützten Innenbereich. Im Grundriss knickt das linear organisierte Gebäude dreimal ab, definiert nach Süden und Westen einen Blockrand und bildet zur Innenstadt einen Vorplatz vor dem Haupteingang aus. In seinen Dimensionen bleibt das expressive Ensemble dagegen zurückhaltend. Das trichterartige, riesige Oberlicht des Gebetsraums – das mit Abstand höchste Bauteil – überragt ein angrenzendes viergeschossiges Wohnhaus nur marginal und bleibt niedriger als die benachbarten sechsgeschossigen Baublöcke der Mainzer Neustadt.
Sieben Straßen laufen aus allen Richtungen auf die »Bauinsel« zu, die sich das Synagogenzentrum mit dem genannten Wohnhaus und einem eingeschossigen Kindergarten teilt. An dieser Stelle entstand 1912 die alte Hauptsynagoge, eine von drei Mainzer Synagogen, die die Nationalsozialisten im November 1938 zerstörten. 1999 gewann der damals gerade 29-jährige Architekt Manuel Herz den Wettbewerb für die Neuerrichtung des jüdischen Gemeindezentrums an historischer Stelle. Im November 2008, 70 Jahre nach der Zerstörung des Vorgängerbaus, erfolgte nach einer langen Finanzierungsphase die Grundsteinlegung. Das vollendete Bauwerk weicht erstaunlicher- und erfreulicherweise nur wenig von den Wettbewerbsplänen von 1999 ab.
Form und Formauflösung
Zu den Grundgedanken des Entwurfs gehört die Gestaltung der Längsfassaden mit plastischen Keramikelementen. Die dunkelgrün glasierten Formteile legen sich in konzentrischen Rahmen um die unregelmäßig eingeschnittenen Fenster und füllen die gesamte Fassadenfläche. Die verschieden ausgerichteten Rahmenfelder aus parallelen Zackenkämmen treffen in stumpfen und spitzen Winkeln aufeinander und zeichnen ein Muster aus verzogenen Dreiecken, Rhomben und Trapezen, das zwischen Form und Formauflösung oszilliert. Ein verblüffender und überaus reizvoller Effekt der Fassade besteht darin, dass die lotrechten Außenwände eine kubistische Dreidimensionalität und Tiefe gewinnen. Dies ist durch das unregelmäßige Patchwork aus Feldern paralleler Linien bedingt, die das Gehirn als dreidimensionale Körper interpretiert. Verstärkend kommt hinzu, dass Licht und Schatten auf den dreidimensionalen Elementen unterschiedliche Zonen von spiegelnder Helligkeit und tiefem Schwarz erzeugen. ›
Eine ähnliche optische Tiefenwirkung hat der amerikanische Künstler Frank Stella, der zu den Inspirationsquellen des Architekten zählt, in den späten 60er Jahren in minimalistischen Linienbildern erkundet. Stella stellte traditionelle Bildformate und -rahmungen in Frage und entwickelte aus den Polygonfeldern seiner zweidimensionalen Linienbilder dreidimensionale Skulpturen. Für das Mainzer Synagogenzentrum hat Manuel Herz ein ähnliches Verwirrspiel aus Flächenmustern auf die mehrfach abknickenden Längsseiten des Gebäudes übertragen. Eine gewisse Nervosität in dieser Inszenierung wird vor allem auf der Gartenseite deutlich. Im optisch vieldeutigen Spiel der keramischen Rahmenelemente sind die unregelmäßig eingeschnittenen Fenster lediglich Restflächen. Das Linienmuster wirkt zwar dreidimensional, bleibt aber ein zweidimensionales »Bild«. Die Keramikbekleidung ist eine Skulptur aus abknickenden Flächen, weniger die Hülle eines dreidimensionalen Körpers. Folgerichtig haben die Schmalseiten des Gebäudes, das ganz aus einer Stahlbetonkonstruktion besteht, einen anderen Charakter als die aufwendig gestalteten Längs- und Bildseiten und sind mit blaugrau vorpatinierten Zinkblechen verkleidet, die sich gewissermaßen in einer einzigen Bahn von der Sockelzone im Osten über die etwa 30 Mal abknickende Dachfläche bis zur gegenüberliegenden Schmalseite ziehen.
»Die Farbe gefällt mir einfach«
Der Wettbewerbsentwurf von 1999 sah die Umsetzung der skulpturalen Fassade durch vorgefertigte Betontafeln vor, was sich nicht als praktikabel erwies. Herz entwickelte darauf die Winkelelemente der Fassadenverkleidung in Zusammenarbeit mit dem Kölner Keramik-Experten Niels Dietrich und einem Deutschen Keramik-Hersteller. Grundelement ist eine einzelne Strangpressform, die werksseitig auf drei Längenmodule, drei Standard-Gehrungslemente sowie für spezielle Pass- und Anschlussstücke zugerichtet wurde. Die rationelle Produktion der Grundform und die Herstellung von Passstücken halten sich bei diesem System die Waage. Die einzelnen Winkelelemente, die wie Nut und Feder ineinandergreifen, werden auf ein Befestigungssystem aus Aluminiumschienen aufgesetzt, das exakt das spätere Linienmuster vorzeichnet. Durch die unterschiedlichen Längenmodule wird das optisch unbefriedigende Zusammentreffen von Stoßfugen vermieden. Die Keramikelemente zeichnen – in Analogie zur Fachsprache der Maurer – einen wilden Verband.
Ein wichtiges Element für die Wirkung der Keramikfassade ist ihre Farbe. Durch ihre dreidimensionale Form wird der Farbverlauf der dunkelgrün glasierten Teile im Brennprozess leicht unregelmäßig. Bei direktem Sonnenlicht strahlt die Außenhaut in einer Vielzahl leicht changierender Grüntöne, bei trübem Wetter wirkt sie fast schwarz. Die ausgewählte grüne Glasur ist Ergebnis einer langen Versuchsreihe aber letztlich eine Setzung des Architekten. »Mir gefällt die Farbe einfach«, erzählt Manuel Herz. Die Zulassung der völlig neu entwickelten Fassade war aufgrund der Unterstützung der Prüfingenieure des Herstellers kein Problem.
Offen & expressiv
Vorteil der dreidimensionalen Fassadenelemente und ihrer Glasierung ist nicht zuletzt, dass sie für das Anbringen von Graffitis unattraktiv ist und leicht gereinigt werden kann. Jedes Element kann zudem im Bedarfsfall einzeln ersetzt werden. In vielen Detailfragen spielten bei der Planung auch Sicherheitsüberlegungen eine Rolle. Ein direktes Heranfahren an das Gebäude ist von keiner Seite möglich, sämtliche Fenster bestehen aus Sicherheitsglas. Es ist das Verdienst der jüdischen Gemeinde und des Architekten, dass sich der Gebäudekomplex trotzdem ohne Zäune und schwere Betonbarrieren zur Stadt hin öffnet. Auffälligstes Bauteil des Ensembles ist das riesige, kantige, trichterförmige Oberlicht der Synagoge, das fast genausoviel Volumen umschließt wie der Versammlungsraum selbst. Die zinkverkleidete Untersicht dieses »Lichttrichters«, der an ein »Schofar«, ein zeremonielles Widderhorn, erinnern soll, bietet von außen leider eine weniger attraktive Ansicht als die Keramik verkleideten Längsseiten. Im Innern des Gebetsraums ist die Wirkung vollkommen anders. Dem Architekten ist das wirkliche Meisterstück gelungen, der nach innen orientierten Versammlungsstätte durch die Lichtführung eine Richtung zu geben, ohne den meditativen Charakter des Zentralraums zu relativieren. Der Gebetsraum wirkt harmonisch, ruhig und selbstverständlich. Das riesige Fenster des Oberlichts weist nach Osten, nach Jerusalem. Alle Wandflächen sind mit einem goldfarbenen Stuckrelief aus Tausenden dicht an dicht stehenden hebräischen Buchstaben gestaltet. Die Buchstabentextur lichtet sich an herausgehobenen Stellen; dort werden hebräische Texte Mainzer Rabbiner des 11. Jahrhunderts lesbar.
Das übrige Raumprogramm besteht aus einem Foyer, einem Versammlungssaal, Schulungs- und Verwaltungsräumen und zwei Wohnungen für Hausmeister und Rabbiner. Die öffentlichen Nutzungen bilden ein spannungsvolles Raumkontinuum. Die Nutzungsbereiche sind jeweils durch abwechselnd niedrige und sehr hohe Deckenzonen gekennzeichnet, die Wände teilweise gekippt und nach innen durchfenstert. Schiebetüren schließen auf dem Galeriegeschoss zwei Seminarbereiche ab. Es sind in ihrer momentanen Leere beinahe beunruhigende Räume. Der Betrachter fühlt sich hier – stilgeschichtlich gesprochen – in das expressionistische Kabinett des Dr. Caligari versetzt.
Innen wie außen präsentiert sich das neue Haus außergewöhnlich offen und selbstbewusst – aber nicht ohne Spannung und expressive Zerrissenheit. Die grünen Fassadenelemente sind mittlerweile zu einem Sinnbild des Bauwerks geworden, das auf einem Sympathieplakat der Stadt Mainz stellvertretend für das ganze Gebäude steht: »Willkommen mitten unter uns! Mainz freut sich über die neue Synagoge.«db, Mo., 2011.01.17
17. Januar 2011 Karl R. Kegler
verknüpfte Bauwerke
Neue Synagoge Mainz
Gefaltet und versteckt
(SUBTITLE) Villa in Sant Cugat del Valles bei Barcelona
Aus der Topographie der Landschaft entwickelten die Architekten Carlos Ferrater und Joan Guibernau ein Wohnhaus in Katalonien – mit felsiger Kubatur, weißer Keramik und minimalistischen Details. Es entfaltet sich aus dem Berg und bleibt im Grunde doch darin versteckt.
Die Straße windet sich durch den Naturpark Collserola, der Barcelona wie eine grüne Wand nach Westen begrenzt. Der rückseitige Berghang entfaltet sich in schief-steilen Geometrien von seinem Kamm bis in die weite Ebene von San Cugat. Hier beginnt die Landschaft Kataloniens und hier steht ein Haus, das in gebrochenem Weiß die Kubatur der Umgebung nachzeichnet.
Origami mit Beton
Es ist das Wohnhaus einer Unternehmerfamilie in einer kleinen Siedlung zwischen Wald, Wiesen und Golfplatz. Fast frei von städtebaulichen Zwängen kam das initiierende Entwurfskriterium von den Bauherren, wie Joan Guibernau erklärt: »Sie wünschten sich alle Wohnräume auf einer Ebene, das war Grundlage für unseren Entwurf.« Rund 600 m² Wohnraumprogramm auf einem Geschoss zu bündeln, das bewirkt zwangsläufig ein flächiges Volumen und gewisse Schwierigkeiten bei der Belichtung und Erschließung. Guibernau sagt: »Daher teilten wir das Volumen mit zwei Schnitten in drei Bauvolumen – drei Bänder aus Beton, die über niedrige Baukörper ebenfalls aus Beton miteinander verbunden sind.« Oberlichter, seitliche Verglasungen und ein Hof leiten Tageslicht ins Innere des Hauses. Mit den Bändern organisiert sich der Grundriss: Die Kinder- und Gästeschlafräume sowie ein Arbeitszimmer liegen im Osten, zur Straße hin; im Zentrum befinden sich das Hauptschlafzimmer, die dazugehörigen Nebenräume, ein Innenhof und die Küche; im Westen, zum Garten hin, liegen zwei Wohnzimmer und eine Hofterrasse. Im unteren Geschoss, halb in den Berg gegraben, liegen Nebenräume wie der Fitnessraum, ein Schwimmbad und die Garage.
Das Grundstück fällt nach Norden steil ab. Ursprünglich waren auf dieser Fläche zwei kleinere Bauparzellen mit einer Ost-West-Ausrichtung vorgesehen. Auf das nun zusammengelegte, trapezförmige Grundstück setzten die Architekten das Gebäude in Nord-Süd-Ausrichtung. So orientieren sich die Wohnzimmerbereiche über ihre Längsseite nach Westen zu einer Terrassenplattform hin. Die Ausrichtung ermöglicht im UG lediglich eine Belichtung über die kurzen Fassadenseiten. Lichthöfe bringen daher auf der bergseitigen Fassade zusätzlich Tageslicht hinein. Derart eingegraben soll das Haus mit seiner obersten Kante, der Dachlinie, die Landschaft des Berges fortführen – so die Idee der Architekten, die der fünften Fassade eine eigene Topographie geben. »Die Hochpunkte entwickeln sich dabei aus dem Negativraum im Innern,« sagt Guibernau. »Mit den variierenden Raumhöhen und geneigten Deckenplatten lassen sich spannende Raumeindrücke gestalten. Das gebaute Positiv findet sich dann in der Kubatur des Dachs.« So bilden sich im Innern luftige Räume. Sie wirken noch spannender durch den Kontrast zur niedrigeren Raumhöhe der Korridore, die die Fugen im Grundriss bilden.
Schon in anderen Projekten erprobten die Architekten gefaltete Hüllflächen, die im Innern Atmosphäre und außen den Bezug zur Landschaft aufbauen sollen. »Ferrater arbeitet dabei vor allem mit hellem, fast weißem Naturstein, weil es in Material und Farbe das Mediterrane widerspiegelt, und weil es das Licht dieser Regionen interessant bricht und reflektiert.« Auf diesem Baugrundstück aber sahen die Bauvorschriften keramische Oberflächen für das Dach vor, in Anlehnung an die typisch roten Ziegeldächer der Region. Weil aber Dach und Fassade in gleichem Material gehüllt sein und zudem auch in der Ausgestaltung eher minimalistisch als rustikal erscheinen sollten, ersannen die Architekten eine Alternative: Sie wählten weiß eingefärbte, großformatige Feinsteinzeugfliesen für die Hüllflächen. Damit erfüllten sie formal die Bauvorschriften.
Fassade mit Feinkeramik
Gleichzeitig profitiert die Konstruktion von der Materialwahl: Die Feinsteinzeugfliesen sind sehr bruchfest und biegesteif, so dass der Einsatz großer Platten möglich ist. Die Architekten wählten als Grundformat 45 x 90 cm; einzelne Fliesen variieren in der Breite um einen Zentimeter, um ein gleichmäßiges Fassadenbild ohne größere Fliesenanschnitte zu ermöglichen. Ein Vorteil der Platten liegt in ihrer geringen Porösität und in ihrer hohen Dichte. So nehmen sie fast kein Wasser auf und sind auch auf den nur gering geneigten Dachflächen regen- und frostbeständig. Für die Architekten lag der Hauptvorteil jedoch in der Ästhetik: Sie ließen die Fliesen eigens herstellen und mit einem abgemischten Weiß einfärben. Mittlerweile gibt es die Platten im Standardprogramm des Herstellers.
Um den monolithischen Gebäudeeindruck zu stärken, reduzierten Guibernau und Ferrater die Fugengröße zwischen den Fliesen auf unter einen Zentimeter, versetzten die horizontalen Stoßfugen gegeneinander und betonten dadurch die vertikale Fuge und die Verlegerichtung. Das Befestigungssystem ist dabei unsichtbar und dennoch relativ einfach gelöst: Aluminiumschienen sind an die Rückseiten der Platten geklebt, jeweils oben und unten. So konnten die Handwerker die Fliesen einfach auf eine an die Betonaußenwand geschraubte Aluminiumkonstruktion stecken. Wenn eine Fliese doch einmal beschädigt würde, wäre ihre Austausch durch das Stecksystem sehr einfach. Aber auch sonst hat das System Vorteile: Mit der Unterkonstruktion ergibt sich eine hinterlüftete Fassade, mit einer Styrodurdämmung im Zwischenraum, außen vor der Betonwand. Guibernau weiß: »Die hinterlüftete Fassade brachte besonders in den warmen Sommermonaten eine deutliche Abkühlung der Wand und eine Verbesserung des Raumklimas.« Zudem führen die hohe Dichte der Feinsteinzeugfliesen, die nur sehr schmalen Fugen und die Konstruktion als Vorhangfassade zu einem erhöhten Schallschutz. Damit durch die engen Fugen in der Fassade kein Metall im Sonnenlicht hervorblitzt, sind die Aluminiumprofile schwarz gestrichen.
Die Schichtung von Betonwand, Dämmung und Luftzirkulationsschicht und Fliesen ergeben eine Wanddicke von fast 50 cm. Die Fensterebene liegt daher deutlich hinter der äußersten Fassadenkante, so dass die Hülle massiver wirkt als sie tatsächlich ist. Eckfenster auf der Nordseite des Hauses schneiden Teile des weißen Volumens heraus und verstärken den Eindruck von Massivität. Auch im Detail betonen die Architekten dieses monolithische Gesamtbild geschickt, mit dünnen, anthrazitfarbenen Metallfensterprofilen und -laibungen sowie profillosen Glasbrüstungen vor den schmalen Loggien auf der Nordseite. Auch der Dachabschluss, ohne Blechkante und Überstand, passt perfekt in die minimalistische Gebäudekubatur.
Detailliert durchdacht
»Schwierig war die Konstruktion des Dachs,« erzählt der Architekt. »Die Bauteile mussten die Geometrie nachzeichnen und gleichzeitig das Regenwasser ordentlich abführen.« So ist das Dach nicht hinterlüftet wie die Fassade, sondern als Umkehrdach ausgebildet. Das hat thermisch Nachteile, eine skelettartige Unterkonstruktion könnte jedoch die komplizierte Geometrie des Dachs nicht so einfach nachbilden wie ein massiver Unterbau. Daher sind die Feinsteinzeugfliesen auf Betonplatten geklebt, die wiederum auf Dämmplatten aus Styrodur aufliegen. Die Abdichtungsfolien befinden sich zwischen Wärmedämmung und der tragenden Betondecke darunter. Eine umlaufende, hinter der Attika versenkte Regenrinne mit mehreren versteckten Abläufen sichert, dass sich keine Pfützen auf den Faltungen des Dachs bilden.
Wer nun hofft, von der Straße einen Blick auf das Haus am Hang zu erhaschen, wird enttäuscht. Hinter einem dunklen Stahlzaun und einer Mauer samt hoher Hecke bleibt der Dialog außen-innen, Haus-Hang Sache der Sicherheitskameras. Das Haus, aus der Landschaft und für die Landschaft entwickelt, bleibt am Ende ohne Landschaft.db, Mo., 2011.01.17
17. Januar 2011 Rosa Grewe