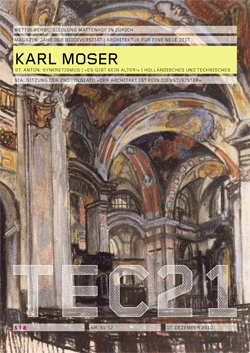Editorial
«Der ‹Fall Moser› ist eine kunstgeschichtliche Knacknuss und wird es vermutlich bleiben. Der Umfang des Œuvres ist enorm und schwer nach Spreu und Weizen zu sondern. Man weiss auch nicht recht, wo letztlich der Schwerpunkt von Mosers Beitrag liegt: in seiner gebauten Architektur oder in seiner Rolle als Networker und Lehrer; in seiner Fähigkeit, als Projektleiter grosser Bauvorhaben ganze Seilschaften von Künstlern zugleich anzuspornen und in Schach zu halten; oder in seinem eigenen genuinen Künstlertum [...]», schreibt Stanislaus von Moos im Katalog zur Ausstellung über Karl Moser (1860–1936) im Kunsthaus in Zürich, die bei Erscheinen dieser TEC21-Aus-gabe ihre Tore öffnet.[1] Die Urheberin-nen und die Autoren von Ausstellung und Buch haben sich der Herkulesaufgabe gestellt, Moser, dessen Geburtstag sich zum 150. Mal jährt, umfassend zu würdigen («Architektur für eine neue Zeit»). Moser zu entschlüsseln ist zum einen des schieren Umfangs seines Werks wegen eine Herausforderung: Die Zeugnisse von gegen 600 Bauten und Projekten lagern im Archiv des Instituts für Geschichte und Theorie der Archi-tektur (gta) an der ETH Zürich. Zum andern ist die «stilistische» Spannweite enorm. In der Antoniuskirche in Basel etwa verbinden sich das traditionelle Basilikalschema im Innern mit barocken und expressionistischen Zügen in der Vorhalle («St. Anton: Synkretismus und originäre Gestaltung»).
Die Vision für das Zürcher Niederdorf – die Verpflanzung der Idealvorstellungen der Ville contemporaine Le Corbusiers in das Zürcher Nieder-dorf (Abb. S. 12) – und die Faszination für die Barockkirche von Einsiedeln, wovon auch seine Farbskizzen zeugen, deren eine das Cover dieses Hefts ziert, markieren die Extreme. Und doch basieren sie auf ein und demselben Prinzip – nicht auf einem «Stil»: Linus Birchler beschrieb es 1936 im Nachruf und pries Moser als einen Architekten, «bei dem die barocken und modernen Vorstellungen – im ‹raummässigen Denken› – eins werden».[2] Und: Die Moser’sche Architektur folgt der inneren Logik des Bauens und der Konstruktion («Holländisches und Technisch-Ökonomisches»). Von einem Bruch unter dem Eindruck einer plötzlich einbrechenden Moderne könne in Mosers Werk denn auch keine Rede sein, so Werner Oechslin. «Kontinuität ist entscheidend. Jeder Wechsel erfolgt nach der Massgabe veränderter Zeit.»[3] Dies zu vermitteln war ihm Anliegen in seiner Lehrtätigkeit an der ETH («Es gibt kein Alter! Es gibt nur ein Leben.»).
Rahel Hartmann Schweizer
[1] Stanislaus von Moos, «Kraft und Integration. […]», in: Werner Oechslin, Sonja Hildebrand (Hg.): Karl Moser. Architektur für eine neue Zeit, 1880 bis 1936. gta Zürich, 2010, S. 257
[2] Werner Oechslin, «Bauen aus der Notwendigkeit. […]», in: wie Anm. 1, S. 42
[3] Ebd., S. 45