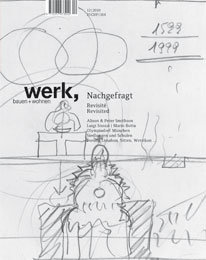Editorial
Nachgefragt
In der Regel verändert sich die Wahrnehmung der Dinge mit der zeitlichen Distanz, die wir zu ihnen gewinnen. Gebäude, die wir in der Kindheit als riesig erlebt haben, erscheinen Jahrzehnte später nicht mehr so gross. Dies ist nicht nur eine Frage des Massstabs und der unterschiedlichen Augenhöhe, sondern ebenso, ja mehr noch eine Frage der viel umfassenderen subjektiven Wahrnehmung. So verändert sich die Perzeption mit dem sich wandelnden Kontext unserer Vorstellungswelt und der entsprechend modifizierten Interpretation des Wahrgenommenen. Ein Beispiel: Vasari hatte 1550 für die Gotik nur Verachtung übrig und selbst noch für Johann Georg Sulzer, dem Verfasser der "Allgemeinen Theorie der Schönen Künste" (1771-1778), mangelte es der gotischen Architektur "am Schönen, Angenehmen und Feinen", die Gebäude seien "abenteuerlich und mit tausend unnützen Zieraten überladen". Bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mehren sich namentlich in Frankreich und England die positiven, aus einem antiquarischen Interesse heraus begründeten Stimmen zum Mittelalter und im Speziellen zur Gotik. Mit dem jungen Goethe und Friedrich Schlegel bricht dann wenig später der wahre Enthusiasmus aus. Die Gotik wird zum deutsch-nationalen Stil erhoben und schliesslich wird – nicht unwidersprochen – auch die Fertigstellung des Kölner Doms Wirklichkeit. Mit Blick in die fernere und jüngere Vergangenheit ändert sich so in Wellen das Urteil der Nachwelt, das selbst wieder Gegenstand späterer Kritik wird.
Solchen Bewegungen wollen wir in diesem Heft nachgehen: Wir fragen nach, was heute aus bestimmten Glanzpunkten und kontrovers diskutierten Projekten von damals geworden ist. Gian-Marco Jenatsch erklärt, woran es liegen mag, dass Alison und Peter Smithsons Gebäude des Economist in London auch heute noch Bestand haben und zur eigentlichen Architekturikone avanciert sind. Wie aus dem Olympischen Dorf von 1972 in München einer der beliebtesten Wohnorte für Studenten wurde, schildert Christof Bodenbach. Matthias Benz fragt nach, wie sich die grossen Genfer Wohnsiedlungen der 1950er, 60er und 70er Jahre gehalten haben, die zur Zeit ihrer Entstehung als "Grands ensembles" zu Recht die Blicke des ganzen Landes auf sich gezogen haben. Wohin sich der Tessiner Ort Monte Carasso dank Luigi Snozzis wegweisender Ortsplanung entwickeln konnte, erkundet Jachen Könz. Vor dem Hintergrund sich häufig ändernder pädagogischer Modelle sind die Schulhäuser einem besonderen Druck ausgesetzt. Daniel Kurz hat nachgefragt, wie sich vor fünfzig Jahren massgeschneiderte Zürcher Schulhäuser heute bewähren. Schliesslich befragt Francesco Collotti Mario Botta nach den für ihn und sein reiches Schaffen prägenden Motiven und Momenten.
Nachzufragen lohnt sich meistens. Nicht zuletzt erlauben solche Erkundungen, den Blick für unsere Zeit zu schärfen, vielleicht sogar die Spreu vom Weizen zu scheiden. Der Blick zurück erklärt die Gegenwart.