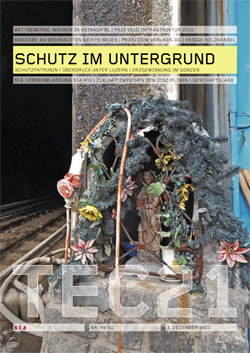Editorial
Den Bergleuten Alteuropas war die Welt der christlichen Heiligen bei ihrem gefährlichen und beängstigenden Beruf eine grosse Hilfe. Vor jeder Einfahrt in den Berg beteten sie. Die verbreitetste Bergbauheilige im 15. und 16. Jahrhundert war die Heilige Anna, die legendäre Mutter Mariens. Da Maria mit Mond und Silber, Jesus mit Sonne und Gold gleichgesetzt wurden, galt Anna als das «Bergwerk», aus dem die edlen Metalle hervorgehen, die Erzmacherin.[1] Erst in der Neuzeit wurde die Märtyrerin Barbara aus Nikomedia die wichtigste Bergbauheilige («Schutzpatronin», S. 18).
Barbarafiguren zieren auch heute noch Tunnelportale und Bergwerkseingänge. Am Gedenktag vom 4. Dezember ruht auf allen Tunnelbaustellen die Arbeit. Es wird aber nicht nur der Schutzpatronin und der verstorbenen Kollegen gedacht, vielmehr ist es ein Fest für alle Mineure, die unter schwersten Bedingungen arbeiten: Zu Zeiten des Eisenerzabbaus am Gonzen war dieser Tag für die Bergleute der Höhepunkt des Jahres. Staub, Feuchtigkeit, Schichtbetrieb und Dunkelheit sind nur einige der Herausforderungen, die die Menschen zu meistern hatten («Erzgewinnung im Gonzen», S. 24).
In der Schweiz haben der Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit einen der weltweit höchsten Standards erreicht. Beim Bau des Allmendtunnels in Luzern waren die Beteiligten jedoch mit einer in der Schweiz neuen Situation konfrontiert. Die Arbeiten wurden unter Druckluft durchgeführt, einerseits um das Grundwasser aus dem Tunnel fernzuhalten und anderseits um über die Spundwände dem Erddruck entgegenzuwirken. Für die Arbeiter, die in einer Atmosphäre tätig waren, welche einer Tauchtiefe von knapp sieben Metern entspricht, waren besondere Vorkehrungen zu treffen («Überdruck unter Luzern», S. 21).
Die Arbeit unter Tage wird immer eine besondere Herausforderung bleiben, die von besonderen Menschen gemeistert wird. Trotz moderner Technik und fortschrittlicher Umsetzung der vorgeschriebenen Massnahmen ist es nur schwer vorstellbar, dass die Statuen der Heiligen Barbara aus ihren Nischen verschwinden – auch wenn sie mancherorts etwas in den Hintergrund gedrängt wirken (Titelbild).
Übrigens: Schneidet man am Barbaratag Zweige von einem Obstbaum und stellt sie ins Wasser, sollen sie bis an Heiligabend blühen. Nach altem Volksglauben bringt das Aufblühen der Zweige Glück im kommenden Jahr. Daniela Dietsche
Anmerkung
[1] Gregor Markl, Sönke Lorenz: Silber Kupfer Kobalt, Bergbau im Schwarzwald. Markstein Verlag, Filderstadt, 2004
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Wohnen in Reinach BL | Prix Velo Infrastruktur 2010
10 MAGAZIN
An Weihnachten nichts Neues | Neuer Präsident der Verlags-AG | Neuer Knigge für den Handel mit Holz | Musikalische Räume | Bücher
20 SCHUTZPATRONIN
Daniela Dietsche Die Heilige Barbara beschützt Bergleute und Tunnelbauer. Aber wer war sie, und wie verbreitete sich ihre Verehrung?
23 ÜBERDRUCK UNTER LUZERN
Philipp Kohlschreiber Druckluftarbeit stellt höchste Anforderungen an Menschen und Maschinen. Welche Vorkehrungen getroffen werden müs-sen, zeigt das Beispiel Allmend-tunnel in Luzern.
26 ERZGEWINNUNG IM GONZEN
Aldo Rota Trotz der gefährlichen Arbeit und den schwierigen Arbeitsbedingungen herrschte unter den Bergleuten am Gonzen gute Stimmung.
31 SIA
Vernehmlassung SIA 405 | Zukunft zwischen den Disziplinen | Teuerung: Neue SIA-Normen | Geschäftslage im 3. Quartal 2010
37 FIRMEN
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Schutzpatronin
Die Heilige Barbara wird als Schutzpatronin von Bergleuten und Tunnelbauern verehrt. Nach der Überlieferung ist sie eine frühchristliche Frauenfigur, die für ihre Überzeugung in der Römerzeit den Märtyrertod erlitten hat. Zahlreiche Kirchen und Reliquien weltweit deuten auf ihre Verehrung als Heilige hin. Jedes Jahr am 4. Dezember gedenken Mineure und Bergleute ihrer Schutzpatronin.
Die aufwendige Inszenierung des Gotthard-Durchschlags und die Rettung der Bergleute in Chile haben die Heilige Barbara in den letzten Monaten in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Schutzpatronin der Tunnelbauer und Bergleute wird weltweit in der römischkatholischen, der griechisch-orthodoxen, der russisch-orthodoxen und der koptischen Kirche verehrt. Sie ist auch Patronin der Geologen, Hüttenleute und Artilleristen. Ihnen haben sich unter anderem Sprengmeister, Feuerwehrleute, Glockengiesser, Ärzte und Apotheker angeschlossen. Wissenschaftliche historische Zeugnisse zur Person der Heiligen Barbara jedoch fehlen: Authentische Quellen kennen ihren Namen nicht, sodass sie historisch eigentlich nicht existiert. Ihre weit verbreitete Verehrung ist dennoch sicher älter als die Legende, die sich erst im 7. Jahrhundert gebildet hat.[1]
Ein drittes Fenster als Zeichen der Dreieinigkeit
Es existieren unzählige Versionen der Legende der Heiligen Barbara, die sich auch teilweise widersprechen. Entstanden ist diese Vielzahl vermutlich durch Hinzufügen oder Weglassen von einzelnen Punkten bei den Abschriften. Die «Legenda aurea» (ca. 1250) gilt als die berühmteste, ausführlichste und am weitesten verbreitete Heiligengeschichte. Sie besagt, dass Barbaras Vater, der mächtige und heidnische Dioskorus, im 3. Jahrhundert zur Zeit des Kaisers Maximianus in Nikomedia[2] lebte. Er liebte seine Tochter über alles und versuchte, sie vor jeglicher Berührung mit der Welt zu bewahren, nicht zuletzt, um sie den Einflüssen der Christenlehre zu entziehen. Dioskorus liess einen Turm bauen, in den er Barbara während seiner Abwesenheit einschloss. In dieser Abgeschiedenheit begann sie, über die Welt und ihren Schöpfer nachzudenken, und richtete einen Brief mit ihren Fragen zum Christentum an den Gelehrten Origines[3], der in dieser Zeit in Alexandria lebte. Priester Valentinus überbrachte ihr seine Antwort persönlich, belehrte und taufte sie; ihrem Vater sagte sie, Valentinus sei ein in der Heilkunst erfahrener Alexandriner.
Als Dioskorus beabsichtigte, Barbara zu verheiraten, erwiderte sie nur zornig: «Zwinge mich nicht, dies zu tun, Vater.» In der Legende heisst es weiter: Daraufhin verliess er sie und stellte eine Menge Künstler an, um ein Badehaus zu bauen. Ob er dies tat, um seine Tochter zu besänftigen, ist aus der «Legenda aurea» nicht ersichtlich. Bevor er für längere Zeit verreiste, bestimmte er, wie das Bad aussehen sollte, und bezahlte die Handwerker, doch während seiner Abwesenheit bat Barbara diese, ein drittes Fenster als Zeichen der Dreieinigkeit einzubauen. Als Dioskorus zurückkehrte, offenbarte sie sich ihm als Christin. Er ermahnte sie, sich den alten Göttern wieder zuzuwenden, aber alle Vorhaltungen blieben erfolglos: Die Götterbilder im Turm waren bereits durch Kreuze ersetzt. Der wütende Dioskorus wollte seine Tochter auf der Stelle mit dem Schwert töten. Barbara betete, ein Fels spaltete sich, nahm sie auf und versetzte sie auf einen Berg, doch der Vater fand sie, und Barbara sollte vor dem Präfekten Marcianus dem neuen Glauben abschwören. Die Folter konnte sie jedoch nicht im Glauben erschüttern. In der Nacht erschien ihr im Verlies Christus, für den sie gelit- ten hatte, und befreite sie von ihren Wunden. Den Folterqualen sollte die Hinrichtung folgen. Schliesslich tötete sie ihr Vater mit dem Schwert. Dioskorus musste diese Tat direkt büssen: Er wurde vom Blitz getötet. Barbara wurde wohl nicht älter als 20 Jahre.
Verehrung folgte der Ausbreitung des Christentums
Nach ihrem Leben und Martyrium in der Übergangszeit vom 3. zum 4. Jahrhundert[4] traten im Orient bald erste Zeugnisse für ihre Verehrung als Bekennerin des Glaubens auf. So sollen ihre Gebeine schon 565 nach Konstantinopel geholt und dort um 900 eine St.-Barbara- Kirche erbaut worden sein.1 Von Kleinasien aus gelangte die Geschichte der Barbara auf das europäische Festland. Die abendländischen Kreuzzüge zur Eroberung des Heiligen Landes (12. und 13. Jahrhundert) spielten dabei eine wichtige Rolle, da die zurückkehrenden Kreuzritter die Barbaralegende mit nach Mitteleuropa brachten. Über Spanien und Portugal kam sie zur Zeit der Konquistadoren nach Süd- und Nordamerika.
In der koptischen Kirche wurde sie schon früh als Heilige gewürdigt. Ihre Anhänger verehren sie noch heute in der Barbarakirche zu Kairo aus dem 5. Jahrhundert. Als das älteste Bild der Heiligen gilt ein Fresko von 705 in der frühchristlichen Kirche Sankt Maria Antiqua auf dem Palatin in Rom, und in Trier ist 1161 ein Barbara-Kloster urkundlich nachweisbar. Von etwa 800 an tauchen Reliquien in Italien, Griechenland, in den Niederlanden, Polen und Russland auf.
Schutz für Kumpel und Mineure
Schon um 1300 wählten die Bergleute Santa Barbara als ihre Schutzpatronin. Der Hinweis in verschiedenen Fassungen der Legende, dass der Berg oder der Fels sich vor ihr öffnete und sie vor dem Vater verbarg, könnte dazu beigetragen haben. Während in der Frühzeit ihre Verehrung in Mitteleuropa nur regional und eingeschränkt nachweisbar ist, gehörte sie vom 14. Jahrhundert an zu den bedeutendsten Heiligen.[1]
Je nach Gefahrenlage durch Seuchen, Kriege oder Naturgewalten hat sich die Bedeutung der Heiligen Barbara gewandelt. Zum Beispiel soll Barbara, als die Weisende, die Bewohner der Gegend um das Bergwerk Gonzen im sankt-gallischen Rheintal, das jahrhundertelang stillgelegt war, erneut auf die Erzgrube hingewiesen haben (vgl. S. 24). Ihre Rolle als Retterin aus Gefahren erzählen unzählige Geschichten über die Rettung von Bergleuten. Von Barbara als der Bestrafenden von frevelhaftem Verhalten wird in Sagen erzählt, in denen zum Beispiel Bergleute an ihrem Gedenktag, dem 4. Dezember, arbeiteten.[5]
Mehr gesellschaftliche als religiöse Bedeutung
Die Verehrung der Barbara als Schutzpatronin und Nothelferin[6] hat sich bis in die Gegenwart hinein wenig verändert. Der Berufsstand der Bergleute und Tunnelbauer zeigt heute noch ein ausgeprägtes Bewusstsein für ihr Patronat. In vielen Bergwerken sind Schreine eingerichtet, in denen die Heilige Barbara dargestellt ist, ebenso wie an den Tunnelportalen. Trotz den technischen Erleichterungen und den fortschrittlichen Gesundheits- und Arbeitsschutzmassnahmen wird die Heilige Barbara zum Schutz vor dem plötzlichen Tod angerufen. Ihre Ausstrahlungskraft überdauerte Jahrhunderte und ist dem Zeitgeist nicht gewichen. Ihre zahlreichen Standorte und von ihr ausgehenden Volksbräuche belegen ihre Wichtigkeit. Ein Heiligenfest wird in der Regel am Todestag des Heiligen gefeiert, da er als der Tag der Geburt für ein himmlisches Leben gilt. Der Barbaratag wird in allen Bergwerken, Stollen und Tunneln des Abendlandes als Feiertag begangen. So ruht auch auf allen Tunnelbaustellen der Schweiz am 4. Dezember die Arbeit. Ungeachtet der Religionszugehörigkeit wird zu Ehren der Heiligen Barbara eine Messe gefeiert. Sie erhält Blumen, man spricht ein Gebet und gedenkt der verunglückten Arbeitskollegen. Anschliessend wird ausgiebig gefeiert.TEC21, Fr., 2010.12.03
Anmerkungen
[1] Rolfroderich Nemitz, Dieter Thierse: St. Barbara, Weg einer Heiligen durch die Zeit. Edition Glückauf, GmbH, Essen, 1995
[2] Hauptstadt der Landschaft Bithynien im nördlichen Kleinasien (heute Izmit, Türkei) zwischen dem Marmara- und dem Schwarzen Meer
[3] Der Hinweis, Santa Barbara habe mit Origenes Verbindung aufgenommen, ist mit der Regierungszeit Maximians nicht in Einklang zu bringen: Das meistgenannte Todesjahr 306 der Heiligen Barbara steht im Widerspruch zur Lebzeit von Origines (185 bis 254)
[4] Als die wahrscheinlichste Lebzeit Barbaras gilt die Zeit zwischen 250 und 310
[5] Rainer Sigrist: Die Heilige Barbara – Eine Laudatio, in Ferrum (80), Tunnelbau – Unterirdische Perspektiven. Eisenbibliothek, Schlatt, 2008
[6] Die Heilige Barbara zählt auch zu den 14 Nothelfern
03. Dezember 2010 Daniela Dietsche
Überdruck unter Luzern
Der Allmendtunnel ist Bestandteil des Projektes Doppelspur und Tieflegung der Zentralbahn Luzern. Der Tagbautunnel wurde unter Überdruck erstellt, um das Grundwasser aus dem Tunnel fernzuhalten und um über die Spundwände dem Erddruck entgegenzuwirken. Das Druckluftverfahren zeigt, dass nicht nur konventioneller Tunnelbau, sondern auch ein Tagbautunnel mit besonderen Herausforderungen verbunden ist. Der Druck im Tunnel betrug 0.68 bar, was einer Tauchtiefe von 6.8 m entspricht. Im Gegensatz zu früher wird dem Gesundheitsschutz und der Arbeitssicherheit grösste Aufmerksamkeit geschenkt.
Die Zentralbahn führt derzeit oberirdisch vom Luzerner Bahnhof durch Neustadtquartiere über die Luzerner Allmend sowie durch die Nachbarkantone Nidwalden und Obwalden bis nach Engelberg und über den Brünig. Um im Zuge einer Angebotserweiterung den Individualverkehr mit der Erhöhung des Fahrtakts auf einen Viertelstundenrhythmus ab dem Jahr 2013 nicht stärker zu beeinträchtigen, ist der Doppelspurausbau sowie die Tieflegung der Zentralbahn unumgänglich. Gleichzeitig wird für Besucher der Messe Allmend und des im Bau befindlichen Fussballstadions eine neue Haltestelle realisiert.
Lage und Geologie des Allmendtunnels
Der Allmendtunnel taucht im Süden über die Rampe Mattenhof mit seinem Scheitel ca. 1.5 m unter der Geländeoberkante ab, unterquert die Allmend und schliesst im Norden an die Haltestelle Allmend an. Das Deckelbauverfahren unter Überdruck wird bis etwa zur Hälfte der Haltestelle Allmend angewandt, wo die Tunneldecke ca. 1.8 m unter Terrain liegt. Im Bereich der Druckluftstrecke stehen Verlandungsbildungen und Seebodenablagerungen aus tonigen, teilweise sandigen Schluffen mit organischen, torfigen und sandig-kiesigen Einlagerungen an. Die angetroffenen Grundwasserverhältnisse bestehen aus einem oberen, freien Grundwasserspiegel und einem unteren, gespannten Grundwasserhorizont. Der Allmendtunnel wird nach seiner Fertigstellung komplett im Grundwasser liegen. Speziell an der Deckelbauweise unter Überdruck ist, dass der seitliche Baugrubenabschluss durch Spundwände sichergestellt wird und nicht durch Schlitzwände oder eine überschnittene Bohrpfahlwand. Diese Methode wurde gewählt, damit keine Bauhilfsmassnahmen im Baugrund verbleiben. Als Bauhilfsmassnahme gegen die äusseren Einwirkungen (Erddruck, Wasserdruck) wird dabei ein entsprechender Überdruck in der Arbeitskammer erzeugt.
Baumethode wird in der Schweiz erstmals angewandt
Der Deckel des Tagbautunnels wird von der Oberfläche her vorauseilend auf zuvor gesetzte Spundwände betoniert. Eine Schleusenwand am Anfang und eine dichte Baugrubenabschlusswand am Ende der späteren Druckluftstrecke begrenzen das Bauwerk. Die beiden Grundwasserstockwerke werden so wenig wie möglich abgesenkt, um die Setzungen weitestgehend zu eliminieren. Der Luftüberdruck hält das Grundwasser auf ca. 1.5 m unter der späteren Tunnelsohle und ersetzt die Spriessung der Spundwände. Er beträgt abhängig von der Tiefenlage des Tunnels zwischen 0.57 und 0.68 bar. Trockenen Fusses wird nun der Tunnel ausgehoben, direkt folgend die Bodenplatte betoniert und mit dem Nachziehen der Wände die Tunnelröhre geschlossen. Damit das Personal den Tunnel betreten und die Materialver- und -entsorgung gewährleistet werden kann, wird eine Personen- und Materialschleuse eingerichtet.
Arbeiten unter Druckluft
Arbeiten unter Druckluft belasten den menschlichen Organismus stärker als Arbeiten in atmosphärischen Bedingungen. Aus diesem Grund müssen alle Mitarbeiter medizinischen Tests unterzogen werden, in denen neben dem allgemeinen Gesundheitszustand u. a. die Herz- und Lungenfunktionalität sowie die körperliche Belastbarkeit überprüft wird. Die Arbeiter dürfen nicht jünger als 18 und nicht älter als 50 Jahre sein, Aufsichtspersonal mit entsprechender gesundheitlicher Eignung kann auch älter sein. Diese Untersuchungen müssen im Jahresrhythmus wiederholt werden. Für den Bau des Allmendtunnels wurden insgesamt 130 Personen auf Drucklufttauglichkeit untersucht und von der Schweizer Unfallversicherungsanstalt (Suva) für Arbeiten in Druckluft zugelassen. Die grosse Anzahl untersuchter Personen setzt sich aus Arbeitern sowie aus Aufsichtspersonal, Bauherrenvertretern, Planern und Monteuren von Gerätelieferanten zusammen.
Um aus atmosphärischen Bedingungen in Überdruckumgebung zu gelangen, muss der Körper langsam an den erhöhten Druck angepasst werden. Dies geschieht in der Personenschleuse, einer an der Schleusenwand angeschlossenen Stahlröhre mit 32 Sitzplätzen, aufgeteilt in zwei Vorkammern mit je sechs Plätzen und einer Hauptkammer mit 20 Plätzen. Jeder Platz ist mit einem Sauerstoffatemregler versehen, der beim Ausschleusen benötigt wird. Das Dreikammersystem der Personenschleuse erlaubt das Durchschleusen von Personal. So können eintretende Personen ausschleusendes Personal passieren. Beim Einschleusen wird kontinuierlich Luft in die Kammer geblasen, damit der Luftdruck steigt und sich dem Tunneldruck anpasst. Das Personal muss dabei regelmässig den sogenannten Druckausgleich machen, bei dem sich die in Gehörgang und Nasenraum befindliche Luftmenge an die steigende Luftmenge in der Kammer anpasst. Nach etwa fünf Minuten ist der Tunneldruck von rund 0.68 bar (der einer Tauchtiefe von 6.8 m entspricht) erreicht, und die Mitarbeiter können den Tunnel betreten. Die Temperaturen betragen 24 °C bis 25 °C, die Luftfeuchtigkeit im Tunnel liegt zwischen 85 % und 99 %.
Diese Bedingungen in Verbindung mit der harten körperlichen Arbeit führen zu hohem Flüssigkeits- und Mineralienverlust bei den Mitarbeitern. Um dies auszugleichen und druckluftbedingten Erkrankungen vorzubeugen, wird das Personal mit warmem Tee versorgt. Pro Schicht sollte jeder Mitarbeiter mindestens zwei bis drei Liter Tee trinken. Die Aufenthaltsdauer unter Überdruckbedingungen war beim Allmendtunnel auf neun Stunden pro Tag und fünf Tage pro Woche begrenzt.
Der Ausschleusvorgang wird durch Schleusentabellen, die von spezialisierten Arbeitsmedizinern eigens für den Allmendtunnel erstellt und genehmigt wurden, geregelt. Dort ist abhängig vom Arbeitsdruck und der Aufenthaltsdauer festgelegt, wie lange der Ausschleus vorgang dauert und der Schleusenwart das Personal auf der Haltestufe 0.5 bar mit medizinischem Sauerstoff versorgen muss. Der Sauerstoff löst den im Blut durch die Überdruckbedingungen angereicherten Stickstoff, der andernfalls zu Drucklufterkrankungen führen könnte. Bei voller Expositionsdauer von neun Stunden dauert der Ausschleusvorgang knapp 20 Minuten.
Besondere Sicherheitsvorkehrungen
Durch den Überdruck von 0.68 bar erhöht sich die Luftmenge im Tunnel um 68 % gegenüber den Normalbedingungen. Somit steigen auch die Mengenanteile der einzelnen Gase in der Luft, die im atmosphärischen Zustand 78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff und 1 % andere Gase enthält. Der höhere Sauerstoffgehalt führt zu erhöhter Brandgefahr. Deswegen sind im Tunnel keine Verbrennungsmotoren zugelassen. Brennbare Materialien dürfen nur in den notwendigen Mengen vorgehalten werden. Es herrscht absolutes Rauchverbot. Die Feuerwehr schulte einen grossen Teil der Belegschaft in Brandbekämpfungskursen. Alle Baumaschinen wurden elektrisch betrieben und mittels einer zentralen Trafostation mit Strom versorgt. Der Aushub wird mit einem elektrisch betriebenen Förderband in dafür bereitgestellte Bodenentleerer verladen, die von batteriebetriebenen Lokomotiven über die Materialschleuse ein- und ausgefahren werden.
Schweiss-, Schneid- und Brennarbeiten sind nur mit einer Person als Brandwache und aufgrund der entstehenden nitrosen Gase mit Rauchgasabsaugung (sogenannte Schlabberleitung) zugelassen. Die Konzentration von Schadstoffen wie Rauchgasen, Staub etc. in der Atemluft erhöht sich ebenfalls entsprechend und muss vermieden beziehungsweise so gering wie möglich gehalten werden.
Erfolgreich und unfallfrei
Druckluftarbeit stellt sowohl an die Menschen als auch an Geräte und Maschinen höchste Anforderungen. Eine detaillierte Planung, Erfahrung mit dieser Bauweise und die strikte Einhaltung der Sicherheitsregeln sind unumgängliche Grundlagen für eine erfolgreiche und vor allem unfallfreie Abwicklung der Baumassnahme. Die Heilige Barbara, die am Tunnelportal über die Arbeiten wachte, musste nicht eingreifen. Ihre Statue wurde nach Abschluss der Arbeiten unter Druckluft am 26. Oktober 2010 an die Tunnelpatin übergeben.TEC21, Fr., 2010.12.03
03. Dezember 2010 Philipp Kohlschreiber