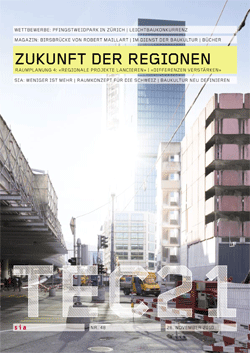Editorial
Dieses Heft ist die letzte von vier Ausgaben, die TEC21 dieses Jahr der Raumplanung gewidmet hat. Nach einem Überblick über Ge-schichte und aktuelle Aufgaben der Raumplanung («Die Schweiz wird knapp», TEC21 10/2010), Gedanken zur Planungskultur («Pla-nungskulturwandel», TEC21 21/2010) und zu neuen Planungsinstrumenten («Ideen im Raum», TEC21 29-30/2010) wirft das vorliegende Heft einen Blick in die Zukunft. Wir haben drei Fachleute, die den räumlichen Wandel aus unterschiedlichen Blickwinkeln verfolgen, ge-fragt, wie sich die Schweiz künftig entwickeln wird, welche Gefahren drohen und welche neuen Wege gangbar scheinen.
Der Geograf Christian Schmid, die Ökonomin Irmi Seidl und der Architekt Gion A. Caminada sind sich einig: Unser heutiger Umgang mit Boden und Raum zerstört nicht nur ökologische Lebensgrundlagen, die Zersiedelung führt auch zur Ausnivellierung regionaler Unter-schiede. Damit trägt sie zum Verschwinden einer schweizerischen Eigenart, der kulturellen Vielfalt, bei und bedroht eine weltweit seltene räumliche Qualität: die Nähe urbaner Zentren zu intakten Landschaften.
Gefördert wird dies durch falsche Anreize wie die pauschale Subventionierung von Infrastruktur in dünn besiedelten Gebieten oder die steuerliche Abzugsfähigkeit von Pendelkosten. Und die weitgehende Autonomie von Gemeinden und Kantonen, einst erfolgreiches Ge-genrezept zu einem ineffizienten Zentralstaat, führt beim heutigen forcierten Wettbewerbsdenken dazu, dass gemeinsame Interessen ver-gessen gehen. Eine Stärkung der Planungskompetenzen auf Kantons- und Bundesebene ist politisch umstritten. Jedoch könnte ein gang-barer Weg über die Kostenwahrheit führen, also über das Umlegen aller Kosten der Zersiedelung auf die Verursacher.
Einig sind sich die Gesprächspartner auch darin, dass es dann darum ginge, die Profile der Regionen wieder zu stärken, deren Eigenhei-ten und Spezialitäten zu fördern und dazu die Bevölkerung einzubinden, deren Kreativität heute zu wenig genutzt wird. Mehr direkte Kommunikation zwischen den Regionen, etwa zwischen Stadt- und Bergbewohnern, könnte allen nützlich sein. So wären gegenseitige Erwartungen, neue Ideen, aber auch gemeinsame Interessen (wieder) zu entdecken.
Die Fotos in den vier Raumplanungsnummern stammen von Hannes Henz. Nach den Bergen, der Agglomeration und dem Land hat er nun den vierten «Landesteil», die Stadt, besucht. Im herbstlichen Zürich hat er nach Urbanität gesucht und sie vor allem dort gefunden, wo die Stadt gegenwärtig umgebaut wird.
Auch 2011 werden vier TEC21-Ausgaben spezielle Aspekte der Raumentwicklung behandeln. Nr. 7 vom 11. Februar fragt unter anderem: Verdichten ja, aber wie?
Claudia Carle, Ruedi Weidmann