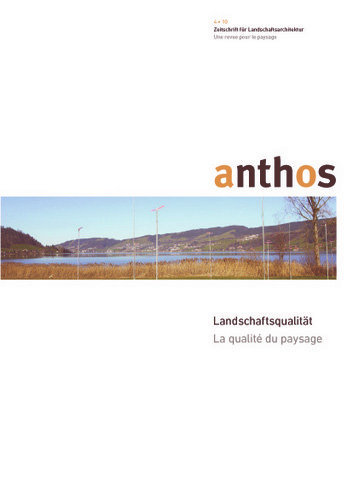Editorial
Natürlich, jeder Mensch empfindet einen Ort auf seine Weise. Wahrnehmung ist immer individuell, nie objektiv. Trotzdem scheint es eine Art von Grundübereinstimmung zu geben, welche Orte eine höhere und welche eine geringere Qualität aufweisen.
So wird der rasante Flächenverbrauch, der nach wie vor auch die Siedlungsflächenentwicklung der Schweiz kennzeichnet, als problematisch eingeschätzt. Diese schnellen Veränderungen erzeugen Unbehagen, da und dort gar Ratlosigkeit. Und wo die Landschaft zur Ware wird, und nur noch der Tourismus mit «heile Welt»-Bildern lockt, herrscht ein eklatanter Widerspruch zwischen Anspruch und Realität, der sich wohl in keinem anderen europäischen Land so schnell zuspitzt wie in der Schweiz.
Vor diesem Hintergrund taucht die berechtigte Forderung nach mehr Landschafts-Qualitäts-Planung auf. Eine kleine Gemeinde in der Agglomeration von Thun macht es vor: Potenzielle Baugebiete sollen nicht mehr eingezont, sondern nur auf Stufe von Nutzungskonzept und Richtplan definiert und mit einem Anforderungsprofil belegt werden. Bauwillige haben aufzuzeigen, wie sie die Anforderungen umzusetzen gedenken, welcher Mehrwert für das Dorf entsteht und wie sie die Anlage in die Landschaft integrieren wollen. Ein solches Vorgehen zur qualitativen Entwicklung erfordert eine umfassende Analyse des Ortes, es erfordert das Denken über sektorale, hierarchische und administrative Grenzen hinweg. Dazu gehören könnten auch das Erforschen des Unsichtbaren, das Beschreiben akustischer Verhältnisse. Durch sorgfältige Analysearbeit nähern wir uns dem Wesen des Ortes, der über Jahrhunderte gewachsenen Kultur. Dieser Verständnisprozess ist gleichzeitig Entwicklungsprozess und leitet uns schlussendlich zu einer gemeinsamen Vorstellung, auf welche Art und Weise sich ein Ort verändern soll. Dort, wo diesen Prozessen Raum und Zeit eingeräumt werden, können wir Orte und Landschaften schaffen oder pflegen die Neugierde wecken, die alle Sinne ansprechen, die Schutz und Geborgenheit bieten. Qualität muss jedoch immer neu gesucht und eingefordert werden.
anthos möchte ermuntern, über die Qualität von Freiräumen und Landschaften nachzudenken und zu diskutieren – und gemeinsam mit der Bevölkerung vor Ort Ziele zu entwickeln. Mal philosophisch, mal wissenschaftlich, mal konkret nähert sich diese Ausgabe dem Thema an, und schnell wird klar, dass die Qualität einer Landschaft weit mehr als die Summe ihrer quantifizierbaren Elemente ist.
Stefan Kunz, Sabine Wolf
Inhalt
Yvonne Christ
- Der Klang der Landschaft
Markus Steiner, Adrian Kräuchi
- Landschaftsqualität im Richtplan verankern!
Markus Richner Kalt
- Direktzahlungen für Landschaftsqualität
Andreas Erni
- Die Macht des Lärms
Stéphanie Perrochet
- Schwarz – rot – blau
Pierre-Alain Rumley
- Landschaftsqualität und Raumplanung
Daniel Zimmermann
- Lauberhornrennen im Sommer
Hans Weiss
- Die Wa(h)re Landschaft
Marcel Hunziker, Robert Home, Jacqueline Frick
- Menschensicht
Joachim Kleiner
- Quo vadis?
Sabine Wunderlin
- Vorher/nachher am Ägerisee
Christine Neff
- Modell für eine nachhaltige Landschaftsentwicklung: Stiftung Pro Terra Engiadina
Brigitte Nyffenegger
- Freiraumkonzept Birsstadt
Susanne Isabel Kröger-Yacoub
- Luxus der Weite als Raumprogramm
- International Federation of Landscape Architects
- Wettbewerbe und Preise
- Schlaglichter
- Mitteilungen der VSSG
- Literatur
- Agenda
- Schweizer Baumschulen
- Produkte und Dienstleistungen
- Markt
- Die Autoren
- Impressum und Vorschau
Der Klang der Landschaft
Die «Qualität» der Landschaft wird meist anhand visueller Charakteristika fest gemacht. Ihr Klang wird vernachlässigt.
Es regnet in Strömen. Die Aufmerksamkeit der Ohren reicht nur wenige Meter in das Rauschen hinein. Die Ferne verschwindet, die Umgebung wird zum akustischen Kokon, durchbrochen von heransirrenden Windböen und vereinzeltem Pferdegewieher. So klingt Landschaft. Oder besser, dies ist eine der unendlichen Möglichkeiten, die sich so zugetragen hat, aber auch ganz anders hätte sein können.
Akustische Raumqualität
Auf das Thema akustische Raumqualität bin ich bei landschaftsästhetischen Bewertungsarbeiten im Feld gestossen. Die sichtbaren Elemente waren auf dem Aufnahmebogen erfassbar und wurden durch eine Fotografie dokumentiert. Rasch war klar, dass mit der benutzten Bewertungsmethode nach Wöbse[1] die hörbaren Elemente indes nur rudimentär aufgenommen werden können. Dies steht in Widerspruch zur Macht von Geräuschen: Das atemberaubendste Bergpanorama, der lieblichste Flusslauf und die ergonomisch ausgefeilteste Sitzbank bieten keine Aufenthaltsqualität, wenn der lokale Geräuschpegel irritiert oder überraschende Klänge stören.
Im Masterprogramm an der ZHdK habe ich einen akustischen Aufnahmebogen erarbeitet, welcher die optisch orientierten Systeme ergänzen könnte. Die Auseinandersetzung mit der hörbaren Dimension von Landschaft erwies sich als eine Entdeckungsreise zu persönlichen Raum- und Landschaftsvorstellungen, welche ich mir über die Jahre unbemerkt zurecht gelegt hatte. Je nach hörender Person und individuellen Präferenzen wird eine akustische Situation anders gehört und bewertet: Scheint ein Geräusch wichtig, realisiert man es bewusst, wird es als unwichtig eingestuft, kann es gut «überhört» und somit nur unbewusst wahrgenommen werden. Wie jede Fertigkeit kann auch Hören trainiert werden. Was für Musik und Profimusiker nahe liegend ist, könnte auch für Geräusche und Klänge im öffentlichen Raum denkbar sein.
Raumorgan Ohr
Das Gehör dient zusammen mit dem Gleichgewichtssinn als dreidimensionales Raumorgan. Dank der relativ langsamen Schallausbreitung von 330 Meter pro Sekunde können wir die Raumtiefe zuverlässig einschätzen. Das auditorische System hat eine sehr schnelle Reizaufnahme: Ein digitales Musikstück weist eine Taktfrequenz von einer vierzigtausendstel Sekunde auf, damit man keine Störung der Schallübertragungsinformation hört.[2] Dagegen stehen 25 Bilder pro Sekunde, die eine Bilderabfolge als bewegten Film erscheinen lassen!
Akustische Landschaft erfassen
Der «Aufnahmebogen zur Dokumentation akustischer Erlebnisqualität» ist als Leitfaden gedacht, um eine Situation an einem bestimmten Ort in einer bestimmten Zeitspanne akustisch zu erforschen. Die gehörten Einzelheiten werden vor Ort und später zuhause anhand einer Tonaufnahme möglichst genau schriftlich festgehalten. Die Dokumentation kann dazu dienen, akustisch interessante Orte zu erkennen, zu benennen und gezielt weiter zu entwickeln. Es könnten damit auch akustische Entwicklungen unterhalb der Lärmgrenze über eine längere Zeit verfolgt werden. Möglich wäre auch, den Bogen als Hör-Schulungs-Instrument zu verwenden. In allen Fällen ist die Auseinandersetzung mit dem untersuchten Landschaftsausschnitt sehr zeitintensiv und setzt einen gezielten Auftrag voraus. Da die Erfassung der akustischen Landschaft sehr subjektiv ist, ist es wichtig, die erfassten Parameter zunächst möglichst genau zu benennen. Falls mehrere Personen beteiligt sind, ist ein gemeinsames Verständnis der verwendeten Begriffe wie «Geräuschdiversität: hoch-mittel-niedrig» durch Tests und eine Art Eichung unumgänglich, um zu vergleichbaren Resultaten zu kommen. Eine Eichung sollte sich an den Eckpunkten der benutzten Parameter orientieren, welche zwar von Ort zu Ort unterschiedlich sein können, jedoch innerhalb einer Forschungsfrage konsistent bleiben müssen.
Die Gliederung des Raumes in einen weiter entfernten «Hörbereich 2. Priorität» und einen näher gelegenen und unmittelbar präsenten «Hörbereich 1. Priorität» hat sich bewährt. Der «Klangregler» am Ende der Seite dient der Erfassung der Qualität einzelner Schallquellen: Je gleichmässiger Schallwellen in den Raum schwingen, umso eher wird ein Klang als Ton(-höhe) gehört. Breiten sich Schallwellen unregelmässig im Raum aus, erscheint ein Klang als Geräusch. Diese Feinunterteilung offenbart ungeahnte akustische Raumqualitäten, die als Basis anschliessender konzeptionell-strategischer Überlegungen dienen können. Der Bedarf danach ist schon heute gross.
Gesundheitsrisiko Lärm
Aktuell lässt die jährliche Lärmbelastung durch Strasse und Schiene geschätzte 125 Millionen Schweizer Franken an Gesundheitskosten auflaufen, zusätzlich entstehen circa 875 Millionen Franken Kosten durch Mietminderung.[3] Die Belästigung durch Lärm ist in der Schweiz die am häufigsten wahrgenommene Umweltbelastung. Rund 2,2 Millionen Menschen – knapp ein Drittel der Bevölkerung – sind tagsüber Strassenverkehrslärm über dem Grenzwert ausgesetzt, nachts 2,1 Millionen.[4] Bahnlärmmessungen werden im Auftrag des Bundesamtes für Verkehr an sechs charakteristischen Standorten in der ganzen Schweiz durchgeführt. Die Messstationen sind das ganze Jahr rund um die Uhr in Betrieb und erfassen die Lärmemissionen und ergänzende Messparameter jeder Zugsdurchfahrt, die Messresultate werden publiziert.[5] Angesichts der wachsenden Mobilität werden Erfolge in der Lärmreduktion teilweise wieder aufgehoben.[6] Lärmminderung durch emissionsärmere Reifen[7] und lärmmindernden Strassenbelag könnten als Elemente eines Gesamtkonzeptes die Situation dennoch entschärfen.
Zuständigkeitslücke
In der Beschäftigung mit der hörbaren Landschaft sind einige Dinge ohrenfällig: Verkehrs- und Wettergeräusche, tierische und menschliche Emissionen und die Messbarkeit des jeweiligen Schalldrucks in der Einheit Dezibel. Hört man genau hin, schälen sich Nuancen und Varianten heraus, die hochinteressant, jedoch schwierig quantifizier- und benennbar sind. Landschaftsakustische Phänomene unterhalb des Lärm-Grenzwertes sind heute kaum wissenschaftliche Untersuchungen wert. Dabei ist die Qualität des hörbaren öffentlichen Raumes ein hoch interessantes Studienobjekt. Wer aber wäre dafür zuständig? Da das Amt für Lärmschutz nicht in Frage kommt (dieses ist erst oberhalb des Grenzwertes zuständig), vielleicht Touristiker (Erholung durch Ruhe) oder Pädagogen (ungestörte kindliche Sprachentwicklung durch störungsfreie Hör-Umgebung). Auch Ingenieure und Akustiker könnten sich ins Zeug legen!
Ohrraumpioniere
Tatsächlich sind es vor allem Kunstschaffende, die sich des Themas annehmen. Sie messen keine Dezibelwerte, sondern greifen mit subtilen Aktionen in den Klang der Landschaft ein. Punktuelle grossflächige Aktionen wie die Klangnacht in Rümlingen[8] oder die Bespielungen des Jurahanges zwischen Ligerz und Tüscherz[9] stehen neben kleineren, länger andauernden lokalen Installationen[10].
Überlieferungen zur Arbeit am Klang der Landschaft sind aber weit älter. So enthält beispielsweise das futuristische Manifest «Die Kunst der Geräusche – Mailand, 11. März 1913» des Klangkünstlers Luigi Russolo Ausführungen zu unterschiedlichen Klangwerten von Bäumen. In den 1960er-Jahren versuchten Pioniere wie der Komponist R. Murray Schafer und der Stadtplaner Michael Southworth, Prinzipien akustischen Designs zu entwickeln.[11] 1970 wurde in Vancouver das «World Soundscape Project» initiiert, welches die akustische Landschaft kategorisieren wollte. Schafers Nachfolger Barry Truax[12] stellte die CD «Handbook for Acoustic Ecology»[13] zusammen.
In der Schweiz ist unter anderen der Geograf Justin Winkler eine prägende Figur der kleinen Soundscape-Szene, welche mittlerweile weltweit vernetzt ist und in der Zeitschrift «The Soundscape Journal»[14] ihre Aktivitäten dokumentiert. Im Internet werden auf «klanglandschaft.org» laufend aktuelle und vergangene Projekte vorgestellt.[15]
In Zukunft sollte es nicht nur darum gehen, Lärm zu verbieten. Um Raum- und Landschaftsidentität zu erhalten, brauchen wir einen bewussteren Umgang mit den zwei polarisierenden Extremen laut und leise, und ein viel grösseres Erfahrungswissen zu den dazwischen liegenden Qualitäten der Klänge und Geräusche im öffentlichen Raum. Die gezielte Beschäftigung auch mit dem urbanen Hörraum ist ein ungehobener Schatz vor unseren Haustüren, der mehr Aufmerksamkeit und Pflege verdient hätte.anthos, Fr., 2010.11.26
[*] Die Bilder hat Karen Kägi 2010 für ihre Masterarbeit «Landschaft im Siedlungsraum» im Rahmen ihres Master of Arts in Design | Kommunikation | Erkenntnis-Visualisierung an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK erarbeitet. Das Projekt fand in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL statt. Informationen und Kontakt: http://www.karen-kaegi.ch.
[1] Wöbse, H.H.: Landschaftsästhetik: Über das Wesen, die Bedeutung und den Umgang mit landschaftlicher Schönheit. Stuttgart 2002.
[2] Schweizerische Interpretenstiftung SIS, Fachgruppe Gesundheit (Hrsg.): Tagungsmappe Interdisziplinäres Symposium
«Gefahren für das Musikalische Gehör». Tonhalle Zürich. Zürich 2002.
[3] Bundesamt für Raumentwicklung (ARE): Externe Lärmkosten des Strassen- und Schienenverkehrs der Schweiz, Aktualisierung für das Jahr 2000. Bern 2004.
[4] Bundesamt für Raumentwicklung (ARE): Externe Gesundheitskosten durch verkehrsbedingte Luftverschmutzung in der Schweiz, Aktualisierung für das Jahr 2000. Bern 2004.
[5] Aktuelle Daten und periodische, kommentierte Messberichte zum Download http://www.bav.admin.ch/ls/01300/index.html?lang=de. (Zugriff 20.9.2010)
[6] BSF/BAFU: Umweltstatistik Schweiz in der Tasche 2010. http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01548/index.html?lang=de. S. 12. (Zugriff 20. 9. 2010)
[7] http://www.bafu.admin.ch/laerm/01146/07468/index.html?lang=de.
[8] www.neue-musik-ruemlingen.ch.
[9] www.viniterra.ch, 21. August 2010 in Biel, CH.
[10] http://www.kronberg.ch/hoerwanderung.htm.
[11] Bernius V.; Kemper P.; Oehler R.; Wellmann, K.-H. (Hrsg.): Der Aufstand des Ohrs – die neue Lust am Hören. Göttingen 2006.
[12] http://www.sfu.ca/~truax/index.html
[13] Truax, B. (Hrsg.): Handbook for Acoustic Ecology, CD-ROM Edition. Cambrigde 1999.
[14] http://interact.uoregon.edu/MediaLit/wfae/library/new_newsletter/NSNL02.html und http://www.sfu.ca/sonic-studio/.
[15] siehe http://www.klanglandschaft.org/, dort stösst man auch auf vergangene Projekte wie «Davos Soundscape» , eine Auftragsarbeit des Davos Musikfestival 2007: http://www.davosoundscape.ch/.
26. November 2010 Yvonne Christ
Landschaftsqualität im Richtplan verankern!
In der Region Thun-InnertPort lösen interdisziplinärer Dialog, qualitative Verfahren und Richtlinien die klassischen Schongebiete ab auf einem neuen Weg zu einer funktionalen und ästhetischen Landschaft.
Landnutzung und Bauen in der Landschaft sind keine persönlichen Grundrechte eines Landbesitzers. Landnutzung unterliegt stets Rechten, welche durch die Gesellschaft vergeben werden. Die Gesellschaft mit ihren demokratischen Instrumenten hat es in der Hand, den Anspruch an eine umweltgerechte, schonende sowie sozial- und landschaftsverträgliche Nutzungs- und Bauweise einzufordern.
Neue Ansätze führen zur Qualität
In der Region Thun-InnertPort (TIP) wurde der klassische Ansatz der Schongebiete verlassen, um einen flächendeckenden Qualitätsansatz mit fachlicher Begleitung zu verfolgen. Der Grund dazu lag insbesondere im Umstand, dass die «alten» isolierten Schongebiete nur Teile der Landschaft abdeckten. Das Bedürfnis, einen Dialog hinsichtlich einer besseren baulichen Qualität zu führen, wurde zu wenig gepflegt. In einem ersten Schritt näherte sich eine paritätisch zusammengesetzte Arbeitsgruppe den relevanten Elementen landschaftlicher Qualität auf empirische Art, um anschliessend die Grundzüge der Gestaltung in Form von Richtlinien und Verfahrensvorschlägen im regionalen Richtplan festzulegen. Die Richtlinien der Region TIP behandeln insbesondere das Bauen ausserhalb der Bauzone, obwohl der Anspruch an Qualität auch innerhalb der ordentlichen Bauzonen heute selten zur vollen Zufriedenheit erfüllt ist. Um dem Anspruch an eine hohe Landschaftsqualität gerecht zu werden, sind integrale, die ganze Landschaft abdeckende, bau- und landschaftsästhetische Ansätze notwendig.
Integrale Sichtweise
Die heute meist praktizierte Beschränkung auf ökologische Landschaftsinventare deckt nur einen Teil der funktionalen landschaftlichen Beziehungen ab. Die Qualitätsdiskussion erfordert die Erweiterung um ein ganzheitliches, auch Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur umfassendes Inventar in Form der Erfassung von Charakterräumen, welche Atmosphärisches oder Imponderables einer Landschaft mit beinhalten.
Wie lässt sich Qualität einfordern? Philosophen haben sich seit jeher damit befasst, das Wesentliche, Ewige, Unvergängliche und Elementare in der gewordenen realen Abstraktion zu suchen. Platon, Aristoteles, Hegel, Goethe und Schiller haben es unter anderem im Wahren, Guten und Schönen gefunden.
Mit dem Wahren ist der Verstand, als Element der Erfahrung, angesprochen. Er zielt auf die innere Funktion, die Sinnhaftigkeit, Authentizität und Echtheit einer Baute oder Landschaftsveränderung. Im Guten liegt die vernünftige Absicht für die Zukunft, für welche Ideen, Ideale und deren Wirkung auf Gesellschaft, Wirtschaft, und Kultur (Synthese Kulturlandschaft) stehen. Im Schönen wird die Ästhetik beschrieben als erscheinende Synthese des Wahren und Guten. Zwei Elemente der qualitativen Entwicklung sind deshalb erforderlich:
– Die rationalen, analytischen Grundlagen (das Wahre) in Form von Vorgaben und Richtlinien. Diese stützen sich auf jeweilige formale und funktionale Räume. Der Charakter und die strukturbildenden Elemente dieser Räume werden abgeleitet von Bildern, Kunstwerken oder weiteren Formen wie Emotionen und Stimmungen, welche das Wesentliche einer Landschaft oder eines Raumes bilden.
– Der zu leistende, verbessernde, ethische und moralische Beitrag (das Gute) an eine intakte Um- und Mitwelt. Er zeigt auf, wie sich ein Projekt verhält, wie es sich in vorhandene Räume und Strukturen eingliedert oder welche besondere Stellung – und aus welchem Grund – es einnehmen muss.
Landschaftsqualität als Bestandteil des Verfahrens
Die Umsetzung erfordert eine enge Begleitung durch Fachleute verschiedener Disziplinen. Landwirtschaftliche Organisationen, Architekten, Investoren, aber auch die Behörden werden sensibilisiert, um bei Bauvorhaben frühzeitig die nötige Begleitung bereit zu stellen. Schwieriger ist es in den Dörfern mit ordentlichen Bauzonen. Sobald eine Liegenschaft erworben ist, fällt es den Behörden vielfach schwer, qualitative Aspekte zu realisieren, wenn Art und Mass der Nutzung eingehalten worden sind. Qualitative Verfahren sind zwar oft in den Gemeindebaureglementen verankert, doch hat die Erfahrung gezeigt, dass Qualität von Bauten und Anlagen dadurch nicht unbedingt besser werden. Qualität muss immer neu gesucht und vor einer Nutzungsvergabe, im Rahmen von Nutzungsplänen, eingefordert werden!
Wegweisendes Pilotprojekt
Seftigen, eine kleine Gemeinde in der Agglomeration von Thun, macht es vor. Potenzielle Baugebiete werden nicht mehr eingezont, sondern nur auf Stufe von Nutzungskonzept und Richtplan definiert und mit einem Anforderungsprofil belegt. Investoren und Bauwillige haben aufzuzeigen, wie sie die Anforderungen umzusetzen gedenken, welcher Mehrwert beispielsweise für das Dorf entsteht und wie sie die Anlage in die Landschaft integrieren wollen. Erst nach diesem Bewerbungsverfahren werden die Flächen im Einzelverfahren, gestützt auf ein Gesamtkonzept, der Gemeindeversammlung zur Einzonung vorgelegt. Nutzungen brauchen dabei nicht auf immer und ewig vergeben zu werden. In einzelnen Fällen ist es sogar sinnvoll, diese zeitlich zu begrenzen. Die Diskussion um Kulturlandverbrauch könnte unter diesen Voraussetzungen anders, allenfalls auch entspannter, geführt werden.anthos, Fr., 2010.11.26
26. November 2010 Markus Steiner, Adrian Kräuchi