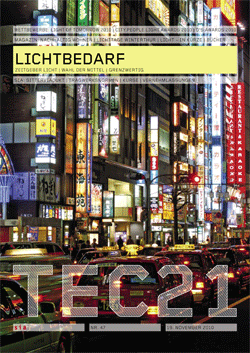Editorial
Menschen, Tiere und Pflanzen brauchen Zeitgeber, um sich mit ihrer Umwelt zu synchronisieren. Licht ist neben den Jahreszeiten, dem Mondzyklus sowie Ebbe und Flut einer der wichtigsten dieser Zeitgeber. Sie alle haben es über die Jahrtausende geschafft, dass sich unsere innere Uhr entwickelt hat und wir heute perfekt an einen 24-Stunden-Tag angepasst sind. Dennoch ist diese Uhr bei jedem Men-schen verschieden. Es gibt die sogenannten Lerchen, die Frühmenschen, und es gibt die Eulen, die abends länger wach und aktiv sein können.
Mit starkem künstlichem Licht können Wachheit und Müdigkeit beeinflusst und an andere Lebens- oder Arbeitsumstände angepasst wer-den. Dabei kann zu viel Licht zur falschen Zeit aber medizinische Probleme hervorrufen und uns aus dem Takt bringen. Zu wenig Licht – vor allem im Alter – verunmöglicht es anderseits, dass wir überhaupt in einen Takt gelangen. In manchen Altersheimen werden deshalb seit einigen Jahren Lichtdecken eingesetzt, die sehr stark den Raum erhellen («Zeitgeber Licht», S.16ff.). Erste Studienergebnisse zeigen, dass die Heimbewohnerinnen und -bewohner gut auf die Beleuchtung ansprechen, wacher und leistungsfähiger sind und nachts besser schlafen. Nachfolgestudien wollen nun untersuchen, ob dynamische Beleuchtungen eine zusätzliche Verbesserung des Tagesrhythmus ermöglichen.
Dynamische Beleuchtungen können zum Beispiel mit Leuchtstofflampen und mit RGB-LED erreicht werden. LED-Lichtwände haben den Vorteil, dass jeder Leuchtpunkt einzeln angesteuert werden kann – so werden auch bewegte Bilder möglich. Verglichen mit herkömmli-chen Leuchtmitteln haben LED aber auch noch einige Nachteile – der Artikel «Wahl der Mittel» (S. 19ff.) zeigt den Stand der Dinge. Mit LED und den passenden Optiken ist vieles möglich geworden. Dies weckt Bedürfnisse, und manchenorts werden heute aus einfachen Firmenbauten farbig und digital bespielte Leuchttürme («Grenzwertig», S. 23ff.).
Da es noch keine gesetzlich verbindlichen Grenzwerte gibt, die «zu viel» Licht in der Umwelt definieren, ist Beleuchtung derzeit beliebig stark und oft einsetzbar. Wie viel künstliches Licht wir als angenehm empfinden und ab wann es uns stört, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Auch wenn Chronobiologen empfehlen, nicht gegen die eigene Zeit zu leben und nicht die biologische Nacht zum Tag zu machen, tun wir es häufig – unsere Lebensumstände entsprechen dem chronotypischen Lebenswandel nur wenig.
Katinka Corts
Zeitgeber Licht
Die Lebensqualität älterer Menschen mit Demenz, die in Heimen leben, kann merklich gesteigert werden, wenn biologisch wirksame Beleuchtung in zentralen Räumen eingesetzt wird. In zwei Wiener Altersheimen führte das Dornbirner Kompetenzzentrum Licht in den letzten Jahren Beleuchtungsstudien zur Wirkung von dort eingesetzten Lichtdecken durch.
Licht dient einerseits und im Wesentlichen der visuellen Informationsaufnahme. Andererseits entwickelt es eine biologische Wirkung, indem es über entsprechende Rezeptoren den Tag- Nacht-Rhythmus, den sogenannten circadianen Rhythmus, des Menschen beeinflusst.[1],[2] Dabei kann eine zu geringe Lichtdosis am Tag Beeinträchtigungen dieses Rhythmus zur Folge haben, was sich in Schlafstörungen oder in depressiven Verstimmungen äussert. Der Lichtdurchlass der Augenlinse ist im Alter eingeschränkt (Abb. 5), und zudem nimmt der wirksame Pupillendurchmesser bei ansonsten gleichen Beleuchtungsbedingungen ab. Beide Effekte zusammen haben zur Folge, dass bei älteren Menschen deutlich weniger Licht auf die Netzhaut fällt als bei jüngeren, und entsprechend höher ist auch die Wahrscheinlichkeit von Störungen des circadianen Rhythmus (vgl. TEC21 8/2008, S. 26 ff.).
Zielgruppe Demenzkranke
Demenzkranke, die in Heimen leben, bewegen sich wenig im Freien, sind am Tag müde und in der Nacht unruhig.[3],[4] Mit Blick auf die demografische Entwicklung und die mit dem Alter drastisch zunehmende Anfälligkeit für Demenzerkrankungen[5] ist die Untersuchung jener Faktoren von Bedeutung, die Aussicht auf eine Besserung bzw. Erhaltung des Status quo versprechen könnten. Auch wenn der Krankheitsverlauf wahrscheinlich nicht gestoppt werden kann, so besteht doch Hoffnung, ihn abzumildern.
Künstliche Beleuchtung, die den Standards folgt, genügt zwar zum Erfüllen von Sehaufgaben, aber die Lichtstimmung entspricht biologischer Dunkelheit. Überdies verschlechtert sich die Lichtsituation insbesondere in den tageslichtschwachen Jahreszeiten, vor allem, wenn es sich um Heime in engen Bebauungssituationen handelt. Das bedeutet, dass bei diesem Personenkreis die krankheits- und altersbedingte Beeinträchtigung des Tag- Nacht-Rhythmus durch eine ungeeignete und/oder ungenügende Innenraumbeleuchtung potenziert wird. Diese Erkenntnisse über die biologische Wirkung von Licht werden nun eingesetzt, um speziell zu den tageslichtschwachen Jahreszeiten den Wach- und Schlafrhythmus der Bewohner zu stabilisieren. Künstliches Licht mit hohen Farbtemperaturen von 8000 K, was einem bläulichen Weiss entspricht, wird über einen Fotorezeptor im Auge aufgenommen. Es kann die Zeitgeberfunktion des natürlichen Lichts übernehmen und direkt auf die Hormonproduktion im Körper einwirken, um die Ausschüttung von Melatonin zu steuern.
Forschung im Altersheim
Eine erste Versuchsreihe wurde in Österreich bereits im Zeitraum 2006 bis 2009 im Wiener Altersheim St. Katharina durchgeführt. Die Lichtinstallation bewirkt, dass die Aufenthaltsund Gangbereiche am Tag sehr hell erscheinen und zum Abend hin dunkler werden. Grossflächige Leuchten wurden zu einer Lichtdecke zusammengesetzt, in die Lampen mit mehreren Lichtfarben integriert sind. Diese können in Gruppen gleicher Farbtemperatur angesteuert werden. So lässt sich stufenlos sowohl die Helligkeit (Beleuchtungsstärke bis maximal 3000 lx) als auch die Farbtemperatur (zwischen 3000 und 8000 K) verändern. Am Abend werden die Wände mit Strahlern beleuchtet, die Lichtdecke ist ausgeschaltet. Die zweite Versuchsreihe wurde in einem Altersheim der Caritas Socialis in Wien durchgeführt. Auch hier erhellen grossflächige Leuchten die Aufenthalts- und Gangbereiche der Demenzstation. Die Lichtsituation kann gewählt werden, vom statisch gleichen bis zum dynamisch veränderlichen Licht. In einem Fall verändert sich das Licht über den Tag: Es beginnt am Morgen mit wärmeren (leicht gelblichen) Farbtönen zu leuchten, steigert sich dann in helles blauweisses Licht und geht am Nachmittag wieder auf geringere Helligkeit im warmweissen Ton zurück. Beide Beleuchtungsanlagen wurden im Rahmen einer Gebäudesanierung installiert.
Bewertung verschiedener Lichtsituationen
Bei der Untersuchung im Altenheim am Rennweg wurden drei verschiedene Lichtsituationen eingesetzt. Referenz als Baseline war eine warmweisse Beleuchtung (300 lx / 3000 K; zwei Wochen). Darauf folgten in der Zeit von 9 bis 15 Uhr zuerst das Programm L1 mit einer erhöhten Beleuchtungsstärke (800 lx / 8000 K; drei Wochen) und als nächstes das Programm L2 (1200 lx / 8000 K; drei Wochen). Für den Rest des Tages wurde ein warmweisses Licht (800 lx / 3000 K) eingesetzt. Um die Wirkungen auf die Bewohnerinnen und Bewohner zu untersuchen, erstellten Personal und Beobachter Protokolle. Zum Ersten wurde das Pflegepersonal mittels Fragebögen (Nosger-Skala [Depressionsskala] und CMAI [Agitationsskala]) und strukturierten Interviews alle zwei Wochen nach seinem Eindruck befragt. Darüber hinaus protokollierte der Nachtdienst Unterbrechungen des Schlafs der Bewohner im 2-Stunden-Rhythmus. Je zwei Beobachter schätzten anhand eines Kriterienkataloges ein, ob und wie sich das Verhalten der Bewohner veränderte (Aufenthalt im Sozialbereich, Veränderung des Aufenthalts im Sozialbereich, Häufigkeit der Kommunikation mit anderen Bewohnern und Pflegepersonen, Selbstständigkeit beim Essen und Trinken). Die Beobachter schätzten ebenfalls die Bewohnerinnen und Bewohner auf den beiden genannten Skalen im zweiwöchigen Rhythmus ein. Die Aktivitäts- und Schlafmuster der Testpersonen wurden mit «Actiwatches» erfasst.
Die Einschätzungen der Beobachter zeigten Verbesserungen bezüglich Gedächtnisleistung, Emotion und instrumentelles Handeln, insbesondere während L2. In beiden Lichtsituationen schliefen die Bewohner ruhiger, und die Schlafunterbrechungen nahmen ab. Hinsichtlich der Beobachtungsdaten zeigte sich, dass die Bewohner insbesondere in der L2 mehr kommunizierten, vor allem untereinander. Der Bewegungsdrang der eher unruhigen Personen nahm deutlich ab. Die Lichtdecken blieben auch nach der Studie in Betrieb, in der nächsten Projektphase sollen weitere dynamische Abläufe eingespielt werden.
Weniger Medikamente dank mehr Licht?
Die positiven Trends zur Verbesserung der Lebensqualität im Alter geben Hoffnung, durch weitere vertiefende Untersuchungen und Verbesserungen der Lichtsituationen statistisch deutlichere Aussagen treffen zu können. Im Folgeprojekt werden diese Untersuchungen über die kommenden vier Jahre in einem Neubau der Caritas Socialis mit wesentlich mehr Bewohnern durchgeführt. Bereits jetzt gibt es viele Anfragen von Betreibern von Altenheimen bei den beteiligten Projektpartnern.
Mit einer deutlich verbesserten, hellen Beleuchtung – wie hier mit gesteuerten Lichtdecken – können Beleuchtungsmissstände behoben werden. Im Vergleich zu Standardbeleuchtungen wirken die Räume viel freundlicher und einladender. Sowohl Bewohner als auch ihre Besucher und das Pflegepersonal reagieren positiv. Eine solche Beleuchtungsanlage kostet zwar mindestens das Fünffache einer Standardbeleuchtung – umgerechnet knapp einen Euro pro Tag und Bewohner. Das ist aber deutlich weniger als die Medikamente, die ansonsten für einen besseren Schlaf eingesetzt würden.
AutorInnen
Peter Dehoff, Zumtobel Lighting GmbH, Schweizer Str. 30, A-6851 Dornbirn
Charlotte A. Sust, ABoVe GmbH, Dresdener Str. 11, D-35435 Wettenberg
Dieter Lorenz, FH Giessen-Friedberg, Wiesenstr. 14, D-35390 Giessen
Peter Hein, Kompetenzzentrum Licht (neu): Dr. Anton Schneider Str. 2 T6, A-6850 Dornbirn
Robert Oberndorfer, Caritas Socialis, Oberzellergasse 1, A-1030 WienTEC21, Fr., 2010.11.19
Anmerkungen
[1] Brainard, G.C.; Hanifin, J.P.; Greeson, J.M.; Byrne, B.; Glickman, G.; Gerner, E., & Rollag, M.D.: Action spectrum for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor. Journal of Neuroscience, 21, 16, 6405–6412, 2001
[2] Ehrenstein, W.: Auge, Chronohygiene und Beleuchtung. Licht und Gesundheit. Berlin 6./7. 3. 2008
[3] Förstl, H., & Schweiger, H.-D.: Demenz. Grundlagen, Diagnostik. Formen. Schriftenreihe der Bayerischen Landesapothekerkammer, H. 74. GOVI Pharmazeutischer Verlag, Eschborn, 2007
[4] Kastner, U., & Löbach, R.: Handbuch Demenz. Urban & Fischer, München und Jena, 2008
[5] Bickel, H.: «Epidemiologie und Gesundheitsökonomie» in: Wallesch, C.-W., & Förstl, H. (Hrsg.): Demenzen. Gustav Thieme, Stuttgart, 2005
[6] Verbesserte Lebensqualität für Demente: das Forschungsprojekt St. Katharina in Wien, Tagungsband Licht 2008, Ilmenau
[7] Van de Kraats, J.; van Norren, D.: Optical density of the aging human ocular media in the visible and the UV, J. Opt. Soc. Am. A, V24 N7 (Juli 2007) S. 1842–1857
19. November 2010 Peter Dehoff, Charlotte A. Sust, Dieter Lorenz, Peter Hein, Robert Oberndorfer
Wahl der Mittel
LED werden mittlerweile auch für die Grundbeleuchtung im Zweckbau eingesetzt. Doch die Frage stellt sich, ob LED in jedem Fall die bessere Alternative zu bewährten Leuchtmitteln sind – nur die Betrachtung über die gesamte Nutzungsdauer bringt einen gerechten Vergleich. Wenn die Vorteile der LED nicht genutzt werden, können sie unter wirtschaftlichen Aspekten die falsche Wahl sein.
LED haben zweifellos das Potenzial, den Beleuchtungsmarkt zu revolutionieren. Gerade für Wechselausstellungen, wie in Museen oder im Verkauf, können dank der grossen Lebensdauer Bewirtschaftungsaufwand und Lagerhaltung reduziert werden. Beim Regulieren der Beleuchtungsstärke (Dimmen) verhalten sich im Gegensatz zu den Leuchtstofflampen sowohl Farbwiedergabe als auch Farbspektrum und -temperatur der LED nahezu konstant. Diese Eigenschaften geben Betreibenden von Beleuchtungsanlagen fast uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten mit demselben Leuchtmittel. Der Vergleich der mittleren Lebensdauer einer LED von bis zu 50 000 h mit zum Beispiel Fluoreszenzleuchtmitteln, die eine mittlere Lebensdauer von ca. 15 000 h erreichen, ist wohl ihr grösster Vorteil (Abb. 1).[1]
Noch keine Beständigkeit im Sortiment
Damit eine LED ihre prognostizierte Lebensdauer erreichen kann, ist eine gute Wärmeableitung unabdingbar. Die Wärme entsteht vor allem im rückwärtigen Bereich der Leuchte und muss dort auch möglichst direkt abgeführt werden, da sonst der Vorteil des wärmefreien Lichtkegels nicht genutzt werden kann. Die Ableitung muss sowohl in der Konstruktion als auch beim Verbauen der Leuchte berücksichtigt werden.
Die hohe Lebensdauer zieht aber grundsätzliche neue Überlegungen nach sich. Das Unterhaltsdispositiv für LED-Leuchten entspricht nicht mehr dem klassischen Vorgehen beim Ersatz von Leuchtmitteln mit geringerer Lebensdauer. Zudem entwickelt sich der LED-Markt derart rasant, dass nicht garantiert werden kann, dass exakt dieselben Leuchtmittel in ein paar Jahren für den Ersatz noch verfügbar sind. Diesem Umstand ist vor allem bei grossräumig zusammenhängenden Installationen (Tunnel, Strassenbeleuchtung, Lichtdecken u. ä.) Rechnung zu tragen. Ein weiterer Punkt ist das sogenannte Binning, welches die qualitativen Merkmale (Lichtausbeute und Farbtemperatur) der einzelnen LED-Chips regelt. Gerade für vorgenannte grossräumige Installationen ist es massgebend, dass LED-Chips für Ersatz und/oder Unterhalt aus demselben Bin beschafft werden können, wenn ein einheitliches Erscheinungsbild erreicht werden soll.
Neue technische Möglichkeiten
Die Kompaktheit der LED-Leuchten und die Eigenschaft, dass sie im Gegensatz zu herkömmlichen Leuchtmitteln in Lichtrichtung praktisch keine UV- und IR-Strahlung emittieren, erweitert die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten. So können Exponate mit LED-Leuchten aus unmittelbarer Nähe angestrahlt werden, ohne dass durch die Energie der emittierten Strahlung das Exponat unzulässig erwärmt oder ausgebleicht wird. So kann Energie gespart werden, denn die notwendige Leistung, um eine gleichbleibende Beleuchtungsstärke mit einem gegebenen Leuchtmittel erreichen zu können, nimmt mit dem Abstand im Quadrat zu. 2009 baute Coop seine Verkaufsstelle in Oberwil komplett um und stellte die Beleuchtung grösstenteils auf LED um. Nicht nur die Bedienzonen, sondern auch die Kühlmöbel werden seitdem mit LED beleuchtet, was schliesslich zu weniger Kühl- und Energiebedarf führt. Die Kompaktheit der Leuchten kann auch im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung sinnvoll genutzt werden, helfen doch kleinere, punktförmige Leuchten, die geforderte Gleichmässigkeit der Sicherheitsbeleuchtung gemäss SN EN 1838 von 1:40 deutlich einfacher und mit weniger Leuchten zu erreichen als übliche Leuchten, die höhere Lumenpakete und damit Beleuchtungsstärken erzeugen. Zusätzlich können diese kleinen Leuchten auch deutlich eleganter integriert werden und helfen durch die effektivere Ausleuchtung, die Batteriekapazität, die für die Sicherheitsbeleuchtung gefordert ist, zu reduzieren. Durch die einfache und praktisch verlustlose Regulierung ist auch die sogenannte Konstantlichtstromsteuerung durchaus sinnvoll. Diese verhindert, bedingt durch die natürliche Reduktion des Lichtstromes während der Nutzungslebensdauer, eine Überdimensionierung der Lichtinstallation und spart so Energie. Der Energiebedarf für die Herstellung der LED-Lampen wird zurzeit noch untersucht. Nach Aussagen von Osram dürfte sie im Bereich von Sparlampen liegen.[2]
Bedingt sinnvoll bei kurzen Umbauzyklen
Bei der Entscheidung, ob LED-Leuchtmittel bei einem Bauvorhaben sinnvoll eingesetzt werden können, müssen einige Besonderheiten berücksichtigt werden. Die Beleuchtungskonzepte und die damit verbundenen Ansprüche (optisch, technisch) entwickeln sich stetig, und Umbauzyklen typischer Nutzungen müssen in eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit einbezogen werden. Ist also nicht sichergestellt, dass die seinerzeit angeschafften LEDLeuchten den künftigen Ansprüchen genügen werden, und liegt der Umbauzyklus deutlich unter der Lebensdauer der LED-Leuchten (Leuchtmittel), muss die wirtschaftliche Rechtfertigung der vergangenen Anschaffung der LED-Leuchten hinterfragt werden. Die Tatsache, dass ein Leuchtmittel manchen Sanierungszyklus überleben wird und es sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt hat, muss von Leuchten- und Steuerungslieferanten berücksichtigt werden. Modular getrennte, universelle Systeme für Leuchten und Leuchtmittel wären ein möglicher Ansatz. Wobei die Frage bleibt, wie realistisch die Annahme ist, dass bei einem Umbauprojekt wirklich die alten Leuchtmittel und Steuerungen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit auch nach dem Umbau wieder eingesetzt werden.
Laborwerte bedeuten wenig in der Praxis
Spricht man von LED, muss man immer zwischen dem reinen Leuchtmittel und der kompletten Leuchte unterscheiden. Trotz der bereits hohen Lichtausbeute des Leuchtmittels erreicht das Leuchtensystem nur einen Teil davon. Dies hängt in erster Linie damit zusammen, dass diese hohe Lichtausbeute von über 120 lm/W unter nicht praxisnahen Bedingungen erreicht werden. Im Labor wird die LED bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C, ohne Netzteil und nicht unter Volllast betrieben; das erzeugte Licht ist zudem kaltweiss. Inklusive Netzteil in eine Leuchte eingebaut, unter Volllast betrieben und unter dem Aspekt, dass auf dem Markt eher warmweisses Licht verlangt wird, reduziert sich die Lichtausbeute eines LED-Leuchtmittels auf ca. 60–75 lm/W (Abb. 2). Dennoch hat im Vergleich dazu eine heute als effizient geltende Leuchte (Fluoreszenzleuchtmittel) mit einer Lichtausbeute von ungefähr 85 lm/W keinen wesentlich höheren Gesamtwirkungsgrad mehr.
Angesichts der vergangenen Entwicklung ist aber anzunehmen, dass der Gesamtwirkungsgrad der LED-Leuchten noch deutlich steigen wird. Wenn dies wiederum zu einer grösseren Nachfrage führt, sollten sich auch die Preise auf einem Niveau einpendeln, das die LED zu einer guten Alternative werden lässt.
Autor
Volker Wouters, dipl. El. Ing. HTL/SIA; Dozent Elektroengineering Gebäudetechnik Hochschule Luzern, Technik und Architektur;
Leiter Technik und Wissenschaft, Herzog Kull GroupTEC21, Fr., 2010.11.19
Anmerkungen
[1] Die mittlere Lebensdauer ist der Mittelwert einer Anzahl Lampen, die unter genormten Bedingungen betrieben werden (50 % Ausfall). Die Nutzlebensdauer ist erreicht, wenn der verbleibende Anlagenlichtstrom 80 % des anfänglichen Lichtstroms beträgt. 15 000 h entsprechen bei einer durchschnittlichen Nutzung von 2000–3000 h pro Jahr einer Lebensdauer von ca. 5–8 Jahren bzw. 50 000 h einer Lebensdauer von 15–25 Jahren
[2] Bundesamt für Energie, Schlussbericht «Qualitätsmerkmale der LED-Beleuchtung. Aktueller Stand der Technik, Vorteile, Problempunkte und Entwicklungspotential», September 2009
19. November 2010 Volker Wouters