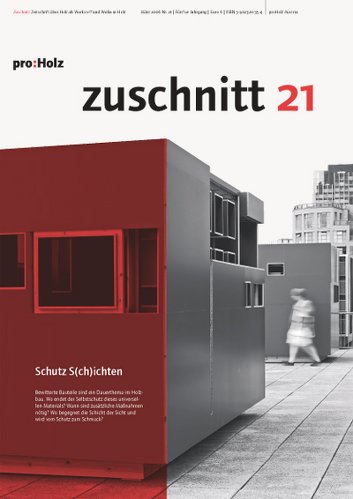Editorial
Schutz S(ch)ichten – ein Titel, der vieles anspricht, was in diesem Zuschnitt enthalten ist: zuerst den Schutz des Holzes, dann die chemischen oder mechanischen Schichten, aus denen dieser bestehen kann, und zuletzt das »Sichten«, die visuelle Gestaltung, die mithilfe von (Farb-)Schichten erfolgt.
Ursprünglicher inhaltlicher Ausgangspunkt war das Thema des chemischen Holzschutzes, wobei von Beginn an klar war: Konstruktiver Holzschutz ist Voraussetzung für jedes Bauwerk, das in Holz errichtet wird, und sollte immer an erster Stelle stehen. Dennoch gibt es Anwendungen, bei denen chemischer Holzschutz gegen Pilz- und tierischen Schädlingsbefall sowohl notwendig als auch gesetzlich vorgeschrieben ist, um die Tragfähigkeit von bewitterten Bauteilen zu gewährleisten.
Zunächst schien das Thema klar abgesteckt, übersichtlich und leicht zu handhaben, aber bald sahen wir uns mit folgenden Meinungsbildern konfrontiert. Erstens: Chemischer Holschutz = Anstrich = Farbe. Zweitens: Chemischer Holzschutz ist etwas, das unter allen Umständen vermieden werden sollte. Drittens: Fassaden natürlich vergrauen zu lassen ist der einzige richtige Weg, um dem Material zu entsprechen. Im Sinne einer differenzierteren Betrachtungsweise haben wir uns dafür entschieden, das Thema umfassender zu betrachten und die Behandlung von Holz im Außenbereich unter den Aspekten des Schutzes, der Pflege und der Gestaltung darzustellen.
Das Ergebnis ist ein Zuschnitt in Farbe, um wichtige inhaltliche Aspekte nachvollziehbar zeigen zu können, mit verschiedenen Zugängen: einem theoretischen, der in erster Linie von einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter der Holzforschung Austria getragen wird und in dem Begriffe, Gesetzeslage und technische Rahmenbedingungen erläutert werden. Ein zweiter Teil des Heftes ist praktischen Erfahrungen gewidmet, wobei wir uns besonders bei Arch. DI Ernst Roth bedanken möchten, der bereit war, über seine persönlichen Erfahrungen mit Holzschutz zu sprechen. In diesen Bereich fallen auch Beiträge über Schutz und Wartung von neuen und alten Holzbauten.
Der dritte Schwerpunkt widmet sich auf entwurfsphilosophischer Ebene den Themen Farbe und Oberflächenbehandlung. Herzlichen Dank an Marianne Burkhalter und Quintus Miller für ihr Entgegenkommen und ihre Gesprächsbereitschaft! Schließlich beschreiben vier AutorInnen Beispiele, in denen Holz nicht geschützt werden muss, sondern selbst Schutzfunktion hat bzw. seine Eigenschaften durch kontrollierten Pilzbefall verändert.
Zuletzt noch eine Meldung in eigener Sache:
Otto Kapfinger hat das Editorialboard des Zuschnitt als ständiges Mitglied verlassen, wird uns aber nach wie vor bei Bedarf beratend zur Seite stehen. Vielen Dank für all die erfrischenden Gedanken und Beiträge, die uns und den Zuschnitt in den letzten beiden Jahren bereichert haben! Zugleich begrüßen wir mit Franziska Leeb, Konrad Merz und Hermann Kaufmann drei neue Mitglieder im Redaktionsbeirat und freuen uns auf eine gute und inspirierende Zusammenarbeit! Eva Guttmann
Inhalt
Zum Thema
Editorial
Eva Guttmann
Projekte:
Holzschutz an den Bauernhäusern des Bregenzerwaldes
Text: Johann Peer
Mehr als ein Anstrich
Gespräch mit Marianne Burkhalter
Oberflächenbehandlung von Holz im Außenbereich – Gestaltungsmittel mit Schutzfunktionen
Text: Gerhard Grüll
Grau und schlau
Ein Pilotprojekt zur technischen Vergrauung von Holzoberflächen
Text: Franziska Leeb
Chemischer Holzschutz
Übel oder Notwendigkeit?
Text: Notburga Pfabiga
Seriell und individuell
Gespräch mit Ernst Roth
Jenseits der Farbe
Gespräch mit Quintus Miller
Durch Wind und Wetter
Die Wilkhahn-Produktionshallen von Thomas Herzog nach vierzehn Jahren
Gespräch mit Kerstan von Pentz
Dreifach geschützt
Bahnsteigüberdachung in Filisur
Text: Eva Guttmann
Serie Forschung und Lehre (II):
Holzforschung Austria
Text: Holzforschung Austria
Weiterbildung:
Zweiter Uni-Lehrgang »überholz« startet im Herbst
Text: Roland Gruber
Holzrealien:
Patentierter Pilzbefall
Text: Charles von Büren
Luxus unterwegs
Text: Elke Krasny
Muster, die verbinden
Text: Renate Breuß
Schützende Wände
Text: Michael Freund
Holz(an)stoß:
Denkmal
Text: Stefan Tasch
Dreifach geschützt
(SUBTITLE) Bahnsteigüberdachung in Filisur
Der Bahnhof von Filisur ist ein wichtiger Knotenpunkt der Albulabahn in Graubünden. Um neben der Schönheit und Kraft der umgebenden Berglandschaft bestehen zu können, wurde für die neue Bahnsteigüberdachung ein ebenfalls kräftiger, körperhafter Entwurf angestrebt, der sich dem gewohnten Bild entzieht und eine starke, identitätstiftende Wirkung hat. Die Baukörper bestehen nun aus Scheibenstützen, Tragkörper und Dachflügel aus Brettschichtholz, deren Strenge und Geradlinigkeit sich gut in die Umgebung fügen und einen »entschleunigenden« Effekt auf die Reisenden haben, welche die kurvenreiche Strecke befahren.
Das statische System ist ein steifer Rahmen, Dachflügel und Tragbalken werden durch die paarweise gegenübergestellten und damit raumbildenden Scheibenstützen getragen. Damit die Konstruktion möglichst schlank bleibt, wurden die Stützen im Fundament und mittels einer im Tragkörper versenkten Stahlkrücke quer zur Längsrichtung eingespannt.
Das Holz wird auf mechanische, konstruktive und chemische Art geschützt. Das Hirnholz des Daches wurde mit einem zarten Stahlprofil abgedeckt, das Dach selbst, welches mit dem Tragkörper verschraubt ist, mit einem Kiesklebedach abgedichtet. Durch den großen Dachüberstand sind die Stützen vor Regen weitgehend geschützt, eine ins Hirnholz eingelassene Stahlplatte am Fußpunkt sorgt für Abstand zum Betonfundament und ermöglicht gutes Abtropfen, falls die Stelle doch einmal von Schlagregen erreicht werden sollte. Das Brettschichtholz wurde mit einem farblosen, wasserabweisenden Anstrich auf Nanotechnologiebasis versehen, wodurch auch mit einem verzögerten Einsetzen der natürlichen Vergrauung zu rechnen ist.zuschnitt, Sa., 2006.03.25
25. März 2006 Eva Guttmann
verknüpfte Bauwerke
Perronüberdachung
Jenseits der Farbe
(SUBTITLE) Gespräch mit Quintus Miller
Zuschnitt: Im letzten Zuschnitt haben wir die Markthalle in Aarau vorgestellt, wobei der Fokus in erster Linie auf die städtebauliche Situation und die Bedeutung eines »Stadtmöbels« im historischen Kern Aaraus gerichtet wurde. Heute interessiert uns die spezielle Oberfläche der Markthalle und Ihre Haltung zum Thema Oberfläche, auch Farbe, generell.
Miller: Im Wettbewerb hatten wir die Markthalle Aarau noch aus unbehandeltem Holz gedacht. Wir wollten ein Gebäude schaffen, ein Volumen, und haben uns für die Lamellenstruktur aus Holz entschieden, die zwischen Materialität und Immaterialität kippt. Zwischen dem Wettbewerb und der Realisierung sind fünf Jahre vergangen, in denen wir Versuche gemacht haben, die natürliche Verwitterung der Holzoberfläche zu beeinflussen, und feststellen mussten, dass einfach ein Zeitraum von zehn, zwanzig, dreißig Jahren für eine gleichmäßige Verwitterung nötig ist. Bis dahin wäre der Charakter des Gebäudes ein völlig falscher gewesen, daher haben wir nach Möglichkeiten gesucht, die Verwitterung vorwegzunehmen oder eine Verfremdung in unserem Sinne zu erzielen.
Haben Sie auch an einen Farbanstrich gedacht?
Nein, denn es war klar, dass ein Farbanstrich aus Gründen der kurzen Wartungsintervalle nicht in Frage kommt. Im Rahmen der Recherche sind wir dann auf die Tatsache gestoßen, dass man z.B. Fensterläden schon vor zweihundert Jahren mit Leinöl behandelt hat, um ihnen Haltbarkeit zu verleihen, und dass man das Leinöl auch pigmentieren bzw. firnissen kann. Daraus entstand die Idee, eine Beschichtung auf Leinölbasis zu finden, die keinen dichten Film bildet, sondern ein gewisses Maß an Offenporigkeit hat, die das Holz schützt und die Wartungsintervalle deutlich dehnt.
An wen konnten Sie sich wenden, um die nötigen Informationen zu erhalten?
Wir haben mit RestauratorInnen gesprochen, die sich ja laufend mit historischen Technologien beschäftigen und uns gut beraten konnten. Es war hingegen relativ schwierig, eine Firma zu finden, die bereit war, diese Technologie auch anzuwenden, und es war auch schwierig herauszufinden, welche Art von Pigmentierung eine Wirkung hervorruft, die uns für die Markthalle richtig erschien. Wir wollten dem Gebäude einen Charakter verleihen, der zwar Assoziationen an die ehemaligen Gewerbebauten an dieser Stelle hervorruft und auch seiner Nutzung entspricht, der aber nichts Schmuddeliges oder Abgegriffenes transportiert, sondern etwas Feines, fast Elegantes. Nach ungefähr fünfhundert Musterproben haben wir uns für eine Kupferpigmentierung entschieden, was einerseits mit der Farbigkeit am Ort zu tun hat und andererseits einen metallischen Effekt, ein Irisieren und Oszillieren, eine Abstraktion und Verfremdung des Holzes hervorruft.
Warum bedienen Sie sich in Ihrer Architektur der Methode der Verfremdung, der Irritation?
Wir sind immer auf der Suche nach Aspekten der Verfremdung, weil wir glauben, dass die Architektur dadurch gewinnt, dass sie reicher und lesbarer, vielleicht auch gültiger wird. Wir wollen kontextuell gedachte Architektur schaffen, einen übergeordneten Zusammenhang herstellen und dadurch eine Vielschichtigkeit erreichen, die – über kulturelle und zeitliche Grenzen hinweg – mehrere Zugänge zu einem Bauwerk möglich macht. Vielschichtigkeit erhöht die Wachsamkeit und damit auch die Wahrnehmung. Man glaubt, etwas zu sehen, was man kennt. Gleichzeitig sind bestimmte Dinge aus dem Vertrauten »herausgeschoben«. So etwas irritiert, eröffnet aber auch Möglichkeiten in der Rezeption. Beispiel Markthalle: Man sieht eine Holzkonstruktion, erkennt aber zugleich, dass daran etwas ungewöhnlich ist. In diesem Augenblick ist die Wahrnehmung geschärft und bereit für viele Arten von Eindrücken und Erkenntnissen.
Wie haben Sie andere Oberflächen behandelt?
Es geht ja nicht direkt um die Oberfläche, uns interessiert die Anmutung einer Materialität. Es geht nicht um die oberste Schicht, sondern um die Gesamtheit. Es gibt Beispiele wie das Projekt »Villa Garbald«, wo es gar keine Farben gibt, nur Material. Dann gibt es etwa den Wohnbau Schwarzpark, wo eine perfekt fugenlose Betonstruktur gestrichen wurde, um den reinen Betoncharakter zu brechen und einen Bezug zur Baumrinde herzustellen.
Sie arbeiten »jenseits« der Farbe?
Beim Volta-Schulhaus in Basel gibt es Unterschiede in der Oberflächengestaltung der Klassenzimmer, der Erschließungsflächen und der vier Höfe, die in das Gebäude eingeschrieben sind. Dabei geht es um Stimmungen und innere Räumlichkeit, die wir nicht mit »Buntheit« totschlagen wollten. Wir haben uns in den Erschließungszonen für eine Farbe entschieden, die nicht bunt ist, sondern Material. Auf den grauen Grundton wurde zuerst ein silberpigmentierter und dann ein goldpigmentierter Lack aufgebracht, wobei die unterschiedliche Verarbeitungsrichtung der beiden Lasuren dem Anstrich einen textilen Effekt verleiht. Die Farbe wird zum Material, entfernt sich von jeder Art von Buntheit und verändert sich je nach Licht und Bewegung. Die Wände der Innenhöfe – eine hinterlüftete Fassadenkonstruktion mit Holzwerkstoffplatten – wurden mit Goldpigmentfarbe gestrichen und hochglanzlackiert. Wenn man in die Höfe schaut, hat man das Gefühl, als würde jeden Moment die Sonne durch den Nebel brechen, als würde die Wand sich auflösen, und auch hier wird die Farbe zum Material, zur Stimmung.
Für Holzschutz interessieren Sie sich nur im pragmatisch-technischen Zusammenhang des Bauens?
Da gibt es zwei Aspekte: Es gibt technische Randbedingungen und jede Idee muss durch die Kontrolle der Angemessenheit überprüft werden. In diesem Sinne betreiben wir natürlich auch Holzschutz und achten z.B. darauf, dass Teile aus Holz auch beim fertigen Gebäude erreicht und bei Bedarf ausgewechselt werden können. Holzschutz interessiert mich aber vor allem dann, wenn ich beeinflussen will, wie schnell ein Gebäude altert. Wir arbeiten mit Material, Proportion, Licht und wollen Emotionen auslösen. Da spielen Vergänglichkeit und Patina eine große Rolle und durch den mehr oder weniger sichtbaren Alterungsprozess eines Hauses kann eine übergeordnete Grundstimmung erzeugt werden, die wesentlich für den Charakter von Architektur ist. Das hat nichts zu tun mit historisierenden Elementen – wir bedienen uns nur zeitgenössischen Formenvokabulars –, sondern es hat zu tun mit Erinnerung, Vertrautheit, Assoziation und mit den kulturellen Wurzeln jedes einzelnen von uns.zuschnitt, Sa., 2006.03.25
25. März 2006 Eva Guttmann
Seriell und individuell
(SUBTITLE) Gespräch mit Ernst Roth
Zuschnitt: Holzschutz, Oberflächenbehandlung, Farbgestaltung – was assoziieren Sie mit diesen Begriffen?
Ernst Roth: In erster Linie assoziiere ich damit eine Reihe an Erfahrungen, die ich im Lauf der Zeit gemacht habe und durch die ich mir ein gewisses Repertoire an Oberflächengestaltung und -behandlung erarbeitet habe.
Welche Erfahrungen waren das?
Eine interessante Erfahrung gab es gleich beim ersten Haus, einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 1991. Wir haben uns damals für eine Fassade aus Fichtenschalung entschieden, deren natürliche Farbe – ein heller, gelblicher Ton – mir überhaupt nicht gefallen hat. Also haben wir eine zarte Lasur aus Schwarz und Weiß mischen lassen und aufgebracht, um von Beginn an einen visuellen Vergrauungseffekt zu erreichen. Das hat sehr gut funktioniert, die Fassade wurde immer schöner, wobei an der Wetterseite das Grau intensiver wurde und an der Südseite, durch die erhöhte uv-Strahlung, ein sehr schöner Rot-Ton entstanden ist. Für die Bauherren war diese Unregelmäßigkeit jedoch ein Problem, weshalb das Haus dann deckend gestrichen und der Farbveränderungsprozess leider abgebrochen wurde.
Spielt die Farbe an sich für Sie eine Rolle in der Gestaltung?
Auf jeden Fall, aber es hängt auch immer von der Bauaufgabe ab. Bei den Fertighäusern etwa, die im Betrieb meines Vaters erzeugt werden, spielt Farbe eine große Rolle. So wurde z.B. 1992/93 ein Musterhaus entwickelt, für das ich die Farbgestaltung übernommen habe. Es stand dabei nicht zur Debatte, die Oberflächen einfach verwittern zu lassen, da es dafür am Fertighausmarkt einfach zu wenig Nachfrage gibt. Also wurde die Fichtenholzschalung mit dunkelgrauer Dünnschichtlasur gestrichen, was in Kombination mit den ebenfalls verwendeten grauen zementgebundenen Platten sehr schön war. Für dieses Musterhaus erhielten wir dann auch den Landesarchitekturpreis, aber außer Friedrich Achleitner und mir gefiel die Farbe wohl kaum jemandem, denn nach ein paar Jahren wollte man eine auffälligere Farbe, weil sich das graue Haus nicht gut verkaufte. Wir ließen das Grau abbeizen, worauf eine wunderschöne, inzwischen rötliche Fichtenholz-Oberfläche, durchzogen von feinen, grauen Streifen an den vertieften Stellen zum Vorschein kam, die aber leider nicht vervielfältigbar war und daher nicht so bleiben konnte. Das Musterhaus wurde dann in Anlehnung an skandinavische Eisenoxidfarben rot gestrichen.
Haben Sie bei Arbeiten, die nicht für eine Massenproduktion gedacht waren, jemals Dickschichtlasuren angewendet?
Nein, ich vermeide Dickschichtlasuren, weil einerseits die Gefahr von mechanischen Schäden im Bereich des Anstrichs besteht, wodurch dann Feuchtigkeit unter die Oberfläche gelangt, die nicht mehr entweichen kann, und andererseits die natürliche Oberflächenstruktur des Holzes verloren geht.
Wann setzen Sie chemischen Holzschutz ein?
Generell steht für mich der konstruktive Holzschutz an erster Stelle, erst dann kommt der chemische Holzschutz. Es gibt aber durchaus Situationen, wo chemischer Holzschutz notwendig und sinnvoll ist, und ich habe kein Problem damit, ihn dort auch einzusetzen. Bei meinem eigenen Haus kam es im Bereich der Seekiefernsperrholzplatte, welche die Untersicht des Vordachs bilden, zu Schimmelbildung. Hier steht die Luft, die Kondenswasserbildung ist durch die Wärme, die beim Öffnen der Haustür entweicht, beträchtlich, es herrscht immer eine hohe Luftfeuchtigkeit und so kam es zum Pilzbefall. In solchen Situationen, aber auch dort, wo tragende Holzteile bewittert sind, wie etwa bei Stehern im Außenbereich, verwende ich chemischen Holzschutz.
Wie werden Fertighäuser geschützt?
Früher wurden alle tragenden Teile chemisch geschützt, was zu Problemen mit Feuchtigkeit und zum Verziehen des Holzes geführt hat. Inzwischen ist man davon abgekommen und behandelt das Holz nur mehr im bewitterten Bereich mit Ausnahme der Schwelle, die mit chemischem Holzschutz oder aber mit Holz von hoher natürlicher Dauerhaftigkeit wie z.B. Lärchenkernholz auszuführen ist.[1]
Welcher Holzschutz scheint Ihnen in Bezug auf die Oberflächenbehandlung insgesamt der richtige zu sein?
Das ist eine Frage, die jeder für sich beantworten muss. Ich selbst habe sehr positive Erfahrungen mit Fassaden aus unbehandelter Lärchenholzschalung gemacht, die höchstens geölt wird, damit der Vergrauungsprozess zeitverzögert einsetzt. Das ist kostengünstig und technisch unkompliziert. Außerdem finde ich, dass die Veränderung des Holzes, die durch uv-Strahlung und Bewitterung entsteht, sehr reizvoll ist.
Wenn wir Platten verwenden, dann achten wir darauf, sie nur im geschützten Bereich einzusetzen, denn sonst müssen sie, auch an den Stirnseiten, sehr aufwändig und teuer behandelt werden, damit sie von vernünftiger Dauerhaftigkeit sind. Die Farbe selbst wird von uns als reines Gestaltungsmittel und meistens als Kontrast zu den bewitterten, unbehandelten Teilen eingesetzt, wobei die aktuellen Angebote der Farbenhersteller sehr gut und sehr bedarfsorientiert sind, man sich aber im Klaren darüber sein muss, dass solche Bauteile nach ein paar Jahren neu gestrichen werden müssen.
Welche Oberfläche würden Sie gern noch machen?
Ich würde sehr gern einmal etwas in Silbergrau machen, weil das gerade im Zusammenhang mit der Oberflächenstruktur von Holz sehr elegant ist. Derzeit ist es noch schwierig, weil z.B. Äste mit der Zeit durch die Farbe »durchschlagen«, aber da hoffe ich auf die zukünftige Entwicklung am Farbensektor.zuschnitt, Sa., 2006.03.25
[1] Nach der ÖNORM B 3802-2 gibt es eine gesetzliche Verpflichtung zum chemischen Holzschutz, in der ÖNORM B 3804 werden jedoch die Voraussetzungen zur Reduktion chemischer Holzschutzmaßnahmen aufgezeigt, wie etwa trockenes und insektendichtes Bauen.
25. März 2006 Eva Guttmann