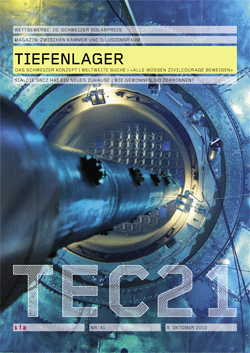Editorial
Vor 41 Jahren ging das erste der heute fünf Schweizer Kernkraftwerke in Betrieb. Die dort anfallenden radioaktiven Abfälle strahlen über einen Zeitraum von bis zu einer Million Jahre und müssen entsprechend lang sicher gelagert werden. Was für eine enorme Zeitspanne das ist, wird klar, wenn man sich rückblickend anschaut, welche Entwicklung der Mensch in diesem Zeitraum durchgemacht hat. Der Homo sapiens tauchte vor 200 000 Jahren überhaupt erst auf. Was werden es für Menschen sein, denen wir die Information über die von einem solchen Standort ausgehende Gefahr übermitteln müssen? Welche Zeichen werden dann überhaupt noch verstanden? Bis heute ist beispielsweise die nur knapp 2000 Jahre alte Schrift der Maya noch nicht vollständig entziffert. Auch wenn sich Forscher bereits Gedanken zur Markierung von Endlagern machen, müssen zunächst einmal Standorte dafür gefunden werden. Weltweit existiert noch kein einziges Lager für hochradioaktive Abfälle. In der Schweiz lagern sämtliche radioaktiven Abfälle derzeit oberirdisch bei den Kernkraftwerken selbst und in zwei Zwischenlagern in Würenlingen AG – von der Sicherheit her bestimmt keine optimale Situation. Es ist daher zu wünschen, dass das derzeit laufende Verfahren zur Standortsuche für ein oder zwei Tiefenlager Erfolg hat. Es wurde vor vier Jahren aufgrund der negativen Erfahrungen in den Jahren zuvor, unter anderem am Wellenberg, neu aufgegleist. In einem aufwendigen und langwierigen Verfahren werden die nach wissenschaftlichen Kriterien am besten geeigneten Tiefenlager-Standorte ermittelt, wobei der betroffenen Bevölkerung weitreichende Mitsprachemöglichkeiten eingeräumt werden (vgl. «Das Schweizer Konzept», S. 16 ff.). Dieses Vorgehen stellt auch im internationalen Vergleich einen hohen Standard dar (vgl. «Alle müssen Zivilcourage beweisen», S. 22 ff.). Allerdings haben die betroffenen Regionen und Kantone im neuen Verfahren kein Vetorecht mehr. Entschieden wird über die definitiven Standorte am Schluss von Bundesrat und Parlament und allenfalls in einer Volksabstimmung auf gesamtschweizerischer Ebene. Das handhaben einige Länder anders: England und Kanada suchen von vornherein Gemeinden, die freiwillig ein Endlager aufnehmen würden. In Schweden und Finnland haben die Standortgemeinden ein Vetorecht (vgl. «Weltweite Suche», S. 19 ff.). Ob das Schweizer Verfahren trotzdem Erfolg haben wird, wird sich weisen. Der Widerstand in den Standortgemeinden formiert sich jedenfalls bereits. Etwas schizophren mutet es allerdings an, wenn Gegner von Endlagern gleichzeitig die weitere Nutzung der Atomenergie befürworten, wie bei der jüngsten Abstimmung in Nidwalden geschehen. Wer die Folgen dieser Technologie fürchtet, sollte sich davon verabschieden und die Alternativen in Form von gesteigerter Energieeffizienz und erneuerbaren Energien fördern.
Claudia Carle
Inhalt
05 WETTBEWERBE
20. Schweizer Solarpreis
10 MAGAZIN
Zwischen Kammer und Illusionsraum
16 DAS SCHWEIZER KONZEPT
Meinert Rahn, Felix Altorfer Alle radioaktiven Abfälle sollen in der Schweiz dereinst in geologischen Tiefenlagern entsorgt werden. Die Vorschläge zu Aufbau und Betrieb eines solchen Lagers sowie zu möglichen Standorten liegen derzeit öffentlich auf.
19 WELTWEITE SUCHE
Anne Minhans Die Suche nach Endlagern für hochradioaktive Abfälle läuft weltweit. Das Vorgehen und die Konzepte sind jedoch je nach Land verschieden.
22 «ALLE MÜSSEN ZIVILCOURAGE BEWEISEN»
Claudia Carle TEC21 diskutierte mit einem deutschen und einem Schweizer Experten über das Schweizer Verfahren zur Standortsuche für Tiefenlager.
27 SIA
Die SBCZ hat ein neues Zuhause | Berufsbroschüre Gebäudetechnik | Alpine Architektur und Tourismus | Zwischen den Disziplinen | Wie gewonnen, so zerronnen?
31 FIRMEN
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Das Schweizer Konzept
Das Schweizer Kernenergiegesetz aus dem Jahr 20031 legt fest, dass alle radioaktiven Abfälle in geologischen Tiefenlagern entsorgt werden müssen. Zur Frage, wie diese Lager aufgebaut und betrieben werden sollen und welche Standorte in Frage kommen, hat die Nagra[2] Vorschläge unterbreitet, die vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) überprüft wurden.
Ein geologisches Tiefenlager besteht aus einem Hauptlager, einem Pilotlager, Testbereichen und Zugangsbauwerken (Abb. 1). Jeder dieser Lagerteile hat eine spezifische Funktion:
– Die Zugangsbauwerke (Schächte, Rampen oder beides) erlauben die Erschliessung der Bauwerke von der Oberfläche.
– In den Testbereichen werden im Wirtgestein wie in einem Felslabor Experimente durchgeführt. Vor der Einlagerung der ersten Abfälle in das Pilotlager müssen darin insbesondere die Gesteinseigenschaften bestätigt sowie die Einlagerungs- und Rückholungstechniken erfolgreich getestet werden.
– Das Pilotlager wird vor Beginn der Einlagerung im Hauptlager mit einer kleinen, repräsentativen Menge an radioaktiven Abfällen bestückt und verschlossen. Die ablaufenden Prozesse werden mithilfe eines Überwachungsprogramms beobachtet und dahingehend geprüft, ob sie den Annahmen zur Entwicklung des Hauptlagers entsprechen.
– Das Hauptlager nimmt das Gros der Abfälle auf, sobald das Pilotlager verschlossen ist. Die Einlagerungsbereiche werden jeweils unmittelbar nach der Einlagerung verfüllt. Nach Ende der Einlagerung beginnt eine Beobachtungsphase, deren Dauer noch nicht festgelegt ist. Den Verschluss des Lagers ordnet der Bund an, wobei nicht gesetzlich festgelegt ist, wer den Entscheid zum Verschluss des Lagers fällt. Dieser Entscheid wird aber anhand der aus dem Überwachungsprogramm im Pilotlager gewonnenen Daten und deren Übereinstimmung mit den Voraussagen des Sicherheitsnachweises gefällt. Bis zum Verschluss muss die Rückholung der Abfälle ohne grossen Aufwand möglich sein.
Volumen der Radioakt iven Abfälle
Für die Lagerung der radioaktiven Abfälle schlägt die Nagra zwei unterschiedliche Lagertypen vor: Ein Lager für hoch- und mittelradioaktive langlebige Abfälle (HAA, mehrheitlich aus der Stromproduktion) sowie ein Lager für schwach- bis mittelradioaktive kurzlebige Abfälle (SMA, aus der Stromproduktion und der Anwendung von Radioaktivität in Medizin, Industrie und Forschung). Die HAA machen zwar nur knapp 10 % des gesamten Abfallvolumens aus, enthalten aber 99 % der Radioaktivität. Die schwachradioaktiven Abfälle (SMA) machen 90 % des Abfallvolumens aus, enthalten aber nur 1 % der Radioaktivität. Trotz dem deutlichen Volumenunterschied ist gemäss den Lagerkonzepten die Fläche eines HAA-Lagers grösser (4 bis 6 km2), da die HAA Wärme abgeben. Um zu vermeiden, dass sich das Wirtgestein zu stark erwärmt, werden sie daher in weit voneinander entfernten Stollen eingelagert. Die SMA hingegen können wegen der sehr geringen Wärmeproduktion auf engerem Raum (2 bis 3 km2) konzentriert werden.
Mit den heute vorhandenen Kernkraftwerken und den Abfällen aus Medizin, Industrie und Forschung (MIF) würde sich bis zur Mitte dieses Jahrhunderts ein Volumen von 100 000 m³ radioaktiver Abfälle ergeben, vergleichbar mit einem Würfel von knapp 50 m Kantenlänge. Berücksichtigt man den allfälligen Betrieb weiterer Kernkraftwerke und die Sammlung der MIF-Abfälle bis zum Ende dieses Jahrhunderts, würde sich dieses Volumen etwa verdoppeln.
Auswahl von Standortgebieten
Zur langfristigen Rückhaltung der radioaktiven Stoffe wird ein Multibarrierensystem eingesetzt, das sich durch Redundanz und Diversität auszeichnen muss: Fällt wider Erwarten eine Barriere aus, wird deren Funktion durch eine andere ersetzt (Abb. 2). Nur das Wirtgestein und die umgebende Geologie (Geosphäre) als natürliche Barrieren sind in Ausdehnung und Wirkung nicht ersetzbar. Die Standortsuche und die geologische Exploration vor Ort erhalten dadurch grosses Gewicht. Die Kennwerte des Wirtgesteins fliessen in eine Sicherheitsanalyse des Standorts ein. Die Nagra als Projektant muss damit zeigen, dass das Lager über lange Zeiträume (bis zu einer Million Jahre) sicher ist und die gesetzlichen Anforderungen (Schutzkriterien) erfüllt.
Auf der Suche nach geeigneten Standortgebieten musste die Nagra gemäss Sachplan (vgl. Kasten S. 18) in Etappe 1 zunächst eine Abfallzuteilung zu den beiden Lagertypen vornehmen und daraufhin die Anforderungen an diese Lagertypen definieren. Bei der Einengung auf Standortgebiete wurden zunächst die geologischen Grossräume auf ihre Eignung geprüft und geologisch komplexe Gebiete wie die Alpen und der Faltenjura für ein HAA-Lager ausgeschlossen. Als geeignete Wirtgesteine wurden ausschliesslich tonreiche Gesteine vorgeschlagen. Anschliessend hat sie Vorkommen dieser Gesteine in mehreren hundert Metern Tiefe (von der Nagra empfohlene Tiefen: HAA-Lager: in 400–900 m, SMA-Lager: 300–800 m) und in geeigneter Entfernung von geologischen Störungen (Vorschlag der Nagra: 200 m) gesucht und als HAA-Lagerstandortgebiete die Gebiete Bözberg (AG), Nördlich Lägern (AG/ZH) und Zürich Nord-Ost (ZH/TG) vorgeschlagen. Für ein SMA-Lager, das geringere Anforderungen an die Langzeitsicherheit stellt, wurden zusätzlich noch die Gebiete Südranden (SH), Jura– Südfuss (AG/SO) und Wellenberg (NW/OW) vorgeschlagen (Abb. 3).
Offene Fragen
Das dreistufige Sachplanverfahren wird mindestens zehn Jahre dauern. Die Lager werden erst Dekaden später in Betrieb gehen und gegen Ende dieses Jahrhunderts oder später verschlossen. Zur kontinuierlichen Optimierung sollen unter Berücksichtigung des Standes von Wissenschaft und Technik Entscheide grundsätzlich immer so früh wie nötig, aber so spät wie möglich gefällt werden.
Viele Details der künftigen Lagerauslegung müssen zurzeit noch nicht geklärt sein. Es gilt sorgfältig zu unterscheiden zwischen grundsätzlichen Fragen der Machbarkeit eines Lagers und offenen Fragen zur Optimierung. Die grundsätzliche Machbarkeit der Entsorgung wurde in den sogenannten Entsorgungsnachweisen (mit einem SMA-Lagerprojekt am Oberbauenstock, 1988, und einem HAA-Lager im Zürcher Weinland, 2006) erbracht. Trotzdem müssen die Lagerkonzepte und die Nachweismethoden kontinuierlich verbessert werden. Die Suche nach einem SMA-Lager konzentrierte sich lange auf Gebiete mit ausgeprägter Topografie, um ein Lager im Untergrund mit einem horizontalen Stollen erreichen zu können. Der bevorzugte Standort war damals der Wellenberg. Für die bis zu 100 t schweren Behälter mit schwachradioaktiven Abfällen sah man damals keine sichere technische Lösung für einen Transport mittels einer Schachtanlage. Aufgrund der inzwischen vorhandenen Technik hat die Nagra jetzt auch Standorte in der Nordschweiz vorgeschlagen, bei denen die Lager- tiefe über eine Rampe oder einen Schacht erreicht wird.
Offene Fragen bei der Lageroptimierung bestehen beispielsweise zum Behältermaterial für die HAA. Das Lagerkonzept geht von Stahlbehältern aus, die über lange Zeiträume korrodieren werden. Das dabei entstehende Gas darf keine unzulässigen Überdrücke produzieren, die die Einschlussfähigkeit des Wirtgesteins wesentlich beeinträchtigen. Die Frage des Behältermaterials muss aber erst später im Verfahren definitiv geklärt werden. Experimente zur Abklärung laufen bereits heute.
Offen sind momentan auch bautechnische Aspekte zur untertägigen Erschliessung der Anlage. Ziel ist, das Wirtgestein möglichst wenig zu schädigen, um dessen Eigenschaften optimal nutzen zu können. Da Tongesteine bautechnisch anspruchsvoll sind, ist insbesondere die Tiefenlage des Lagers entscheidend für die Stärke des notwendigen Ausbaus der Untertagehohlräume. Der Ausbau darf die Langzeitsicherheit des Lagers nicht beeinträchtigen. Solche offenen Fragen stellen aus Sicht der Aufsichtsbehörden nicht die grundsätzliche Machbarkeit eines Lagers infrage, sondern sind Bestandteil des schrittweisen Verfahrens zur Optimierung. Das ENSI wird bei jedem von der Nagra getroffenen Entscheidungsschritt prüfen, ob die Datenlage ihn rechtfertigt.
Die nächsten Schritte
Die sicherheitstechnische Überprüfung des ENSI hat die von der Nagra in Etappe 1 vorgeschlagenen Standortgebiete bestätigt. Die Bewertung der Standortgebiete lässt aufgrund der unterschiedlichen Datenlage in den Standortgebieten aber noch keinen direkten Vergleich der Gebiete zu. Dies wird erst im Rahmen der kommenden Etappe 2 möglich werden. In einem Bericht zuhanden der Behörden wird die Nagra darlegen, wie der Wissensstand in den einzelnen Gebieten aussieht und welche Daten sie für die anstehenden Sicherheitsanalysen noch erheben wird. Der Entscheid des Bundesrats zur Etappe 1 fällt Mitte 2011.
Dr. Meinert Rahn, Geologe, Leiter der Sektion Geologie am Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat.
Dr. Felix Altorfer, Physiker, Leiter der Abteilung Entsorgung am Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat.TEC21, Fr., 2010.10.08
08. Oktober 2010 Meinert Rahn, Felix Altorfer
Weltweite Suche
Ein Endlager für hochradioaktive Abfälle existiert bisher noch nirgends, die Suche danach läuft aber weltweit. Dabei unterscheiden sich die Konzepte der einzelnen Länder für ein solches Lager in einigen Aspekten, beispielsweise hinsichtlich des Wirtgesteins und des sicherheitstechnischen Konzepts. Auch die Verfahren zur Standortsuche und zur Öffentlichkeitsbeteiligung sind verschieden.
Weltweit gibt es trotz jahrzehntelangen Forschungen und vielen Endlagerprojekten derzeit noch kein betriebsbereites Endlager für hochradioaktive Abfälle. In vielen Ländern besteht mittlerweile aber in der Wissenschaft und in breiten Teilen der Gesellschaft ein Konsens, dass nur die Endlagerung in tiefen geologischen Formationen einen langzeitsicheren und ethisch vertretbaren Entsorgungsweg für diese Abfälle darstellt, und es werden dafür geeignete Standorte gesucht. Die gewählten Ansätze unterscheiden sich jedoch je nach Land in vielen Aspekten, unter anderem hinsichtlich des Entsorgungskonzepts, der Wirtgesteine, des technischen Konzepts und der Sicherheitsanforderungen sowie des Verfahrens zur Standortsuche und der Einbeziehung der Öffentlichkeit.
Entsorgungskonzept
Mit dem Schweizer Sachplan geologische Tiefenlager werden zurzeit Endlagerstandorte für alle Arten von radioaktiven Abfällen, also schwach-, mittel- und hochradioaktive Abfälle, gesucht (vgl. «Das Schweizer Konzept», S. 16 ff.). Die hohen Sicherheitsstandards der geologischen Tiefenlagerung sollen damit auch für die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle zur Anwendung kommen. Dieses Konzept wird auch in Deutschland verfolgt, wo derzeit in Niedersachsen das Tiefenlager Konrad für Abfälle mit geringerer Radioaktivität gebaut wird. Einige andere Länder sehen für diese Abfälle jedoch oberflächennahe Entsorgungsoptionen vor oder haben diese schon realisiert. So setzen zum Beispiel Frankreich, England, Finnland, Schweden, die USA und Kanada für die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle auf oberflächennahe Endlager oder Kavernen, während die tiefe geologische Endlagerung nur für die hochradioaktiven Abfälle vorgesehen ist. Dieser Artikel konzentriert sich auf die Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle, an die die höchsten sicherheits- und verfahrenstechnischen Anforderungen zu stellen sind.
Salz, Tonst ein oder Granit?
Die Auswahl der Wirtgesteine für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle hängt von der Geologie des jeweiligen Landes ab. Weltweit werden Salz, Tongesteine und kristalline Gesteine wie zum Beispiel Granit untersucht. In der Schweiz wird der Opalinuston, ein Tonstein, favorisiert. Auch in Belgien und Frankreich sind Tongesteine in Diskussion, während in Finnland und Schweden eine Endlagerung in Granit vorgesehen ist. In Deutschland stehen Salzstöcke im Fokus. Tongesteine werden als Reserveoption ebenfalls, aber mit geringer Intensität, diskutiert. In England1, Kanada2 und den USA ist derzeit offen, in welchen Wirtgesteinen die Endlagerung stattfinden soll, da die Standortauswahl dort vor kurzem neu ausgerichtet wurde. Aufgrund der jeweiligen Geologie des Landes können aber gewisse Optionen ausgeschlossen werden.
In den USA war eine Endlagerung in Tuffgesteinen, einem vulkanischen Gestein, geplant. Allerdings konnten Zweifel an der Eignung des Standortes in Yucca Mountain in der Mojave- Wüste im Bundesstaat Nevada, der 2001 vom Kongress festgelegt worden war, auch mit fortschreitendem Erkenntnisstand nicht ausgeräumt werden. Der Antrag auf die Errichtung eines Endlagers am Standort Yucca Mountain wurde schliesslich im Frühjahr 2010 zurückgezogen
Unterschiedliche Gewichtung der Barrieren
Da bisher in keinem Land der Bau eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle genehmigt wurde, gibt es noch keine endgültig festgelegten technischen Konzepte, nach denen die Endlagerung realisiert werden soll. Erste vorläufige Konzepte bzw. grundlegende Überlegungen zum Einlagerungskonzept liegen allerdings in vielen Ländern vor. Durch das Konzept müssen die jeweiligen nationalen Sicherheitsanforderungen gewährleistet werden. Diese orientieren sich alle an den Empfehlungen der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO), unterscheiden sich aber in den konkreten Ausführungen.
In Finnland4 und Schweden5 sollen die radioaktiven Abfälle nach der sogenannten KBS-3- Methode für mindestens 100 000 Jahre6 endgelagert werden: Die Abfälle werden in Kupfer- Containern verpackt in vertikale oder horizontale7 Bohrlöcher verbracht, die anschliessend verfüllt werden. Da das Wirtgestein Granit klüftig und somit wasserführend ist, kommt bei diesem Konzept dem Behälter eine grosse sicherheitstechnische Bedeutung zu. Er trägt wesentlich zur Rückhaltung der Radionuklide bei.
In anderen Ländern wie zum Beispiel der Schweiz oder Deutschland soll im Wesentlichen die geologische Barriere, also das das Endlager umgebende Gestein, die Langzeitsicherheit über eine Million Jahre gewährleisten. Der Behälter und die Verschlüsse der Einlagerungsbereiche sind als technische und geotechnische Barrieren mindestens so lange wichtig, bis die durch die Einlagerung gestörte geologische Barriere wieder funktionsfähig ist. Weitere Unterschiede in den Konzepten der verschiedenen Länder betreffen u.a. Aspekte der Rückholbarkeit und des Monitorings. Das Einlagerungskonzept in Frankreich8 und der Schweiz muss beispielsweise die relativ einfache Rückholbarkeit für einen begrenzten Zeitraum gewährleisten.
Schwierige Standortsuche
Bei der Realisierung eines Endlagers ist die Suche und Festlegung des Standorts ein kritischer Punkt9. Erste Anläufe, einen Endlagerstandort festzulegen, gab es in vielen Ländern schon in den 1970er- und 1980er-Jahren. In Deutschland wurde der Salzstock Gorleben 1979 als potenzieller Endlagerstandort, der weiter zu erkunden sei, festgelegt. Vorangegangen waren geologische Untersuchungen zahlreicher Salzstöcke in Norddeutschland. Allerdings werden dieses Verfahren und die angewendeten Kriterien von Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Bevölkerung als intransparent kritisiert. In einem Parlamentarischen Untersuchungs- ausschuss soll derzeit geklärt werden, wie es zur Standortentscheidung gekommen ist. Das im Jahr 2000 verhängte Gorleben-Moratorium, ein Erkundungsstopp zur Klärung von Fragen bezüglich der Eignung des Standorts, wurde dieses Jahr beendet. Die Erkundungsuntersuchungen sollen in diesen Wochen wieder beginnen. Mithilfe einer vorläufigen Sicherheitsanalyse, die bis Ende 2012 fertiggestellt werden soll, soll prognostiziert werden, ob Gorleben die aktualisierten deutschen Sicherheitsanforderungen für Endlager einhalten kann. Viele der Verfahren, in denen frühzeitig ein Standort festgelegt wurde, scheiterten am Wider- stand der Bevölkerung, wie zum Beispiel Sellafield in England und Wellenberg in der Schweiz. In England und Kananda wurde wie auch in der Schweiz aus dem Scheitern dieser früheren Ansätze die Konsequenz gezogen, die Suche nach einem geeigneten Endlagerstandort grunsätzlich neu zu beginnen.1, 2 Basierend auf einer breit angelegten, öffentlichen Diskussion wurde dazu ein schrittweises Verfahren zur Standortfestlegung entwickelt.
Neubeginn mit Einbeziehung der Öffentlichkeit
England1 und Kanada2 räumen bei der Standortauswahl dem Prinzip der Freiwilligkeit die höchste Priorität ein: In beiden Ländern werden nur Gemeinden in die Suche einbezogen, die ihr Interesse an einem Endlagerstandort bekunden. Daraus eventuell resultierende Einschränkungen bei der Eignung der Geologie am Standort müssen durch technische Massnahmen ausgeglichen werden. Sowohl in Kanada als auch in England wird derzeit nach interessierten Gemeinden gesucht, wobei eine intensive Öffentlichkeitsarbeit die Suche begleitet. Auch in Finnland und Schweden mussten die Untersuchungen an den Standorten, die aufgrund geologischer Studien ausgewählt worden waren, in den 1980er-Jahren wegen mangelnder Akzeptanz in der Bevölkerung abgebrochen werden. Es folgte jeweils ein Neustart, bei dem die Gemeinden stärker einbezogen werden sollten. Im Gegensatz zu England und Kanada wurde das Verfahren zur Standortsuche allerdings nicht im Vorfeld detailliert festgelegt und mit der Öffentlichkeit diskutiert. In die Suche wurden solche Gemeinden einbezogen, die aufgrund der vorangegangen geologischen Untersuchungen als potenziell geeignet identifiziert wurden. In beiden Ländern hat die Standortgemeinde eine Art Vetorecht.9 Die Gemeinde Eurajoki in Finnland hat bereits Ende 1998 ihre Bereitschaft erklärt, ein Endlager zu akzeptieren. Ende 2000 stimmte das Parlament der Rahmenbewilligung für die Endlagerung am Standort Olkiluoto in dieser Gemeinde zu. Diese ist verbunden mit dem Nachweis der Standorteignung durch die Errichtung eines Untertagelabors. Im Jahr 2004 begann der Ausbau des Untertagelabors Onkalo, das im Juni 2010 die gewünschte Endlagertiefe erreicht hat und bis 2011 fertig gestellt sein soll. Der Antrag auf die Baugenehmigung des Endlagers wird für 2012 erwartet4, die Inbetriebnahme für 2020.
In Schweden wurden zwischen 1992 und 2001 vorläufige Eignungsuntersuchungen für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle in acht Gemeinden durchgeführt, die ihre Zustimmung dafür signalisiert hatten. Seit 2002 konzentrierten sich die Standortuntersuchungen auf die zwei Gemeinden Östhammar und Oskarshamn, beide bereits Standorte von Kernkraftwerken. Im Juni 2009 wurde der Standort Forsmark in der Gemeinde Östhammar ausgewählt10, an dem bereits seit 1988 ein Endlager für kurzlebige schwach- und mittelradioaktive Abfälle betrieben wird. Die schwedische Regierung muss die Entscheidung noch bestätigen. Dieses Jahr soll ein entsprechender Antrag für den Bau des Endlagers für hochradioaktive Abfälle gestellt werden. Dessen Inbetriebnahme ist für 2023 vorgesehen.
In Frankreich wurde die Errichtung eines geologischen Endlagers ähnlich wie in Finnland an die vorherige Erkundung des Standorts durch ein Untertagelabor gekoppelt. Zwei Untertagelabore sind gesetzlich vorgeschrieben. Es konnte jedoch nur an einem Standort die erforderliche Zustimmung der Gemeinde erzielt werden. Der Standort Bure, an dem seit zehn Jahren ein Untertagelabor in jurassischen Tongesteinen betrieben wird, wird daher voraussichtlich auch Standort des Endlagers werden. Vorgesehen ist dessen Inbetriebnahme für 2025. Begleitet wird dies von einer sogenannten Öffentlichen Interessengruppe (CLIS), in der lokale Stakeholder vertreten sind.
Zurzeit sind also in mehreren Ländern erfolgversprechende Aktivitäten bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle sichtbar. Allerdings ist bisher nur in Finnland und Schweden der kritische Punkt der Standortfestlegung erfolgt. Aber auch dort sind noch einige sicherheitstechnische Fragen offen, die weiter untersucht werden müssen. Das in der Schweiz verfolgte Sachplanverfahren stellt im internationalen Vergleich einen hohen Standard hinsichtlich der Transparenz und der Möglichkeiten zur Öffentlichkeitsbeteiligung dar.
Anne Minhans, Geowissenschaftlerin, Öko-Institut e.V., DarmstadtTEC21, Fr., 2010.10.08
08. Oktober 2010 Anne Minhans