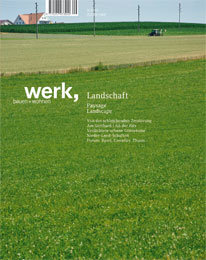Editorial
Die Landschaft ist eine Konstruktion unserer Wahrnehmung und eine relativ neue «Erfindung». Ein geografisches Gebiet wird dann zur Landschaft, wenn es betrachtet oder abgebildet wird und der Mensch dadurch ein Verhältnis zu ihr aufbaut. In der Art und Weise, wie der Begriff gemeinhin verwendet wird, schwingen meist ästhetische und emotionale Komponenten mit; Landschaft lässt einen nicht gleichgültig. Sie weckt stets auch die Sehnsucht – eine Sehnsucht, die oft eine melancholische Färbung annehmen kann. Während der Romantik stand die Anziehungskraft der malerischen Natur als treibende Kraft im Vordergrund und verstärkte sich mit der Industrialisierung und den damit einher gehenden massiven Eingriffen in den Naturraum. In seinem Buch «Helvetische Meliorationen – Die Neuordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse an der Linth 1783-1823» beschreibt der Historiker Daniel Speich am Beispiel des Linthwerks, wie sich im späten 18. Jahrhundert die Haltung gegenüber der Natur grundsätzlich änderte. Wurden zuvor Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen als gottgegeben akzeptiert, nahmen die Menschen mit dem Bau des Linthkanals ihr Schicksal selber in die Hand. Dieses Jahrhundertbauwerk veränderte nicht nur das Leben der dort lebenden Bevölkerung, sondern in erheblichem Mass auch die Landschaft.
Was damals richtig und überlebenswichtig war, wird heute kritischer betrachtet, jedoch nicht ohne Ambivalenz. Die Zersiedlung wird hingenommen, während so genannt intakte Landschaften vorwiegend durch die verträumt-verklärte Brille betrachtet werden. Infrastrukturbauwerke werden darum über Dutzende von Kilometern von Tunnels oder Lärmschutzkorridoren verschluckt. Dadurch gerät jedoch der «verschonte» Landstrich aus dem Blickfeld. Als eine der wenigen Konstanten in der Wahrnehmung von Landschaft kristallisiert sich die permanente Veränderung heraus, die auch das Thema dieses Heftes ist. Klartext redet eine Serie von Bildpaaren, die unterschiedlich begründete Veränderungen der Landschaft zeigen. Ein Beitrag widmet sich der Vermessungstechnik, die als Wegbereiterin die Grundlagen für viele von Menschenhand veranlasste Transformationen der Landschaft schafft. Wagemutige Topografen und Landvermesser durchkämmten im 19. Jahrhundert jedes Alpental und erklommen unzählige Alpengipfel, oft begleitet vom Misstrauen der lokalen Bevölkerung. Wir blicken auf die Gotthardregion, die wie kaum eine zweite Landschaft in der Schweiz von einer ständigen Umformung betroffen ist, wechseln auf den Massstab der Agglomeration Birsstadt, in der ein neues Freiraumkonzept die verbleibenden Grünflächen miteinander verknüpft, um uns dann auf der Mikroebene der Siedlung im urbanen Kontext mit den ganz alltäglichen Grünräumen des Wohnens auseinanderzusetzen. Ein Blick nach Holland eröffnet schliesslich unerwartete Perspektiven auf eine Architektur, die wie dem Meer abgerungene Poldergebiete von der Landschaft als Artefakt erzählt.