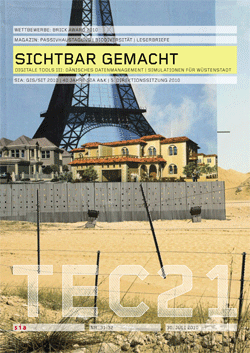Editorial
Die gute alte Zeit, in der Architektinnen und Architekten mit Bleistift oder Feder zarte Abbilder ihrer baulichen Ideen auf Papier brachten, scheint in Anbetracht der heutigen Möglichkeiten, Projekte darzustellen, eine halbe Ewigkeit her zu sein. Natürlich gibt es ihn noch, den feinsinnigen, skizzierten, zum Bild werdenden Entwurf.
Doch zu ihm gesellen sich immer mehr Konkurrenten wie digitale Tools und Programme, die mit Daten gefüttert werden möchten und schliesslich Unmengen von Plänen und Listen ausspucken können. In Dänemark, einem Land, in dem sich Architekturschaffende noch mehr als anderswo als Künstler verstehen und auch so entwerfen und planen, ist die Nutzung der digitalen Werkzeuge 2007 zur staatlich verordneten Pflicht geworden: Das Gesetz fordert, dass bei grösseren und öffentlich finanzierten Projekten alle projekt- und gebäudespezifischen Daten bereits in der Entwurfsphase detailliert aufgeführt werden müssen, und zwar digital und in dreidimensionalen Modellen. Für Planungsbüros bedeutet das einen immensen und nicht zusätzlich finanzierten Mehraufwand – für Bauherrschaften hingegen eine willkommene Möglichkeit, das gesamte Projekt gut verwaltet zu wissen und Kosten einsparen zu können. Das Gesetz will, auch wenn es aus verständlichem Grund verabschiedet wurde, wie Odilo Schoch im Artikel «Dänisches Datenmanagement» berichtet, nicht so recht auf die Kulturtradition der dänischen Entwerferinnen und Architekten passen. Es bedarf einiger Anpassungen, damit es von allen Beteiligten als Planungs- und Realisierunghilfe gesehen werden kann.
Einige tausend Kilometer südöstlich, in Abu Dhabi, entsteht derweil Masdar als Stadt der Zukunft: nachhaltig, sich selbst versorgend und ressourcenschonend. Um solch ein Projekt inmitten der Wüste planen zu können, benötigten die Architektinnen und Architekten zunächst Simulationen zu Hitze, Feuchtigkeit, Wind und Schatten, bevor sie mit der Stadtplanung beginnen konnten. Im Artikel «Simulationen für die Wüstenstadt» erläutern die drei Autoren die Anforderungen des Projekts und geben einen Einblick in die Simulationsschritte und -methoden, mit denen Masdar digital entstehen konnte. Wenn das Projekt in seiner ganzen Grösse fertiggestellt werden sollte, wird sich zeigen, wie weit die Realität mit der Vision der schattigen, für dortige Verhältnisse angenehm temperierten Strassen und Plätze übereinstimmt.
Katinka Corts
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Brick Award 2010
08 MAGAZIN
Passivhaustagung: Fokus Sanierung | Biodiversität: Bevölkerung aufklären | Leserbriefe| Energie im Untergrund besser nutzen | Naturarchitektur oder Kunstnatur? | Bücher
16 DÄNISCHES DATENMANAGEMENT
Odilo Schoch
Architektinnen und Architekten sind in Dänemark dazu verpflichtet, vordefinierte digitale Schnittstellen und Werkzeuge zu benutzen. Das soll Kosten senken und die Verwaltung vereinfachen.
21 SIMULATIONEN FÜR DIE WÜSTENSTADT
Tobias Fiedler, Kai Babetzki, Matthias Schuler
Die Stadt der Zukunft soll ab 2020 in Abu Dhabi zu finden sein: Masdar City. Um für diese Region eine nachhaltige Stadt zu modellieren, müssen schon vor der Gebäudeplanung viele Simulationen u.a. zu Kühlung und Verschattung durchgeführt werden.
27 SIA
GIS/SIT 2010 | 40 Jahre SIA A&K | Weiterbildung und Veranstaltungen | 5. Direktionssitzung 2010 | Betonstahl und Bewehrungsmatten
30 PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Dänisches Datenmanagement
Dänische Architektinnen und Architekten müssen seit 2007 bei grösseren oder öffentlich finanzierten Projekten vordefinierte digitale Schnittstellen und Werkzeuge nutzen. Die Verwaltung der Projektdaten soll so vereinfacht und beschleunigt werden. In der Realität passt diese digitale Interdisziplinarität aber noch nicht mit der gewohnten Arbeitsweise zusammen, Gesetz, Werkzeuge und Arbeitsprozesse müssen überarbeitet werden.
Als der dänische Staat im Jahr 2007 das beinahe revolutionäre Gesetz «Bygherrekravene» (zu deutsch: «Bauherrenanforderungen») erlassen hat, das zur vordefinierten Nutzung von digitalen Werkzeugen und Schnittstellen bei grösseren (Baukosten ab etwa 550 000 Fr.) oder öffentlich finanzierten Projekten verpflichtet, wurde vor allem eine Produktivitäts- und Qualitätssteigerung der Baubranche von jährlich mehr als einer Milliarde Schweizerfranken erwartet. Dabei geht es im Kern um ein längst bekanntes Thema: Projektbezogene Gebäudeinformationen werden derart verwaltet, dass sie möglichst vielen Projektbeteiligten Vorteile bringen. Im Idealfall werden sämtliche Projektphasen in mehrdimensionalen virtuellen Datenstrukturen abgebildet – von der Standortsuche über die Entwurfsphase und die Baurealisation bis hin zur Nutzung des Gebäudes und dessen Rückbau. Das bedeutet bessere Gebäude zu geringeren Kosten und massive Veränderungen der bisherigen Arbeitsmethoden.
In Dänemark ist dieser Ansatz auch insofern revolutionär, als dass durch das Gesetz die Nutzung von kostenpflichtiger Software notwendig ist und vor allem die bewusst individuell entwickelten Entwurfsmethoden der Architektinnen und Architekten hinterfragt werden. Während sich Bauunternehmen über präzisere und kostenlos erstellte Massenmodelle freuen, verschuldeten sich einige Büros mit dem übereilten Kauf von komplizierter Software und unpassenden Schulungen. Die Betrachtung der skandinavischen Entwicklungen hilft, die eigene Projektarbeit in der Schweiz zu analysieren sowie die Zusammenarbeit mit Partnern zu optimieren. Grundsätzliche Probleme der Haftung und der Beweisführung im digitalen Alltag sollten auch in der Schweiz berücksichtigt werden, da sonst die finanzielle Effizienzsteigerung schnell obsolet wird.
Produktivitätssteigerung und Kostenreduktion
Die gesetzlichen Anforderungen Dänemarks gehen weit über ein vorgegebenes Ebenensystem in CAD-Software hinaus. Pflichtelemente sind beispielsweise eine hierarchische Bauteilklassifikation, objektbasierte 3D-Modellierungen und internetbasierter Datenaustausch zwischen den Projektpartnern auch während der Gebäudeerstellung. Da sich von Anfang an AutoDesk mit seinem Produkt «Revit» sehr gut als Problemlöser vermarktete, wird in Dänemark das Building Information Modelling (BIM) immer noch mit dieser Software gleichgesetzt. Für Schweizer Architekturstudierende ist dies nichts Neues, da u.a. die ETH Zürich bereits seit Anfang der 1990er-Jahre die Idee des «virtuellen Produktmodells» vermittelt. Allerdings folgen dänische Architektinnen einem historisch verankerten künstlerischen Entwurfsansatz mit einer disziplinorientierten Etappierung der Projektphasen. Noch heute ist es durchaus üblich, dass Architekten ihre Wettbewerbsbeiträge weitgehend ohne Fachingenieure erstellen, um dann kurz vor der Submission eine schwierige Realisierbarkeit oder verfehlte Energiebedarfsziele bestätigt zu bekommen. Das endet entweder in rein formal begründeten Entwürfen oder in einer kostspieligen Komplettüberarbeitung. Hinlänglich bekannt ist, dass eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit auch ein kritisches Wissen über die Anforderungen und Aktivitäten der Partner erfordert. Diese Wissensbildung ist ein langwieriges Unterfangen und lässt sich nicht über Nacht etablieren. Hier kollidiert die künstlerisch orientierte dänische Architekturtradition mit den Möglichkeiten einer digital unterstützten Zusammenarbeit. So werden Vorteile des BIM wie die schnelle Evaluation von Entwurfsvarianten durch die Mehrzahl der dänischen Architekten als ausserordentliche und unbezahlte Mehrbelastung gesehen, da bereits in frühen Entwurfsphasen vergleichsweise präzise Angaben zu Materialien, Dimensionen und Bauphysik gemacht werden müssen.
Das dazu notwendige Wissen haben in Dänemark die Baukonstrukteure und teilweise die Bauingenieurinnen. Es zeichnet sich derzeit auch ab, dass diese beiden Berufsgruppen zunehmend die Verwaltung der digitalen BIM-Modelle übernehmen werden, was eine Übernahme des Projektmanagements bedeutet. Der Wissensvorsprung, der durch die direkte Interaktion mit den zentralen Projektinformationen entsteht, ist ein enormer Machtgewinn in einem Projekt. Die Vereinigung Dänischer Architekturbüros (DanskeArk) ist deshalb besorgt darüber, dass Architektinnen und Architekten sowohl ihre gewünschte Position als Organisator und Dirigent eines Projektes als auch einen Anteil ihres Honorars verlieren könnten.
Überarbeitung notwendig
Die dänischen Architekten haben mit ihrer Nichtakzeptanz des neuen Gesetzes auf dessen Schwächen hingewiesen. Hauptsächlich kritisieren sie die zu frühe Spezifikation von Bauelementen. Bereits zur Baueingabe sollten Bauelemente in Materialität und Typologie definiert werden, was spätere Optimierungen durch Alternativvorschläge in den Ausschreibungen erschwert. Zudem sehen die bestehenden Honorarstrukturen keine Erhöhung der Honorarsumme vor, obwohl die Architekten ein 3D-Modell erstellt haben, das sehr detailliert ist und meist kostenlos an die Projektpartner weitergegeben wird. Dass ein dreidimensionales, objektorientiertes BIM-Modell als «Abfallprodukt» des Entwurfsprozesses entsteht, ist meist nur Theorie, da bisherige Modelliersoftware einen Transport unterschiedlichster Gebäudeinformationen verunmöglicht. Der Grund dafür ist, dass die üblichen BIM-Werkzeuge für die Werkplanung optimiert sind und weniger die Anforderungen der ersten Entwurfsphasen berücksichtigen. Erst in jüngerer Zeit bewegen sich die BIM-Werkzeuge in Richtung der Skizzierphasen, um bereits dort mit der Digitalisierung der Projektinformationen beginnen zu können. Diese neueren Werkzeuge fokussieren auf den Raum und weniger auf die Geometrie der Baukonstruktion.
Dänische Architektinnen stehen dem Wechsel von einer bilderlastigen Architekturkommunikation hin zur Vermittlung formal unsichtbarer Werte – wie dem ökologischen Fussabdruck des entworfenen Projekts – kritisch gegenüber. Dies geht einher mit der weit verbreiteten Resistenz gegen die kritische Analyse der eigenen Arbeitsprozesse in Projekt und Büro. In Dänemark bieten deshalb zahlreiche BIM-Berater ihre Dienste an, um Planenden die Integration eines Informationsrecyclings zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass nicht nur dem operativen Bereich eines Büros mit seinen CAD-Nutzern die Vorteile und Gefahren eines strukturierten mehrdimensionalen CAD-Modells erläutert werden, sondern auch das Management die Wiederverwendung von Projektinformationen erlernt. Arbeitsprozesse müssen den neuen Anforderungen und Möglichkeiten angepasst werden, denn sie sind projekt- und teamorientiert und unabhängig von einer spezifischen Software. Auch aufgrund dieser Schwächen schreibt derzeit das dänische Wirtschaftsministerium eine Überarbeitung der Bauherrenanforderungen aus. Dabei sollen sowohl die konzeptionelle Ebene in Form von 0-dimensionalen Modellen integriert werden als auch die Anforderungen und Möglichkeiten der kommenden Generation von parametrischen Entwurfswerkzeugen und kundenindividueller Massenproduktion.[1] Beide Themen sind derzeit nicht über die Grenzen einer einzelnen Software kommunizierbar, da immer ein Informationsverlust eintritt. Deshalb wird auch erwogen, den Projektbeteiligten die Erstellung von mehreren thematisch optimierten BIM-Modellen zu empfehlen, die klare Schnittstellen zueinander haben – ohne Datenredundanz. Noch ist unklar, ob sich infolge derart neuer Empfehlungen auch die allgemeine Gesetzgebung verändert. Insbesondere der Austausch von Datenbanken anstatt zweidimensionaler Papierpläne als rechtlich bindendes Dokument wäre ein Fortschritt.
Abbildung unscharfer Werte
In diesem Zusammenhang zielt die Forschung an dänischen Universitäten derzeit auf die massgeschneiderte Integration der Software und Reglemente in den personalisierten und frühen Entwurfsprozess. Da die Stärken der skandinavischen Architektinnen in der Konzeptphase eines Entwurfes liegen, gibt es hier sehr gute Bedingungen, um bestehende Softwarepakete auf deren Tauglichkeit zu testen und zukünftige Programme zu entwickeln. Da die ersten Entwurfsphasen grossen Einfluss auf die Qualitäten des zukünftigen Gebäudes haben, lohnt sich die Integration von Werkzeugen, welche die Entscheidungsfindung vereinfachen. So werden die Kosten- und Ressourceneffizienz eines künftigen Gebäudes am stärksten zu Projektbeginn definiert – einer Phase relativer Unwissenheit.
Im Rahmen des Forschungsprojekts «creative data» erarbeiten deshalb 19 dänische Partner in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich das Potenzial entwurfsunterstützender Software in allerersten Entwurfsphasen. Dabei wird bewusst nach Lösungen gesucht, die die teilweise unscharfen Werte eines architektonischen Entwurfs in virtuellen Modellen abbilden können. Es geht weniger um eine dreidimensionale Modellierung als vielmehr um Beschreibungen der Konzepte, Atmosphären und räumlichen Qualitäten. Diese unscharfen Informationen sind später im Gebäudebetrieb wichtig, da u.a. die Nutzer von einem Verständnis der ursprünglichen Konzepte z. B. durch reduzierte Betriebskosten profitieren können. Noch können hier nur wenige etablierte Werkzeuge erste Antworten geben. Werkzeuge wie die browserbasierte Plattform von Kimon Onuma wecken grosses Interesse, da sie analytische und generative Prozesse weitgehend unabhängig von spezifischen CAD-Werkzeugen erlauben. Wichtigstes Austauschformat in diesem OnumaPlanningSystem ist die offene Datenschnittstelle IFC. Sie erlaubt Import und Export informierter Gebäudemodelle, z. B. in Diagramme, Konzeptmodelle oder die Überprüfung von Vorgaben wie dem Raumprogramm. In der dänischen Gesetzgebung wurde die Realität der skandinavischen «Gewaltenteilung» zwischen Architekten und Ingenieurinnen vernachlässigt. Die Bauherrenanforderungen erscheinen als hochgradig optimiertes Klassifizierungssystem für die grossen Bauunternehmerinnen und millionenschwere Projekte. Es ist jedoch kein Werkzeug, mit dem z. B. die Ressourceneffizienz eines Stadtteils ganzheitlich abgebildet werden kann. Partiell haben Ingenieurbüros einen Vorteil durch klare Bauteilinformationen. Der ursprünglich anvisierte Nutzniesser «Gebäudebetrieb» geht leer aus, da noch immer keine inhaltlich funktionierende Schnittstelle zum Facility Management geschaffen wurde.
Norwegische Offenheit
Der Blick nach Norwegen zeigt im Gegensatz dazu die Möglichkeiten eines offeneren Ansatzes für BIM. Es wurde kein explizites Gesetz verabschiedet, jedoch forciert der staatliche Gebäudeeigentümer Staatsbygg die Verwendung des IFC-Datenformats und eine optimierte Lokalisierung globaler Standards. Dies bedeutet, dass Staatsbygg eng mit der US-amerikanischen Partnerinstitution GSA zusammenarbeitet und gleichzeitig bewusst norwegische Programmierer beauftragt, kleine Werkzeuge zur Simulation norwegischer Besonderheiten zu entwickeln. Im Ergebnis gibt es beispielsweise Werkzeuge zur Energiebedarfssimulation, die mit dem polaren Klima umgehen können, oder Brandschutzprüfungen, bei denen ein virtueller Prüfer sämtliche Orte des virtuellen Gebäudes auf die Einhaltung der lokalen Verordnung überprüft – ein flexibles und kostengünstiges Tool.
Anmerkungen:
[01] Unter 0-dimensionalen Modellen wird das Modellieren von Informationsstrukturen verstanden, die die Entwurfsabsichten abbilden können und deren digitale Vermittlung unter den Projektpartnern erlaubt. Parametrische Modelle sind u.a. regelbasierte Entwürfe, deren Form und Bauteile auf einer relationalen Logik fussen. «Revit» und «Rhino3D» mit «Grasshopper» sind hierbei dominante Akteure – Der Artikel nutzt Markennamen, die den jeweiligen Eignern gehören.TEC21, Fr., 2010.07.30
30. Juli 2010 Odilo Schoch
Simulationen für die Wüstenstadt
Bis 2020 soll Masdar City als Stadt der Zukunft in Abu Dhabi gebaut werden. Um das Projekt weitab der europäischen Klimaverhältnisse bearbeiten zu können, simulierte die Firma Transsolar, wie sich u.a. Temperatur und Feuchtigkeit in Wüstenstädten mit geschickter Stadtmodellierung in den Griff bekommen lassen.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten mit ihren riesigen Erdöl- und Erdgasvorkommen und einer Pro-Kopf-Emission von über 30 t CO2 /Jahr[1] entsteht Masdar City: eine Stadt, die nur so viel Energie verbrauchen soll, wie sie selber mit Hilfe von Sonne, Geothermie und Wind erzeugen kann. Die «Ökostadt» Masdar – arabisch «Quelle» – entsteht für 22 Milliarden USDollar in Abu Dhabi und soll bis zum Jahr 2020 auf einer Fläche von 7 km2 Wohn- und Arbeitsort für 50 000 Einwohnerinnen und Einwohner werden. Geplant ist eine Bruttogeschossfläche von über 4 Mio. m2. Weitere 40 000 Menschen aus dem Einzugsgebiet sollen in Masdar Arbeit finden. Mit der 2006 gegründeten Abu Dhabi Future Energy Company (ADFEC)[2] steht eine zentrale, finanzstarke und durchsetzungsfähige Institution als massgebliche Initiatorin der städtebaulichen Entwicklung hinter dem Projekt, die letztlich alle gesetzlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen vorgibt und für deren Umsetzung sorgt. Der Standort hat praktisch keine «industriellen Altlasten»; industriepolitische Rücksichten auf etablierte Technologien müssen nicht genommen werden. Mit weit mehr als 2000 kWh/m²/Jahr besitzt der Standort ein grosses solares Potenzial für eine regenerative und nachhaltige Energiegewinnung. Nach den Vorgaben der Bauherrschaft soll der WWFNachhaltigkeitsstandard regelmässig überprüfter Bestandteil der Planungen, der Bauphase und des Monitorings der Stadt sein (vgl. Kasten). Ausgerechnet an einem Standort, an dem in den Sommermonaten mit Maximaltemperaturen von knapp 50 °C und mit absoluten Luftfeuchtigkeiten von über 25 g/kg zu rechnen ist, wollen die Planenden den Energiebedarf der Gebäude auf ein Minimum reduzieren und den Komfort ausserhalb der Gebäude so weit verbessern, dass der Mensch freiwillig auf sein klimatisiertes Automobil verzichtet? Die Anforderungen der ADFEC an die Planung der Zukunftsstadt waren hoch, und das Designteam um Norman Foster musste realistische Antworten auf viele offene Fragen finden.
Neben der Architektur waren im Team u. a. die Disziplinen Verkehrsplanung, Infrastrukturplanung, Energiesystemplanung und Klima-Engineering vertreten – unter anderem durch das Stuttgarter Unternehmen Transsolar, das viele Simulationen für die neu zu planende Stadt durchführte. Im Vergleich zu heutigen, in den Vereinigten Arabischen Emiraten üblichen Verbrauchsstandards sollte der Gesamtenergiebedarf von Masdar City um 80 % reduziert werden. Passive Strategien an den Gebäuden sind beispielsweise Fassadenoptimierungen bei Verglasung, Wärmedämmung, Tageslichtoptimierung, Luftdichtigkeit und adaptivem Sonnenschutz. Andererseits müssen alle haustechnischen Systeme und Infrastruktursysteme optimiert werden. Der restliche Energiebedarf der Stadt muss regenerativ und CO2-frei bereitgestellt werden.[3] Intelligente Verteilungsnetze, steuernde Energietarife und Speichertechnologien sollen dafür sorgen, dass der Energiebedarf der Stadt und die jeweilige Verfügbarkeit der erneuerbaren Energieressourcen sich weitgehend decken. Das gesamte innerstädtische Transport- und Verkehrssystem wurde in den Untergrund verlegt. Der «Personal Rapid Transport» – etwa 3000 computergesteuerte, schienengeführte Elektrofahrzeuge für jeweils vier bis acht Personen – wird Haltestellen im Abstand von 100 bis 200 m ansteuern. Mit dem Umland soll Masdar über den sogenannten «Light Rail Transport», eine Art Nahverkehrszug, verbunden werden. Auf Individualverkehr mit Verbrennungsmotortechnologie verzichtet Masdar City ganz, was die innerstädtische Luftqualität verbessert und eine dichte Bebauung ermöglicht. Das wiederum garantiert kurze Wege zwischen Wohnen, Arbeiten und Freizeit. In Anlehnung an die historische arabische Bauweise sind etwa 50 % der Fläche eines Blockes mit maximal vierstöckigen Gebäuden überbaut. Strassen und Gassen nehmen dagegen nur 15 % der Fläche ein. Die restlichen 35 % sind für Innenhöfe reserviert, über die die Gebäude natürlich belichtet, belüftet und erschlossen werden. Über geschlossene Wasserkreisläufe soll Regen-, Grau- und Schwarzwasser genutzt oder wiederverwendet werden. Klärgase, die bei der Aufbereitung von Abwasser entstehen, werden energetisch genutzt, und Salze, die bei der Meerwasseraufbereitung anfallen, sind industriell zu verwerten. Ausserdem tragen Material- und Abfallkreisläufe wie Kompostieren, Wiederverwerten von Wertstoffen, Recycling und die energetische Restmüllnutzung dazu bei, das Müllaufkommen zu reduzieren (Abb. 6).
Generische Funktionsmodelle
Masdar City muss im Betrieb CO2-neutral sein. Doch wo soll die konkrete Planung ansetzen? In welcher städtebaulichen Phase müssen die Gebäude konkret entwickelt werden, damit die neu entstehende Stadt und ihre Zellen funktionieren? Wie sehen die zeitabhängigen Energiebedarfskurven der Stadt in ihren unterschiedlichen Bauphasen aus? Wie und durch welche Energiesysteme kann die Energienachfrage möglichst zeitnah gedeckt werden? Wie ist der Aufenthaltskomfort ausserhalb und innerhalb der Gebäude zu definieren, zu quantifizieren und zu optimieren?
Mit Beginn des Masterplans definierte das Designteam erste generische Funktionsmodelle, die noch keinen architektonischen Ansprüchen zu genügen hatten. Mit generischen Funktionsmodellen für die Strassen und Plätze wurden die optimalen Strassenlängen und -breiten und deren Anordnung untersucht. Mit generischen Funktionsmodellen von Gebäudeblöcken (mit allen massgeblichen Nutzungen wie Büro / Verwaltung, Labor, Wohnen / Hotel, Bildung, Krankenhaus, Produktion, Restaurant / Einzelhandel und sakrale Bauten / Unterhaltung / Museen / Sportstätten) wurden die Energiebedarfskurven aller Gebäudearten abgebildet und die iterative Designentwicklung der Gebäude ermöglicht.
Thermisch-dynamische Simulationen
Für die Auslegung der erneuerbaren Energiesysteme, der Infrastruktur und der Speichersysteme müssen die zeitabhängigen Lastkurven aller relevanter Verbrauchsströme der Stadt in den einzelnen Entwicklungsphasen bekannt sein. Eine wesentliche Unbekannte sind die Bedarfskurven der unterschiedlichen Gebäudearten. Allein der Energiebedarf der Gebäude macht bereits ohne die industriellen Produktionsstätten über 40 % des Gesamtenergiebedarfs der Stadt aus. Mithilfe des thermisch-dynamischen Simulationstools «TRNSYS» wurden für jedes Gebäudemodell, das eine der acht unterschiedlichen Gebäudenutzungsarten repräsentiert, nutzungsspezifische Gebäudelastkurven generiert. Der Gesamtenergiebedarf der Stadt setzt sich aus den Gebäudelasten und den Bedarfskurven der städtischen Infrastruktur zusammen. Alle wesentlichen Verbraucher waren in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen – etwa die innerstädtische Medienverteilung, die Abfallbehandlung, die Strassenbeleuchtung, Verkehr und Transport, die Meerwasserentsalzung, die Abwasserbehandlung, Telekommunikation und IT sowie Verteilungsverluste.
Gekoppelte Simulationsstudien auf Verbraucherseite und auf Erzeugerseite, beides unter Berücksichtigung der auf die Jahresstunden aufgelösten Klimadaten für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeit, Aussentemperatur und Windgeschwindigkeit, führen zu detaillierten Kennziffern. Diese Studien ermöglichten schon in einer frühen Planungsphase ein belastbares Design des Energieverbrauchers «Gesamtstadt» und der darauf abzustimmenden Energieerzeugersysteme (Abb. 6). Im Verlauf der Simulationsstudien war durch Anpassung und Optimierung der Gebäude und der technischen Systeme festzulegen, welche Strategien zum Ziel der Bedarfsreduktion um 80 % führen. Mit diesen Informationen liessen sich die für die weitere Detailplanung relevanten Ausführungsrichtlinien aller Passivstrategien an den Gebäuden und aller Effizienzstrategien an den technischen Anlagen ableiten.
Untersuchung der City-Ventilation und des Auss enkomforts In dieser Klimaregion bestimmt der Aussenkomfort massgeblich die Art des Fortbewegungsmittels. Eine deutliche Reduktion des Individualverkehrs setzt jedoch neben kurzen Wegen auch die Bereitschaft der Stadtbewohnerinnen voraus, zu Fuss zu gehen. Um dies zu erreichen, müssen innerstädtische Hitzeinseln vermieden und der vom arabischen Golf kommende heiss-feuchte Nordwestwind von den verschatteten, natürlich gekühlten Strassen und Plätzen der Stadt ferngehalten werden, ebenso die aus dem Süden kommenden Sandstürme. Die auf den Dächern absorbierte Hitze muss abgeführt werden, dafür soll der kühlere Nachtwind aus dem Landesinnern die Stadt abkühlen.
Umfangreiche Simulationsstudien unter Einsatz des Strömungssimulationstools «FLUENT», gekoppelt mit dem thermisch-dynamischen Simulationsprogramm «TRNSYS», erlaubten nach einer Quantifizierung des heutigen Istzustandes der «modernen» Städte am Golf den Aussenkomfort von Masdar zu verbessern. Basierend auf diesen Studien wurden die Orientierung der Hauptachsen der Stadt festgelegt, die maximalen Strassenbreiten und -längen bestimmt sowie die Verschattungsstrategien der Plätze und Innenhöfe optimiert. Flankiert wurden die Strömungsstudien von messtechnischen Untersuchungen. So war mithilfe eines Stadtmodells im Grenzschichtwindkanal trotz den massiven Stadtmauern und der hohen Bebauungsdichte eine ausreichende Stadtbelüftung durch Tracergas nachweisbar (Abb. 1–5).
Tageslicht über die Innenhöfe
In den Untersuchungen zum Aussenkomfort erwies sich ein möglichst grosses Verhältnis von Gebäudehöhe zu Strassenbreite als vorteilhaft, um eine maximale Verschattung der Aufenthaltsbereiche in den Strassen zu erhalten. Doch wie ist unter diesen Umständen eine Tageslichtversorgung von idealerweise 80–90 % der Tageszeit insbesondere der unteren Geschosse zu gewährleisten? Tageslicht ist in Verbindung mit hochselektiven Fassadengläsern immer noch die effizienteste und komfortabelste Art, Innenräume zu belichten. Eine hohe Tageslichtautonomie bedeutet deshalb im Idealfall auch eine reduzierte Kühllast im Gebäude. Zudem minimiert eine hohe Tageslichtautonomie den Betrieb von Kunstlicht. Mittels Tageslichtanalyse konnte schnell gezeigt werden, dass eine ausreichende natürliche Belichtung der unteren Geschosse bei diesen Strassenbreiten nicht möglich ist. Als Alternative bot sich die Möglichkeit, die Gebäude über die Innenhöfe natürlich zu belichten. Da jeder Innenhof einem Gebäude zugeordnet ist, wird eine adaptive Verschattung über motorische Sonnenschutzsysteme möglich. Wichtig ist eine Öffnung des Sonnenschutzes bei bedecktem Himmel und in den Nachtstunden, um eine radiative Auskühlung der Gebäude zu unterstützen. Als Zielwert wurde ein mittlerer Tageslichtquotient[4] von 2.7 % definiert, der auch im untersten Geschoss auf allen Hauptnutzflächen zu gewährleisten war. Aus den insgesamt 840 Simulationen leitete Transsolar wichtige Designparameter zum Innenhof und zum Fassadenaufbau ab, und die Ergebnisse konnten in einem weiteren Schritt auch in thermische Simulationen einfliessen.
Vision und Realität
Masdar-City soll in nur 15 Jahren fertig gebaut werden. Ein ehrgeiziger Fahrplan angesichts der technologischen, städtebaulichen und gesellschaftlichen Herausforderung. Im Kontext der weltweiten Wirtschaftskrise hörte und las man bezüglich Masdar von «Baustopp» und «kleineren Lösungen». Die Ideen sollen auf ihre finanzielle Machbarkeit überprüft werden. Das zeigt, dass auch in dieser Region die Geldquellen nicht mehr ungehindert sprudeln. Entwicklungen dieser Dimension benötigen auch hier einen realistischen Rahmen. Es braucht eben seine Zeit, die nötigen Erfahrungen zu sammeln für erste Antworten auf die Frage, wie die Stadt der Zukunft aussehen könnte.
Anmerkungen:
[01] Vergleich zur Schweiz aus dem Jahre 2005: 8.6 t CO2-Äquivalent pro Person
[02] www.masdar.ae
[03] Dieser Ansatz steht im Einklang mit der an der ETH Zürich entwickelten Strategie der 2000-Watt- Gesellschaft: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ETHZ – Energie, Umwelt und die 2000-Watt-Gesellschaft. Siehe auch SIA-Effizienzpfad Energie; Merkblatt 2040
[04] Der Tageslichtquotient beschreibt bei ideal bedecktem Himmel das Verhältnis aus Innenbeleuchtungsstärke zu Aussenbeleuchtungsstärke. Für den Standort Abu Dhabi ergibt sich bei einem Quotienten von 2.7 % eine Tageslichtautonomie von über 80 %TEC21, Fr., 2010.07.30
30. Juli 2010 Tobias Fiedler, Kai Babetzki, Matthias Schuler