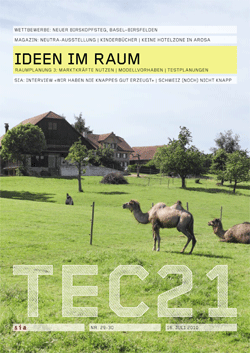Editorial
Mit dem vorliegenden Heft wird die vierteilige Serie zur Raumplanung fortgesetzt. Die erste Ausgabe vom 5. März mit dem Titel «Die Schweiz wird knapp» lieferte einen Überblick über Geschichte und aktuelle Aufgaben der Schweizer Raumplanung. In der zweiten Ausgabe vom 21. Mai lag der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit und der Planungskultur. Beides ist für eine nachhaltige Raumentwicklung unabdingbar. Das vorliegende Heft ist nun verschiedenen Instrumenten in der Raumplanung gewidmet – einige davon werden bereits eingesetzt, andere sind erst angedacht und befinden sich im Stadium der Entwicklung. Gemeinsam ist allen, dass es sich um neue Ansätze und Ideen zur Lösung von Problemen im Raum handelt.
Der haushälterische Umgang mit dem Boden – eines der Hauptziele der Raumplanung – ist allgemein anerkannt. Die Herausforderung liegt vor allem in der Umsetzung. Dazu braucht es politischen Willen auf allen Ebenen – vom Bund über die Kantone bis hin zu den Gemeinden. Ebenso wichtig ist es aber auch, dass effektive, praxistaugliche und allgemein akzeptierte Instrumente zur Verfügung stehen.
Im Artikel «Marktkräfte nutzen» wird ein Überblick über marktwirtschaftliche bzw. anreizorientierte Instrumente präsentiert. Während viele Ökonomen die Umsetzung solcher Ansätze begrüssen, dominiert bei den Raumplanungsfachleuten Skepsis. Doch ökonomische Instrumente stellen lediglich ein Mittel dar, um bestimmte Ziele zu erreichen. Die Ziele selber sind durch die Raumordnungspolitik bzw. die Gesellschaft in einem demokratischen Prozess festzulegen. In «Modellvorhaben nachhaltige Raumentwicklung» werden die Modellvorhaben des Bundes vorgestellt. Seit 2002 unterstützt das Bundesamt für Raumplanung Projekte, die neue Ansätze für eine nachhaltige Raumentwicklung erproben, beispielswei-e die Zusammenarbeit über administrative Grenzen hinweg. Damit werden in Gemeinden oder Regionen Lernprozesse in Gang gesetzt, die auch für andere als Vorbild dienen können. Der Artikel auf Seite 28ff. stellt mit den Testplanungen ein neues Instrument vor, das sich bei diversen komplexen Planungsvorhaben bewährt hat. Verschiedene Teams erarbeiten gleichzeitig Lösungsvorschläge. Der strukturierte Prozess erlaubt das Testen verschiedener Ideen, wobei sich dank dem interdisziplinären Ansatz relativ rasch gangbare Wege herauskristallisieren.
Wie schon bei den ersten beiden Heften zur Raumplanung stammen die Fotos wiederum von Hannes Henz. Auf dem Land hat er Impressionen eingefangen, die uns vertraut sind – und bei genauerer Betrachtung doch auch irritieren. Aber was ist es eigentlich, das uns wichtig ist an der heimischen Landschaft? Vielleicht helfen die Bilder, eine Antwort zu finden.
Lukas Denzler
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Neuer Birskopfsteg, Basel–Birsfelden
10 MAGAZIN
Neutra: begehbare Anmutung | Kinderbücher | Die Redaktion dankt Rita Schiess | Keine Hotelzone in Arosa
12 PERSÖNLICH
Remo Caminada: «Ich habe keinen Plan für mein Leben» | Ämter und Ehren
18 MARKTKRÄFTE NUTZEN
Lukas Denzler
Anreizorientierte Instrumente könnten das aktuelle Instrumentarium der Raumplanung ergänzen und dieser neue Impulse verleihen.
22 MODELLVORHABEN NACHHALTIGE RAUMENTWICKLUNG
Melanie Butterling, Jude Schindelholz
Das Bundesamt für Raumentwicklung unterstützt innovative Projekte, die wichtige Anliegen der Raumentwicklungspolitik umsetzen.
28 TESTPLANUNGEN ALS NEUE METHODE
Bernd Scholl
Testplanungen eignen sich für komplexe raumplanerische Aufgaben. Dabei werden Vorschläge verschiedener Teams offen diskutiert und miteinander verglichen.
34 SIA
Hans-Georg Bächtold: «Wir haben nie knappes Gut erzeugt» | Die Schweiz ist (noch) nicht knapp
39 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Modellvorhaben nachhaltige Raumentwicklung
Unter dem Titel «Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung» unterstützt das Bundesamt für Raumentwicklung innovative Projekte, die wichtige Anliegen der Raumentwicklungspolitik umsetzen wie beispielsweise die Zusammenarbeit über administrative Grenzen hinweg. Die Modellvorhaben tragen dazu bei, entsprechende Prozesse in Gemeinden oder Regionen in Gang zu bringen oder zu beschleunigen, die dann zum Vorbild für andere werden sollen.
Die Gemeinden Agno, Bioggio und Manno in der Agglomeration von Lugano (Region Basso Vedeggio) haben sich in den letzten Jahren wirtschaftlich stark entwickelt. Die räumliche und funktionale Organisation der Region ist hingegen diejenige eines Vororts geblieben. Die drei Gemeinden haben daher mit Unterstützung des Kantons und des Bundes die Initiative ergriffen, um die räumliche Entwicklung der Region voranzutreiben und Massnahmen untereinander zu koordinieren. Auf diese Weise wollen sie ihre Region auch aus Sicht der Siedlungsentwicklung zu einem komplementären Zentrum zu Lugano werden lassen. Dafür wurde ein strategisches Leitbild erarbeitet, das z.B. die Ausscheidung von Arbeitsplatzzonen, bessere Anschlüsse an den öffentlichen Verkehr oder die Ausgestaltung der öffentlichen Grünfläche sicherstellen und koordinieren soll. Das Leitbild wurde auf die kantonalen Politiken und Herausforderungen wie etwa die geplante Umfahrungsstrasse Agno–Bioggio abgestimmt. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen und die Einbindung privater Akteure stellen sicher, dass die Überlegungen zum Leitbild umsetzbar sind.
Laboratorien künftiger Entwicklung
Dieses Projekt ist eines von insgesamt 46 Modellvorhaben «Nachhaltige Raumentwicklung», die derzeit vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) in Zusammenarbeit mit weiteren Bundesämtern unterstützt werden. Im Raumentwicklungsbericht 2005 stellte das ARE fest, dass für eine nachhaltige Entwicklung der Schweiz noch erhebliche Anstrengungen notwendig sind. Dafür braucht es auch neue Ansätze. Mit den Modellvorhaben werden daher innovative Strategien, Projekte und Prozesse für eine nachhaltige Raumentwicklung gefördert.
Nicht über Ge- und Verbote, sondern durch positive Beispiele will der Bund damit zur Umsetzung wichtiger Anliegen der Raumentwicklungspolitik – wie etwa der Inwertsetzung regionaler Potenziale, der Siedlungsentwicklung nach Innen und der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit aller Akteure der Raumentwicklung – beitragen. Das Instrument der Modellvorhaben gibt lokalen, regionalen und kantonalen Akteuren einen Anreiz, Ideen in den vom Bund gesetzten Schwerpunkten zu entwickeln, und soll Experimente zu neuen Inhalten und Verfahren ermöglichen. Das bedeutet, dass Ausgang und Ergebnisse eines Modellvorhabens offen sein können. Die Modellvorhaben sind gewissermassen Laboratorien künftiger Entwicklung und sollen in der Verwaltung, in der Politik und bei der Bevölkerung Lernprozesse anstossen und letztlich Vorbild für andere Projekte sein.
Eine erste Runde von Modellvorhaben startete 2002 im Bereich Agglomerationspolitik und lieferte gute Erfahrungen in der interkommunalen Zusammenarbeit.1 Aufgrund der positiven Ergebnisse wurde das Instrument der Modellvorhaben 2007 auf weitere Bereiche – Nachhaltige Siedlungsentwicklung und Synergien im ländlichen Raum – ausgedehnt und unter dem Titel «Modellvorhaben der Nachhaltigen Raumentwicklung» zusammengefasst. Diese Modellvorhaben wurden im Rahmen von zwei Ausschreibungsrunden ausgewählt, die das ARE 2007 und 2008 für die nun drei Themenbereiche Agglomerationspolitik (hier gemeinsam mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco), Nachhaltige Siedlungsentwicklung und Synergien im ländlichen Raum (gemeinsam mit dem Bundesamt für Umwelt, Bafu), dem Bundesamt für Landwirtschaft, BLW und dem Seco) durchführte. Interessierte Kantone, Regionen und Gemeinden sowie private und gemischte Trägerschaften konnten einen Projektantrag einreichen. Entscheidend für die Auswahl war, dass das Modellvorhaben innovativ ist, eine langfristige Wirkung anstrebt, einen politischen Prozess initiiert und der besseren Abstimmung der verschiedenen Sachpolitiken dient. Nach eingehender Prüfung wurde 46 von 93 eingereichten Projekten Unterstützung zugesichert.
Jura: Leben in der Altstadt
Eines davon ist das Modellvorhaben «Habiter le centre ancien», das derzeit in Pruntrut und Fontenais im Kanton Jura läuft. Sowohl in den Städten des Kantons als auch auf dem Land droht ein Teil des architektonischen Erbes in naher Zukunft zu verschwinden, da immer mehr Menschen aus den historischen Zentren in neue Quartiere ziehen und die Ortskerne verwaisen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, will der Kanton das Wohnen in der Altstadt fördern. Im Rahmen des Modellvorhabens unterstützen Kanton und Gemeinden Sanierungsprojekte mit maximal 40 000 Franken pro Vorhaben.
Im ersten Jahr erhielten zwei Bauprojekte Beiträge: In einem Gebäude in der Altstadt von Pruntrut, in dem früher kleine Wohnungen ohne Komfort untergebracht waren und das seit Jahren leer stand, werden neu fünf Wohnungen und zwei Büros eingerichtet. Das zweite Projekt wird im Dorf Fontenais umgesetzt: Hier sollen in zwei verlassenen Scheunen vier Wohnungen entstehen. Weitere Vorprojekte sind angekündigt. Nach Ablauf der zweijährigen Pilotphase soll präzisiert werden, wie dieses Projekt über ein Gesetz und einen langfristigen Rahmenkredit auf das gesamte Kantonsgebiet ausgedehnt werden kann.[2]
Drei Themenbereiche der Modellvorhaben
Angesiedelt ist das Beispiel aus dem Kanton Jura im Themenbereich «Nachhaltige Siedlungsentwicklung ». Modellvorhaben in diesem Themenbereich können sich auf den ländlichen oder den urbanen Raum beziehen. Schwerpunkte sind das Siedlungsflächenmanagement (z. B. Siedlungsentwicklung nach innen; Begrenzung des Siedlungswachstums in die Fläche) und die interkommunale Zusammenarbeit (z. B. Festlegung von grösseren Siedlungsentwicklungsgebieten) (siehe Übersicht Abb. 1 S. 23).
Die Modellvorhaben «Agglomerationspolitik» befassen sich in erster Linie mit den Fragen und Herausforderungen des städtischen Raums und fokussieren auf zwei Themen: zum einen auf Projekte zur Entwicklung eines Stadtteils («projet urbain»), die in bestehenden wie in neuen Quartieren realisiert werden (Quartierentwicklung, Umnutzung von Brachen oder Entwicklung neuer zentraler oder periurbaner Quartiere) und die sowohl soziale als auch wirtschaftliche Aspekte sowie Umweltaspekte integrieren. Ein zweiter Schwerpunkt im Themenbereich «Agglomerationspolitik» ist die Zusammenarbeit in Agglomerationen, Städtenetzen und Metropolitanräumen.
Mit den Modellvorhaben «Synergien im ländlichen Raum» soll einerseits die Koordination der verschiedenen im ländlichen Raum wirkenden Sektoralpolitiken des Bundes und der Kantone optimiert und andererseits die institutionelle Zusammenarbeit öffentlicher und privater Akteure auf regionaler und lokaler Ebene gefördert werden. Die Projekte liegen folglich an der Schnittstelle verschiedener Sektoralpolitiken und Themenbereiche. Um sicherzustellen, dass alle Beteiligten von den Erkenntnissen aus den Modellvorhaben profitieren können, begleitet die Bundesverwaltung die Projekte zusammen mit den Kantonen und Regionen (inhaltliche Begleitung, technische Unterstützung, Wissenstransfer aus verschiedenen Sachbereichen). Die Bundesverwaltung organisiert regelmässig themenspezifische Tagungen, die dem Erfahrungsaustausch, der Vernetzung zwischen den Projekten und dem Erkenntnisgewinn dienen.[3]
Eigenamt: Bauland gemeinsam nutzen
Ein weiteres Beispiel der Modellvorhaben soll das Spektrum der bearbeiteten Themen illustrieren: Die fünf Gemeinden der Region Eigenamt AG haben beschlossen, die Erschliessung und Nutzung der vorhandenen Reserven an Industrie- und Gewerbebauland über die Gemeindegrenzen hinweg zu koordinieren und gleichzeitig auf Neueinzonungen zu verzichten. Damit wird an bester Verkehrslage eine der letzten grossen Industrie- und Gewerbebaulandreserven des Kantons Aargau mobilisiert. In den fünf Gemeinden sind insgesamt 160 ha Bauzone ausgeschieden, wovon rund ein Drittel noch nicht überbaut ist. Um die Zusammenarbeit zu ermöglichen, mussten schwierige Fragen diskutiert werden: Soll eine Gemeinde zugunsten von Nachbargemeinden auf Bauland und Steuereinnahmen verzichten? Wie können Nachteile durch Industrie- und Gewerbeansiedlungen für die Standortgemeinden, insbesondere im Bereich Lärm und Verkehrsaufkommen, ausgeglichen werden? Ein zentraler Punkt war daher der Nutzen-Lasten-Ausgleich. Dieser konnte am räumlichen Entwicklungskonzept anknüpfen, das zuvor von den fünf Gemeinden mit der Absicht einer koordinierten Entwicklung der Arbeitsplatzgebiete erarbeitet worden war. Damit waren strategische Weichen wie die Erschliessung der Gebiete bereits gestellt.
Heute, zwei Jahre nach Projektstart, arbeiten die Gemeinden gemeinsam an der Umsetzung der gesteckten Ziele. Die rechtliche Basis bildet der interkommunale Gemeindevertrag «Räumliche Entwicklung Eigenamt», der für die nächsten fünf Jahre konkrete Realisierungsvorhaben und einen ausgeklügelten Kostenverteilschlüssel vorsieht. Die entsprechenden Kredite wurden von allen Gemeindeversammlungen gesprochen. Zwei Projekte sind bereits weit gediehen: Die für die ganze Region einheitliche Muster-Bau- und Nutzungsordnung für Arbeitsplatzzonen ist schon behördenverbindlich, und der Bauland-Info-Pool, ein Onlineportal für Industrie- und Gewerbeflächen bzw. -objekte, wird im August 2010 aufgeschaltet.[4]
Raumentwicklungspolitik vor Ort verankern
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und den Kantonen leisten, indem sie als Prozessbeschleuniger oder auch Initiant einer Zusammenarbeit wirken. Die beteiligten Regionen und Gemeinden haben die Wichtigkeit erkannt, über die administrativen Grenzen hinweg in funktionalen Räumen zusammenzuarbeiten, neue Netzwerke und Governance-Strukturen sind entstanden. Die Unterstützung durch den Bund erhöhte die Akzeptanz und die Legitimation der Projekte. Der Wettbewerb um die finanzielle Unterstützung löste auch ausserhalb der 46 unterstützten Projekte eine Dynamik aus. Um direkte Wirkungen der Modellvorhaben im Bereich Siedlungsentwicklung nach innen zu beurteilen, ist es noch zu früh.
Für den Bund sind die Modellvorhaben gewinnbringend, da sie eine räumliche Verankerung seiner Raumentwicklungspolitik «vor Ort» bewirken. Die Modellvorhaben bieten mit ihrem kreativen und offenen Ansatz Gelegenheit, je nach Rahmenbedingungen passende Formen für die horizontale und die vertikale Zusammenarbeit zu finden. Die Erkenntnisse der Modellvorhaben dienen der Weiterentwicklung der Agglomerationspolitik und der Politik des ländlichen Raumes (besonders bei der besseren Abstimmung der Sektoralpolitiken) sowie den Überlegungen der Tripartiten Agglomerationskonferenz[5]. Sie fliessen auch in das Raumkonzept Schweiz ein, besonders im Bereich der funktionalen Räume. Themen wie die Siedlungsentwicklung nach innen und die Dorfkernerneuerung werden bei der laufenden Revision des Raumplanungsgesetzes behandelt. Die Modellvorhaben liefern hier gute Beispiele und Lösungsansätze.
Anmerkungen:
[01] Der Schlussbericht «Agglomerationspolitik des Bundes: Modellvorhaben zur Verbesserung der Zusammenarbeit in Agglomerationen, Bilanz 2002–2007» wurde veröffentlicht: www.are.admin.ch/themen/agglomeration/ 00563/index.html?lang=de
[02] Die Passage über das Modellvorhaben im Kanton Jura erschien erstmals im Rahmen eines ausführlicheren Artikels von Alain Beuret in Collage 1/10: Habiter le centre ancien: projet-pilote à Porrentruy
[03] Die Synthese der sechs Tagungen, die seit 2007 stattgefunden haben, steht auf dem Internet zu Verfügung: www.are.admin.ch/themen/ raumplanung/modellvorhaben/04079/ index.html?lang=de
[04] Die Passage zum Modellvorhaben «Bauland- Info-Pool» wurde von Gabi Kerschbaumer und Katharina Dobler, PLANAR AG für Raumentwicklung (vormals Hesse+Schwarze+Partner), verfasst
[05] Die Tripartite Agglomerationskonferenz ist die politische Plattform von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden für eine gemeinsame Agglomerationspolitik in der SchweizTEC21, Fr., 2010.07.16
16. Juli 2010 Jude Schindelholz, Melanie Butterling