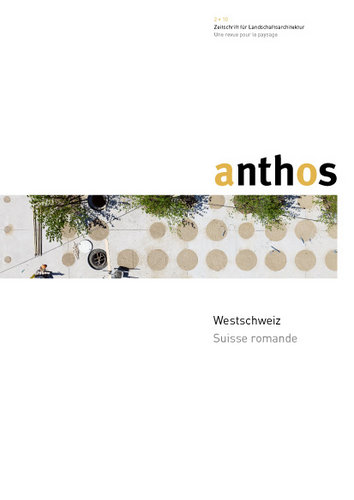Editorial
Von der Landschaftsarchitektur in der Romandie
Für die Qualität landschaftsarchitektonischer Projekte ist die Berücksichtigung des räumlichen Zusammenhanges und der örtlichen Bedingungen entscheidend, selbst wenn die Inspirationsquellen der Gestalter immer häufiger international sind. Welche Freiraumentwürfe gehören zu den «geheimen und feinfühligen Kreationen», die sich der «Formung der Welt nach einem Vorbild» verweigern, oder zur «Allerweltsproduktion», wie Laurent Wolf am 10. April 2010 in Le Temps in Bezug auf Frédéric Martels Buch «Mainstream» fragte?
Wenn Ungleichheiten zwischen dem Denken über Landschaft in der Romandie und der Deutschschweiz bestehen – poetischer
für die Erstere, wissenschaftlicher für die Letztere? – so scheinen diese Ansätze sich heute anzunähern. Führt der gegenseitige Einfluss zu einer umfassenderen Denkweise? Hier wirken die frischen Kräfte der «neuen» Landschaftsarchitekten, durch ausgedehnte Kommunikation gebildete Weltenbummler ohne Komplexe. Feine und bunte Entwürfe entstehen.
Es ist erlaubt, nicht alle von B. Crettaz im letzten der Westschweizer Landschaft gewidmeten anthos (2/1991) formulierten «Positionen für eine Debatte über die Westschweizer Landschaft » zu teilen. Aber seine Ziele sind noch aktuell. Er setzte sich ein für «die Chancen und Risiken einer Landschaft, die uns unsere Zeit erleben lässt», verlangte eine «wirklich urbane Gestaltung». Zwei der von ihm vorgeschlagenen Mittel wurden wenigsten teilweise angewandt: Heute kommen die «Städtebauer-Architekten-Landschaftsarchitekten» häufiger zum Zuge, und es entstehen hier und da «kollektive, provisorische, spontane, mobile, ungeordnete, lebendige Gestaltungen».
In der selben anthos-Ausgabe forderte E. Bonnemaison «die Suche nach einer der sprachlichen Identität entsprechenden Identität der Landschaftsarchitektur». Diese ist wohl heute für die selbstbewussten Landschaftsarchitekten der Romandie selbstverständlich. Die Metamorphose der Gesellschaft und fleissiges Schaffen haben das von unserer Profession bestehende Bild und unsere Arbeitsbedingungen verändert. Es bleibt viel zu tun, aber wir bewegen uns auf einer soliden Basis – aus bekannten Ursprüngen wachsen neue Ideen.
Zwischen Unorten oder lebensfreundlichen öffentlichen Räumen, banalen Landschaften oder bemerkenswerten Projekten erwarten neue Herausforderungen die Landschaftsarchitektur: Kontextualisierung, Diskussionen über den öffentlichen Raum, urbane Gärten, evolutive Bepflanzungskonzepte, wiederentdecktes Wissen über die Begrenztheit der Ressourcen…
Um solche Herausforderungen besser annehmen zu können, möchte anthos den Spass am Entdecken fördern. Zum umfriedeten Garten gehört der offene Blick.
Stéphanie Perrochet