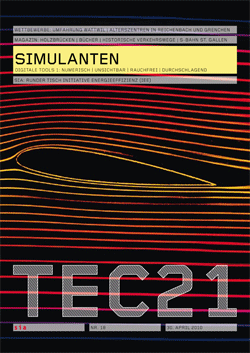Editorial
Dieses Heft eröffnet den Themenbereich «Digitale Tools» mit dem Ziel, Entwicklung und Anwendung von Software im Bauwesen zu beleuchten. Der Fokus in dieser Ausgabe richtet sich gezielt auf die Möglichkeiten der Finite-Elemente-Methode FEM gepaart mit den Rechenleistungen der heutigen Prozessoren. Die Ursprünge der FEM reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück – Einsteins Kommilitone Walter Ritz hat entscheidende Grundlagen geliefert –, und die ersten mathematischen Modelle wurden vor rund 50 Jahren entwickelt. Die folgende kommerzielle Anwendung ging stark mit der Steigerung der Computerleistung und der Entwicklung von benutzerfreundlichen Oberflächen einher. Heute ist FEM-Software komfortabel einsetzbar: Kenntnisse von Programmiersprachen sind nicht zwingend erforderlich, das Erstellen der Modelle erfolgt visuell über CAD-Modellierer, das Generieren von Netzen (Meshing) geht vollautomatisch vonstatten, nur hier und da ein paar Eingriffe, um Art und Grösse der Elemente zu optimieren, die Randbedingungen werden grafisch am Modell angebracht, der Rechenvorgang geht verhältnismässig schnell und unbeobachtet vonstatten, die Ausgaben präsentieren sich optisch ansprechend im Falschfarbenlook. Simulanten sind die Anwender solcher Werkzeuge. Sie entscheiden per Mausklick und Tastendruck, mit welchen Modellen und Parametern die Realität am besten nachzubilden ist, und beurteilen die Resultate auf ihre Plausibilität hin. Vorbei die Zeiten, wo Ingenieure mit Papier, Bleistift und Rechenschieber ihre Entwürfe und Berechnungen am Reissbrett machten, wo Transparentpapier und Klebefolie, Tuschfüller und Rasierklingen noch zum Standardwerkzeug gehörten. Taschenrechner – allen voran der HP-11C und der legendäre HP-41C – übernahmen ab 1970 die Rechenaufgaben im Ingenieurbüro. Später konnten auf den ersten bezahlbaren Personalcomputern einfache Routinen mit der damals beliebten Programmiersprache Basic erstellt werden. Verschiedene Compiler übersetzten dann die Strings in Formate, welche von den Betriebssystemen ausgeführt wurden. Wer diese rasante Entwicklung mit 8086er Prozessoren, 10-MB-Festplatten, 5¼» -Floppy-Disks und der endlosen Suche nach Treibern für den 9-Nadeldrucker nicht erlebt hat, verpasste eigentlich nichts. Doch ein Blick zurück würde manchem von uns gut anstehen. Wie oft verliert man sich heute am Bildschirm in Details und Nachkommastellen und vergisst dabei den Blick aufs Wesentliche, aufs Ganze. Die Wahl, mit welchem Tragsystem, mit welcher Gebäudetechnik, mit welcher Linienführung der Ingenieur ein gutes Konzept erstellt, ist nach wie vor die entscheidende Aufgabe im Planungsprozess. Kein Rechenschieber und keine Software übernimmt diese kreative Arbeit und schon gar nicht die Verantwortung für das fertig gebaute Produkt.
Markus Schmid
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Umfahrung Wattwil | Altersheim Reichenbach | Alterszentrum Sunnepark Grenchen
12 MAGAZIN
Holzbrücken im Fokus | Bücher | Historische Verkehrswege geschützt | S-Bahn St. Gallen | Baubeginn in Neu-Andermatt | Leserbrief | Kurzmel-dungen
22 NUMERISCHE SIMULATIONEN
Philipp Huber
Numerische Simulationen werden in Wissenschaft und Industrie gewinnbringend eingesetzt. Auch im Bausektor ist eine Zunah-me dieser Technik von Nutzen.
25 UNSICHTBARE STRÖMUNGEN
Stefan Barp
Das Optimieren von Lüftungskonzepten und Gebäudetechnik mit Strömungssimulationen kann Kosten sparen.
29 RAUCHFREIE ZONE
Severin Wälchli, Rehan Yousaf, Eugenio Galli
U-Bahn-Stationen bergen im Brandfall ein hohes Sicherheitsrisiko. Die Rauchabsaugung muss deshalb optimal funktionieren.
32 DURCHSCHLAGEND STARK
Josef Kurath, Christoph Sturzenegger, Peter Henckel
Dünnwandige Bauteile bergen ein grosses Tragpotential. Oftmals erst nach dem Ü-berschreiten der Stabilitätsgrenze.
39 SIA
Runder Tisch Initiative Energieeffizienz (IEE)
44 FIRMEN
45 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Numerische Simulationen
In der Industrie hat die Simulation bereits bewiesen, dass sie wirtschaftlich sinnvoll ist, die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunftsaussichten eines Unternehmens verbessert und einen wesentlichen Beitrag zu Qualität, Sicherheit und Komfort liefern kann. In der Wissenschaft hat sich die Simulation als dritte Säule neben Theorie und Experiment etabliert. Sie wird als Schlüsseltechnologie für die Zukunft betrachtet und kann damit auch für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz von zentraler Bedeutung sein.
Mit der rasanten Entwicklung der numerischen Simulation in den letzten Jahren ergeben sich für das Bauwesen interessante neue Möglichkeiten für Berechnungen und Analysen. Unter numerischer Simulation versteht man Computeranalysen, die mittels numerischer Methoden durchgeführt werden. FEM für Finite-Elemente-Methode (Anwendung siehe Fachartikel «Durchschlagend stark») und CFD für Computational Fluid Dynamics (Anwendung siehe Fachartikel «Unsichtbare Strömungen» und «Rauchfreie Zone») sind die wesentlichen Begriffe in diesem Fachbereich. Bekannte Beispiele sind statische und dynamische Berechnungen (Strukturmechanik), Wetter- und Klimaprognosen, thermisches Verhalten von Gebäuden oder Untersuchungen der Luftzirkulation in Gebäuden (Strömungssimulation). Eine zusammenhängende Struktur (Kontinuum) wird dabei in viele kleine (finite) Elemente aufgeteilt bzw. diskretisiert (TEC21 17-18/2008 «Diskrete Elemente»). Auf der Basis der Grundgleichungen der Physik entstehen so Gleichungssysteme, die mittels geeigneter Lösungsverfahren (Gauss-Elimination, iterative Verfahren) gelöst werden. Für die Golden Gate Bridge mussten im Jahre 1937 ganze 37 Gleichungen von Hand gelöst werden, was drei Monate dauerte. Leistungsstarke, kommerzielle Cluster (Verbund von Computern), wie sie heute in der Praxis verwendet werden, sind in der Lage, eine Strömungssimulation mit gegen 100 Millionen Unbekannten in wenigen Tagen zu lösen.
Die Entwicklung der numerischen Simulation
In der Schweiz begann das Zeitalter der Computersimulation 1950 an der ETH Zürich mit dem Z4 (siehe Kasten), dem ersten universellen Computer der Welt. Er ermöglichte die statische Berechnung der Grande-Dixence-Staumauer innert nützlicher Frist. Gerade die numerische Simulation hat ihren Ursprung im Bauwesen, weil das lange Zeit gängige Verfahren in der Industrie, die Herstellung von Prototypen und Tests, für grosse Strukturen nicht anwendbar war. In den letzten Jahrzehnten setzte sich die Simulation immer mehr auch in der Industrie durch, weil der steigende Wettbewerbsdruck hohe Qualität, wirtschaftliche Produkte und kurze Entwicklungszeiten fordert. Diese Tatsache verlieh der Simulation einen gewaltigen Entwicklungsschub. Treibende Kräfte waren und sind die Autoindustrie (Crashsimulation) und der Flugzeugbau (Leichtbau, Strömungssimulation). So können heute in der Strukturmechanik hochdynamische Vorgänge, grosse Deformationen, nicht lineare Materialeigenschaften oder nicht lineare Kontakte zwischen Bauteilen mit Reibung zuverlässig und schnell berechnet werden. In der Folge hat sich die numerische Simulation auch in der Medizinaltechnik, z. B. zur Berechnung von Implantaten, in der Biologie bei der Berechnung von mechanischen Kräften zwischen Zellen oder in der Uhrenindustrie etabliert. Die strukturmechanische Analyse kann auch mit einer Strömungssimulation bidirektional gekoppelt werden. Dies erlaubt beispielsweise die Berechnung eines pulsierenden Herzens dank Fluid-Structure-Interaction (FSI).
Was bringt die zukunft?
Die Entwicklung der numerischen Simulation ist nicht annähernd abgeschlossen und wird neue Analysemöglichkeiten hervorbringen. Aktuell sind Softwareingenieure der Entwicklungsabteilungen mit folgenden Themen beschäftigt:
– Multiphysik: Alle Bereiche der Physik (Strukturmechanik, Strömung, thermische Analysen, Elektromagnetik) werden in Zukunft mit ihrer gegenseitigen Beeinflussung (Kopplung) simulierbar sein. Mit der heutigen Technik bereits möglich ist die Berechnung der Schallabstrahlung eines Elektromotors mit folgenden Rechenschritten: Mit einer Transiente-Elektromagnetik- Simulation wird zuerst das Magnetfeld in der drehenden Maschine berechnet.
Mit den resultierenden dynamischen Kräften erhält man dann die Schwingungen der schallabstrahlenden Gehäuseteile. Daraus wird über eine weitere Rechenkopplung der Schallpegel um den Elektromotor berechnet. In naher Zukunft wird diese Technik für alle Kopplungsrichtungen und für grosse, realitätsnahe Modelle bereitstehen.
– Optimierung, Sensitivitätsanalysen, Robust Design: Vielfach werden Worst-Case-Szenarien analysiert, um die Tragsicherheit der Struktur nachzuweisen. Die Eingangsparameter werden auf der «sicheren» Seite angenommen. Doch wie sicher ist so ein Nachweis wirklich, und wie wirtschaftlich ist solches Design? Hier gehen die Meinungen weit auseinander. Oft gibt es gar keine sichere Seite wie zum Beispiel in der Dynamik, das Modell ist nicht linear, oder Materialparameter sind teilweise unbekannt. In solchen Fällen helfen nur die Variation von Parametern in sinnvollen Grenzen und die klare Definition von Zielgrössen, die optimiert werden sollen. Moderne Softwaretools mit effizienten Optimierungsalgorithmen werden diese Aufgaben vermehrt übernehmen. Dank bidirektionalen Schnittstellen zwischen CAD- und FEM-Tool können Geometrien variiert werden (z. B. Toleranzen). Materialparameter sind in ihrer Streubreite variierbar; so ist nach den notwendigen Rechendurchgängen ersichtlich, welche Parameter entscheidenden Einfluss auf die Zielgrössen haben. Auf diese Art wird das Verhalten eines komplexen Modells verständlich, und die Struktur kann gezielt verbessert werden.
– Engineering-Knowledge-Management: Ein wesentlicher Vorteil von modernen Simulationstools ist, dass ganze Arbeitsabläufe gespeichert und immer wieder angewendet und verbessert werden können. Der Prozess für die Simulation kann somit klar definiert werden.
Dadurch ist das Wissen nicht nur in den einzelnen Köpfen, sondern für alle Ingenieure verfügbar und bleibt der Firma dauerhaft erhalten.
– High Performance Computing (HPC): Die Basis für die Entwicklung der Simulation war und ist die Steigerung der Rechenleistung. Aktuell werden die Computer etwa alle zehn Jahre 1000-fach leistungsfähiger. Für HPC wird die Methode des Massiv-parallel-Rechnens verwendet und kontinuierlich gesteigert. Der Hochleistungsrechner am CSCS (Swiss National Supercomputing Centre) in Manno rechnet mit 15 000 Prozessoren, wobei ein entscheidender Baustein das Kommunikationsnetzwerk zwischen den parallelen Rechenelementen ist. Allerdings stösst die derzeitige Chiptechnologie an ihre Grenzen: Die Taktfrequenz ist kaum mehr zu steigern, die Chips werden zu heiss, die Kühlung verbraucht entsprechend viel Strom. Zukünftige Workstations und Cluster müssen in Zukunft also auch energieeffizienter werden.
– IT-Infrastruktur: Was bedeutet die HPC-Entwicklung für die Infrastruktur eines zukünftigen Simulations-Arbeitsplatzes? In zwei bis vier Jahren wird jeder Anwender (Simulant) 32 bis 64 Prozessorkerne standardmässig an seinem Arbeitsplatz zur Verfügung haben. Allerdings macht es keinen Sinn, jedem Ingenieur lokal die maximale Rechenkapazität zur Verfügung zu stellen, die er nur sporadisch benötigt. Sinnvoll ist, eine hohe Rechenleistung «on demand» zentral für ein Team zur Verfügung zu stellen, um Leistungsspitzen auszugleichen. Remote Graphics Software (RGS) in Kombination mit Blade-Workstations ist eine geeignete Technologie, um zentral zu rechnen und die Rechnerkapazität dezentral verfügbar zu machen. Ein weiterer Nutzen ist die hohe Datensicherheit aufgrund einer einheitlichen, zentralen IT-Umgebung.
Numerische Simulationen im Bauwesen
All diese Entwicklungen ergeben auch im Bauwesen vielfältige Perspektiven für Simulationen.
Schon heute beschränken sich die Anwendungen nicht mehr nur auf lineare Statik, denn Strukturen und Aufgabenstellungen werden immer komplexer; zu deren Analyse bieten sich numerische Simulationen an. Die stetig steigenden Anforderungen der Gesellschaft an Sicherheit (Erdbeben, Brand), Komfort (Lärm, Raumklima) und Energieeffizienz (Wärmeisolation, alternative Energien) werden diesen Trend weiter antreiben. Beispiele für Analysemöglichkeiten im Bauwesen, die mit leistungsfähigen Simulationstools heute möglich sind:
– Transiente Dynamik, z. B. Erdbebenanregung einer dreidimensionalen Struktur im Zeitbereich, mit nicht linearen Materialgesetzen, um die Tragreserven effizient zu nutzen
– Explizite Dynamik, z. B. Stützenanprall, Steinschlag, Explosion, progressiver Kollaps eines Hochhauses
– Fluid-Structure-Interaction, z. B. Winddruck und dynamische Anregung eines Hochhauses oder Stadions durch periodische Wirbelablösungen, dynamische Eigenschaften von wassergefüllten Behältern
– Structure-Fluid-Interaction, z. B. Schallabstrahlung von Eisenbahnrädern oder schwingenden Decken und Wänden für die Berechnung der Schallpegelverteilung im Raum
– Strömungssimulation, Luftzirkulation und Temperaturverteilung im und um das Gebäude, Partikelkonzentration in Reinräumen
– Thermische Analysen von Fassaden, Berechnung von Wärmeübergangskoeffizienten mittels Strömungssimulation
– Brandsimulationen, Entrauchungssimulation, Ausbreitung von Rauch und toxischen Gasen Analytische Lösungen oder Erfahrungswerte verkommen aber keineswegs zu veralteten Methoden. Sie müssen weiterhin zur Konzeptfindung und für Grobabschätzungen herangezogen werden, denn keine Software erstellt ein gutes Konzept.
Pflichtfach Physik
Die Simulationstools von morgen werden den Simulanten durch Automatismen beim Modellaufbau und bei der Vernetzung (preprocessing) deutlich entlasten. Die Resultate werden schneller verfügbar sein, damit bleibt dem Ingenieur mehr Zeit für Aus- und Bewertung der Resultate (postprocessing) sowie für zusätzliche Rechenläufe mit veränderten Parametern, um das Verständnis seines Modells zu verbessern. Die Arbeitszeit wird in Zukunft also effizienter genutzt, wenn der Ausbildungsstand der User mit der Entwicklung von Soft- und Hardware Schritt hält. Die heutigen Programme von Anbietern wie ANSYS oder MSC-Software sind so mächtig, dass sie nicht ohne entsprechendes Wissen und Erfahrung sinnvoll genutzt werden können. Ein breites und tiefes Verständnis für die Physik und die Simulationsmethoden ist Bestandteil der erfolgreichen Anwendung in der Praxis. Um die Möglichkeiten sinnvoll zu nutzen, müssen die angehenden Ingenieure an den Hochschulen noch mehr in Richtung Simulation ausgebildet werden. Simulation ermöglicht Innovation, und echte Innovation ist der einzige Weg, den die Schweiz gehen kann, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.TEC21, Fr., 2010.04.30
30. April 2010 Philipp Huber
Unsichtbare Strömungen
Ist im raumhoch verglasten Eckbüro eine Kühlung notwendig, und wie gross ist der Effekt der Nachtauskühlung? Wird sich der Geruch aus der Cafeteria im ganzen Atrium verteilen? Sind mit dem geplanten Lüftungssystem Klagen bezüglich Zugluft zu erwarten? Solche und viele weitere Fragen lassen sich bei komplexen Gebäuden nicht mithilfe von Normen oder Richtlinien beantworten. Sie erfordern individuelle bauklimatische Konzepte, optimiert mit geeigneten Simulationstechniken.
Für viele bauphysikalische Vorgänge an Gebäuden, wie z. B. die Bestimmung von Wärmeverlusten, gibt es einfache Formeln. Komplexe bauklimatische Probleme und Fragestellungen, bei welchen verschiedene physikalische Effekte wie Strömung, Wärmeleitung, Wärmespeicherung, Infrarot- und Solarstrahlung gekoppelt sind, lassen sich aber nur mittels geeigneter Simulationsmethoden zuverlässig untersuchen. Damit ist «echt» integrale Planung möglich, weil alle entscheidenden Faktoren berücksichtigt werden können. Die Simulation liefert nicht die Lösung, sondern ist ein Hilfsmittel zur Untersuchung und Optimierung möglicher Konzepte.
Der sinnvolle Konzeptentwurf ist Aufgabe des Fachplaners. Erfahrungen von bereits geplanten und gebauten Lösungen sind dabei wesentliche Voraussetzung, um sich nicht mit «falschen» Konzepten in einer Sackgasse zu verlieren.
Simulationsmethoden
Die heute wichtigsten Simulationsmethoden zur Lösung bauklimatischer Aufgabenstellungen sind die thermische Gebäudesimulation und die numerische Strömungssimulation (Computational Fluid Dynamics CFD). Bei der thermischen Gebäudesimulation wird ein Gebäude in eine oder mehrere Zonen pro Raum unterteilt, und für jede Zone werden die über ein Jahr resultierenden Temperaturen (Zonenmittelwerte) in Stundenschritten berechnet. Es werden alle für Gebäude und Fassadensysteme wesentlichen thermischen und dynamischen Vorgänge mit Parametern wie externen Lasten, Wetterdaten, Lüftung, Kühlung, Luftaustausch zwischen Zonen, internen Lasten, Speicherung in Bauteilen usw. berücksichtigt. Als Resultate können Temperaturverläufe, maximale und minimale Werte, Statistiken, erforderliche Heiz- und Kühllasten und Energie- und Massenströme ausgewertet werden.
Bei der numerischen Strömungssimulation mit CFD werden Geschwindigkeiten und Temperaturen in jedem Punkt berechnet. Im Vergleich zur thermischen Gebäudesimulation wird in der Regel die Strömung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über einen kurzen Zeitraum von maximal einer Stunde simuliert. Zusätzlich können auch Parameter wie Zigarettenrauch, CO2, Küchengeruch usw. mitgerechnet werden, um deren Ausbreitung resp. Massnahmen gegen die Ausbreitung zu untersuchen, oder auch Feuchte, um das lokale Kondensationsrisiko zu bestimmen. Die beiden Methoden unterscheiden sich also vor allem im Zeitfenster, in welchem die Vorgänge ablaufen resp. berechnet werden. Die thermische Gebäudesimulation kann ein ganzes Kalenderjahr abbilden und ist dementsprechend geeignet, um Material, Verglasung, Heiz- und Kühlenergiebedarf, Verlauf von Raumtemperaturen, Oberflächentemperaturen, Sonnenschutzanlagen, Wärmespeicherung und Nachtauskühlung zu bestimmen. Demgegenüber werden mit der numerischen Strömungssimulation kurzfristige Vorgänge berechnet, wie z. B. lokales Zugluftrisiko bei Lüftungsanlagen, raumhohen Verglasungen usw.
Am Anfang steht das Konzept
In jedem Bauprojekt sind kostspielige Umplanungen resp. nur mit Technik korrigierbare Fehlplanungen zu vermeiden. Dabei ist es zwingend, zu Beginn ein funktionierendes bauklimatisches Konzept zu entwerfen. Dieses kann gegebenenfalls mittels in dieser Phase noch günstiger Simulationen verifiziert werden. Dadurch sind bauklimatische Lösungen möglich, die optimal mit dem gewünschten Design übereinstimmen und ein Minimum an zusätzlicher Technik und Regelung erfordern. Um die Kosten der Simulationen selbst zu minimieren und dennoch plausible Aussagen zu erhalten, ist jahrelange Erfahrung und tägliche Anwendung der Tools erforderlich. Dies braucht der Ingenieur, um auf folgende Aufgabenstellungen richtig reagieren zu können:
– Wahl der geeigneten Simulationsmethode, weil sich je nach Objekt und Fragestellung andere Methoden und Tools eignen, um mit geringstem Aufwand die notwendigen Resultate in genügender Genauigkeit zu erhalten.
– Festlegung, welche Details wie stark vereinfacht werden können, damit das Modell die erforderlichen Aussagen korrekt und dennoch mit minimalen Kosten liefert.
– Festlegen der thermischen Randbedingungen durch fundiertes Wissen zur Simulationstechnik und Numerik wie auch zur Bauphysik.
– Kontrolle der Resultate und Korrektur von Fehlern, d. h., die Resultate sind auf Plausibilität, numerische Korrektheit (Konvergenz, diverse Parameter usw.) zu prüfen.
– Festlegung der geeigneten Art der Auswertung (Wo wird was wie dargestellt?), damit alle relevanten Effekte erkannt werden. Dies erfordert insbesondere bei CFD-Simulationen von komplizierten Geometrien grosse Erfahrung, denn bei der riesigen Menge an berechneten Daten ist nicht immer ersichtlich, wo die kritischen Bereiche liegen. Der Ingenieur muss diese suchen.
Simulation spart Baukosten
Mit Komfortlüftungen ausgestattete Wohnungen mit kombinierter Koch-/Wohnzone (offene Wohnküchen) benötigen im Bereich der Küche zwingend einen Abluftdurchlass (Abb. 3). Dazu wird im Wohnbereich häufig ein separater Zuluftdurchlass geplant, was insbesondere bei Sanierungen einen grossen Aufwand verursachen kann. Auf diesen Zuluftdurchlass kann verzichtet werden, wie eine von AFC Air Flow Consulting im Auftrag des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft AWEL und des Amts für Hochbauten der Stadt Zürich durchgeführte Studie[1] zeigt. Es gibt keine kritische «Anhäufung» von CO2 im Fassadenbereich des Wohnzimmers bei normaler Belegung mit zwei Personen im Wohnbereich. Diese CFDAnalyse bewirkt weniger bauliche Massnahmen und spart Baukosten.
Simulation optimiert Gebäudetechnik
Bei Atrien und Hallen mit Glasdächern bestehen oft Fragen nach der Verhinderung von Überhitzung im Aufenthaltsbereich, nach der geeigneten Kombination von mechanischer und natürlicher Lüftung und nach der Auswirkung von Kaltluftabfall im Winter.
In einem geeigneten bauklimatischen Konzept sind folgende Grössen zu bestimmen:
– Glas, Sonnenschutz (physikalische Eigenschaften resp. konkretes Produkt) und Rahmen
– Grösse und Anordnung von Dachklappen und Nachströmöffnungen für natürliche Lüftung und Nachtauskühlung
– erforderliche zusätzliche Kühlleistung
– Luftvolumenstrom, Zulufttemperatur, Position Zu- und Abluft der mechanischen Lüftung Die Wahl der Position für die Abluft der mechanischen Lüftung ist dabei entscheidend. Dazu wurden im Beispiel (Abb. 5 und 6) CFD-Simulationen mit drei möglichen Anordnungen durchgeführt. Der deutliche Unterschied zwischen den verschiedenen Resultaten zeigt, dass es sich lohnt, die aufwendigere, dafür viel bessere Variante mit Abluft im Dach zu verfolgen. Würde dieser Entscheid erst in einer späten Planungs- oder in der Bauphase gefällt, wären damit hohe Kosten verbunden. Dieses Gesamtkonzept, d. h. die Kombination der oben genannten Parameter, ist mittels thermischer Gebäudesimulation in Kombination mit zonaler Strömungssimulation optimiert.
Simulation bleibt ein Werkzeug
Das Überprüfen und Optimieren mit Simulationen hinsichtlich hohen thermischen Komforts und tiefer Energie- und Betriebskosten führt zu bauklimatischen Lösungen, welche optimal mit dem gewünschten Design übereinstimmen und ein Minimum an zusätzlicher Technik und Regelung erfordern. Dennoch bleibt die Simulation ein Werkzeug, das so gut arbeitet, wie die Hand es führt. Erfahrung und Know-how von Ingenieuren und Fachplanern bleiben demnach unabdingbare Voraussetzungen für den Entwurf geeigneter Konzepte.
Anmerkung:
[01] Luftaustausch (Broschüre), Luftaustausch (Synthesebericht) Download: www.stadt-zuerich.ch/nachhaltiges-bauen > 2000-Watt-Gesellschaft > TechnikTEC21, Fr., 2010.04.30
30. April 2010 Stefan Barp