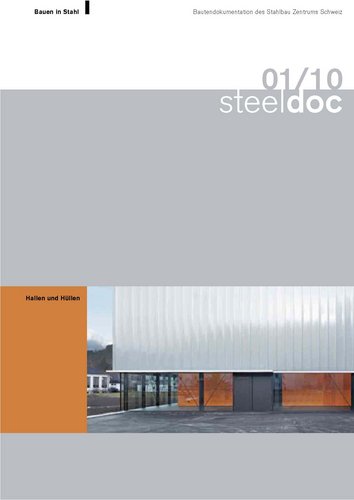Editorial
Eine Halle ist in erster Linie eine Hülle. Was darin geschieht, muss sich zwangsläufig ändern können. In einer Zeit, wo sich ein Unternehmen ständig an die Märkte anpassen muss, ist die Flexibilität der Nutzung oberstes Gebot für die Wirtschaftlichkeit der Bauinvestition. Sogar eine Sporthalle dient heute nicht nur der körperlichen Ertüchtigung, sondern auch als Fest- und Konzertsaal, als Versammlungsort oder einfach als Schutzhülle für alle Fälle.
Für die Vorteile der Stahlbauweise ist deshalb der Hallenbau das Parade beispiel: leicht, flexibel, beliebig veränderbar und erweiterbar. Ins besondere in Bezug auf die Nachhaltigkeit ist der Hallenbau in Stahl praktisch unschlagbar. Im vorliegenden Heft werden insgesamt vier Hallenbauten in Stahl vorgestellt – alle erfüllen entweder den Minergie- oder einen gleichwertigen Standard. Die Nachhaltigkeit geht aber noch wesentlich weiter. Ziel des nachhaltigen Bauens ist die Minimierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs während der gesamten Lebensdauer des Bauwerks sowie beim allfälligen Rückbau. Geht man die Grundsätze des nachhaltigen Bauens durch, kann man für den Stahlbau bei jedem Punkt ein Häkchen setzen.
Der Hallenbau verdeutlicht insbesondere die Flexibilität der Nutzung. Es werden deshalb meistens Struktur-Typen gewählt, die sich additiv oder modular erweitern lassen, was letztlich auch die Langlebigkeit des Gebäudes ausmacht. Die Wahl der Tragstruktur hat direkte Auswirkungen auf die Raumdimension, die Leitungsführung für technische Installationen und die langfristige Nutzbarkeit der Räume.
Nebst einer Reihe von ausgezeichneten und bemerkenswerten Hallen stellen wir in diesem Heft erstmals einen Hintergrundartikel vor, der die häufigsten Arten von Hallentragwerken erläutert sowie deren Besonderheiten und Vorteile. Der Beitrag soll Hilfestellung bei der Planung und Realisierung von kostengünstigen und optimierten Hallenbauten bieten und einige technische Hinweise vermitteln. Weiter führende Literatur dazu vertreibt der technische Verlag des Stahlbau Zentrums Schweiz.
Wie immer geht die Dokumentation bis ins Detail, so dass sie praktische Anregung gibt. Wir wünschen viel Vergnügen beim Studium der folgenden Seiten von steeldoc.
Inhalt
03 Editorial
04 Sporthalle Gotthelf, Thun
Heitere Leichtigkeit
10 Ausstellungszentrum Gétaz Romang, Etoy
Monolith mit Durchblick
16 Dornier Museum, Friedrichshafen
Pioniergeist zum Anfassen
22 Sporthalle Esplanade, Biel
Eine Hülle für Körper und Geist
26 Hintergrund
Hallen aus Stahl
31 Impressum
Heitere Leichtigkeit
(SUBTITLE) Sporthalle Gotthelf, Thun
Tagsüber grau schimmernd, nachts ein leuchtender Dachkörper präsentiert sich die Dreifachturnhalle als schwebend leichtes Grossvolumen. Über einem gedrungenen, vollständig verglasten Erdgeschoss erhebt sich eine fast textil anmutende Haube aus Stahl und lichtdurchlässigem Kunststoff.
Inmitten der Schulanlage, die seit den 1950er Jahren immer wieder erweitert wurde, schafft die Sporthalle durch ihre Lage sowie das äussere Erschliessungssystem einen neuen Aussenraum und entwickelt das vorgefundene Thema der Zwischenräume weiter. Drei Kuben aus Beton – die Zugänge zu den Garderoben der Sportler – gliedern den Raum zum benachbarten Schulhaus und weisen dem Haupteingang der Zuschauer einen eigenen Vorbereich zu.
Gleichzeitig wird durch die drei aussen liegenden Garderobenabgänge die separate Zugänglichkeit der zwei unterschiedlich genutzten Ebenen erreicht. Die Zuschauer betreten die Halle über ein grosszügiges Foyer mit den zugehörigen Nebennutzungen. Gegenüber liegt der Tribünenbereich, der über seitliche Durchgänge mit Stehplätzen erschlossen wird. Die eigentliche Sporthalle mit Garderoben, Geräte- und Technikräumen ist um ein Geschoss abgesenkt.
Licht und Farbe
Die horizontale Schichtung der Funktionen setzt sich in der Konstruktion des Baukörpers fort. Die Bodenplatte und das Untergeschoss sind in Beton ausgeführt. Schwarz eingefärbte, grossformatig geschalte Sichtbetonflächen prägen das Untergeschoss. Die Vertiefung der Halle und die Einbauten im Erdgeschoss sind mit farbig gebeiztem Sperrholz verkleidet, welches gleichzeitig die erforderlichen Akustikmassnahmen wahrnimmt. Über das massive Bodenrelief stülpt sich oberirdisch die dunkel beschichtete Stahlkonstruktion. Getragen von schlanken Fassadenstützen spannt sie über die 50 x 40 Meter grosse Grundrissfläche des Gebäudes. Die Fassade selbst besteht aus lichtdurchlässigen, 40 Millimeter starken Platten aus Polycarbonat.
Diese sechsschaligen Lichtbauelemente zeichnen sich durch hohe Schlagzähigkeit und Alterungsbeständigkeit aus. Lichtbrechende Pigmente sorgen für optimales diffuses Licht. Ein umlaufendes Glasband im Erdgeschoss wirkt wie eine Fuge zwischen dem schweren Beton und der leichten Stahlkonstruktion mit seiner transluzenten Fassade.
Sporthalle im Minergie-Standard
Das Gebäude verfügt über ein nachhaltiges Energiekonzept. So sorgen Solarkollektoren auf dem Flachdach für die Erwärmung des Brauchwassers und der Fussbodenheizung. Die Sporthalle wird über Quellauslässe beheizt und belüftet, eine natürliche Nachtauskühlung erfolgt über Rauch- und Wärmeabzugsöffnungen im Dach und Zuluftklappen in der Fassade.
Schlichte Eleganz
Etwa 1,50 Meter hohe Doppel-T-Träger, welche die Halle in Querrichtung überspannen, bilden die Haupttragkonstruktion des Daches. Über und unter diesen im Abstand von 4,65 Metern angeordneten Hauptträgern verlaufen Pfetten. Die obere Pfettenlage trägt das Dach aus gelochtem Profilblech und extensiver Begrünung, an der unteren sind die Turngeräte und technische Installationen befestigt. Zusätzlich stabilisieren diese als Sekundärträger die hohen, schlanken Hauptträger. Die Horizontalaussteifung der Halle erfolgt über Verbände in der Dachebene und dünne, diagonale Zugstangen, die umlaufend zwischen den Fassadenstützen angeordnet sind. Mit Ausnahme der geschweissten Hauptträger besteht die gesamte Stahlkonstruktion aus Normprofilen und konnte ohne komplizierte Knoten oder Anschlussdetails mittels Schraubverbindungen vor Ort montiert wurden. Obwohl die Tragstruktur mit ihren hohen Hauptträgern eindeutig gerichtet ist, wirkt sie durch die darunter verlaufenden Pfetten ungerichtet und verleiht dem Bau eine ruhige, elegante Anmutung. Die für eine Sporthalle ungewöhnlich hohe Qualität der Architektur und die saubere, präzise Detaillierung wurde mit einer Anerkennung des Prix Acier 2009 gewürdigt.Steeldoc, Mo., 2010.04.26
26. April 2010 Martina Helzel
Monolith mit Durchblick
(SUBTITLE) Ausstellungszentrum Gétaz Romang, Etoy
Mitten im Industriegebiet von Etoy hat die auf den Vertrieb von Baumaterialien spezialisierte Gruppe Gétaz Romang ihr neues Ausstellungszentrum eröffnet. Der an den Frontseiten dynamisch abgeschrägte Baukörper in leuchtendem Orange umschliesst einen Innenhof mit erstaunlich viel Ambiente und Helligkeit.
Als Standort für sein Ausstellungszentrum hat das Unternehmen Gétaz die strategische Position zwischen der Autobahn A1 und der Bahnlinie Genf–Lausanne gewählt: hier ist es schon von weitem sichtbar. Wie eine riesige Vitrine lädt es zur Präsentation von Materialien in einem realen und ansprechenden Kontext ein. Der von Norden nach Süden ausgerichtete Monolith ist teils auf einem Fundament, teils auf Pfeilern gelagert und scheint über dem sich sanft zum See hin neigenden Terrain zu schweben. Das äussere Volumen des Gebäudes wird definiert durch zwei komplett geschlossene, orangefarbene Fassaden an den Seiten und zwei stark geneigte, vollverglaste Frontseiten.
Innen ist aussen
Das Gebäude wird von der Südseite her über das Untergeschoss erschlossen. Vom teilweise ins Erdreich abgesenkten Parkhaus unterhalb des Gebäudes gelangt der Besucher über einen Verbindungstunnel in die darüberliegende Ausstellung. Diese besteht aus einem einzigen introvertierten Raum, der um ein grosszügiges Atrium in der Mitte angeordnet ist. Gegenüber dem Eingang steht ein geometrisch und farblich an die Halle angepasster Tresen im Empfangsbereich, an den eine Cafeteria und die Verkaufsbüros angrenzen. An den beiden verglasten Enden der Halle wurde je eine Zwischenebene eingezogen. Auf der Südseite beherbergt diese eine grosse funktionelle Küche für Kochshows sowie einige Büros, auf der Nordseite ist sie für Veranstaltungen reserviert. Die Hauptbereiche der Ausstellung sind mit 30 mobilen Modulen bestückt. Diese Module, die nach dem Prinzip «Haus im Haus» konzipiert sind, wurden aus einer auf Rollen gelagerten Aluminiumstruktur gefertigt. Dank dieses modularen Charakters lassen sie sich einfach an alle Erfordernisse für Küchen- und Badausstattungen anpassen. Das von allen Seiten zugängliche Atrium ist von einer Glasfassade eingerahmt, die teilweise mit Sonnenschutzlamellen versehen ist. Dieser grüne Innen-/Aussenraum wird für die Präsentation von Baumaterialien zur Gestaltung von Anlagen im Freien genutzt.
Stahlrohrstruktur
Der Oberbau der Halle ruht auf dem Betonfundament des Erdgeschosses. Das in weiss gehaltene Stahltragwerk wurde bewusst sichtbar belassen. Es besteht aus 30 aneinandergereihten Portalrahmen aus Stahlrohren, die rechtwinklig zum zentralen Innenhof angeordnet sind. Als Zwischenebenen wurden Verbunddecken aus Trapezblech und Beton eingezogen, die auf Stahlfachwerkbindern aufgelagert sind. Um einen effizienten Brandschutz zu gewährleisten, wurde dieser Teil des Tragwerks mit einer feuerhemmenden Beschichtung versehen.
Die Rahmen spannen über 15,90 oder 19,20 Meter. Sie sind in einem Abstand von 5,30 Metern angeordnet und wurden aus drei vorgefertigten Elementen, die vor Ort mit Schraubflanschen verbunden wurden, erstellt. An jeder Ecke des Gebäudes sind vier Träger um einen diagonal aufliegenden Portalrahmen angeordnet.
Die Stützenfüsse sind biegesteif mit dem Fundament verbunden. Diagonalen über Kreuz steifen das Tragwerk im Dachbereich entlang der geschlossenen Fassden aus. Die Aussteifung in Längsrichtung erfolgt über zwei paarweise angeordnete Diagonalenkreuze.
Das Dach ist aus perforierten Trapezblechen zusammengesetzt, die auf den Portalrahmen aufliegen. In die Sicken der Bleche eingelegte Isolationsstreifen sorgen für die Verbesserung der akustischen Eigenschaften. Der weitere Dachaufbau besteht aus einer Dampfsperre, zwei Schichten Mineralwolle und einer Dichtbahn aus verschweisstem PVC. Die Hülle der Ost- und Westfassade wurde aus Stahlblechprofilen, einer thermischen Isolierung, der Dampfsperre und einer Konterlattung für die Luftzirkulation aufgebaut. Gegen aussen ist das Gebäude mit modularen Clip-On-Platten aus orangefarbenen Eternit verkleidet.
Energie und Komfort
Die neue Halle erhielt das Minergie-Label, da bereits beim Bau auf grösstmögliche Schonung der Umwelt geachtet wurde. So wurde der Aushub auf das Minimum begrenzt und der Abraum in die Aussenanlage integriert. Um die thermische Isolierung des Fundaments des Obergeschosses zu verbessern, wurde die Steinschüttung durch Schaumglaspellets ersetzt, die gleichzeitig eine Dränageschicht bilden. Da das Atrium wie eine Lunge des Gebäudes fungiert, liess sich eine natürliche thermische Regulierung für den Sommerbetrieb realisieren. So lässt sich die im Innenhof während der Nacht entstehende Kaltluft zur Kühlung der Halle per Konvektion verwenden. Das über den Eingangstüren angebrachte Zerstäubungs system senkt zudem an heissen Tagen die Temperatur in der Ausstellungshalle.Steeldoc, Mo., 2010.04.26
26. April 2010 André Carlen