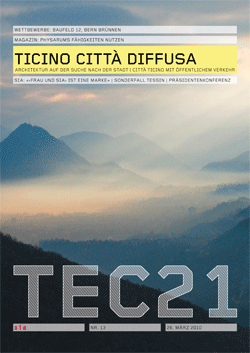Editorial
Wohl kein anderer Landesteil wird im Rest der Schweiz so selektiv wahrgenommen wie das Tessin. Film und Literatur, Illustrierte und Fernsehen, Tourismuswerbung und sogar Schulbücher zeigen uns seit Jahrzehnten, wie wir uns unsere «Sonnenstube» vorzustellen haben. Die Klischees, aus denen sich das Wahrnehmungsraster zusammensetzt, sind sattsam bekannt, trotzdem werden sie von den Deutschschweizer Medien weiterhin fleissig reproduziert. Für einmal versagte sogar unsere sonst zuverlässig realitätsbezogene Fotoagentur, als wir Bilder zu den Artikeln «Architektur auf der Suche nach der Stadt» und «Eine Città Ticino mit öffentlichem Verkehr» suchten. Die Texte haben wir aus dem Tessin erhalten, aktuelle Bilder der besiedelten Landschaft mussten wir uns selber holen. Wir haben sie an den Magnolien und Kamelien vorbei aufgenommen.
Anlass für dieses Thema ist die Übernahme der Tessiner Architektur- und Ingenieurzeitschrift «archi» durch die Verlags AG, die bereits «TEC21» in Zürich und «TRACÉS» in Lausanne herausgibt (vgl. TEC21 39/2009, S.19). Der langjährige «archi»-Chefredaktor Alberto Caruso berichtet ab Seite 16, wie sich die Tessiner Architektur seit ihrem Welterfolg in den 1970er-Jahren weiterentwickelt hat. Und Riccardo de Gottardi, Leiter Raum- und Mobilitätsplanung im Tessiner Raumplanungsdepartement, liefert eine Übersicht über die grossen Infrastrukturprojekte im lange vernachlässigten öffentlichen Verkehr (vgl. S. 21ff.).
Beide Artikel beschäftigen sich mit etwas, das im klischierten Tessin-Bild gar nicht vorkommt: mit der Stadt bzw. mit der Agglomeration. Sie ist heute die Lebenswelt von 90 % der Tessinerinnen und Tessiner. Das Raumentwicklungsleitbild des Kantons propagiert eine durch den öffentlichen Verkehr vernetzte «Città Ticino», die Architekturkritik spricht einstweilen von der chaotisch gewachsenen «città diffusa».
Stau auf den Strassen und die miserable Luftqualität zwingen den Kanton, den öffentlichen Verkehr endlich auf einen zeitgemässen Stand zu bringen. Der Ceneri-Basistunnel wird ab 2019 zum Rückgrat der S-Bahn, die kräftig ausgebaut wird. Um ihre neuen Bahnhöfe herum kann sich die «città diffusa» zur Stadt verdichten.
An Kanton und Gemeinden liegt es, dafür zu sorgen, dass dies auf nachhaltige Weise geschieht und eine hohe Qualität der Architektur und der öffentlichen Räume resultiert.
Wie unstrukturiert die Tessiner Talsenken mittlerweile auch verbaut sein mögen: Unsere neu aufgenommenen Fotos scheinen uns in ihrer Aussage klar genug. Diffus wird hingegen langsam, aber sicher das Grotto-Rustico-Boccalini-Gemälde in unseren Köpfen.
Ruedi Weidmann
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Baufeld 12, Bern Brünnen
11 MAGAZIN
Physarums Fähigkeiten nutzen
16 ARCHITEKTUR AUF DER SUCHE NACH DER STADT
Alberto Caruso
Die Tessiner Architektur wurde nach 1975 berühmt. Ihr Markenzeichen: der starke Bezug zur Umgebung. Diese hat sich seither verändert. Das Tessin ist heute dicht bebaut, doch in der «città diffusa» sind städtische Qualitäten noch selten.
21 EINE CITTÀ TICINO MIT ÖFFENTLICHEM VERKEHR
Riccardo de Gottardi
Das Tessin hat sich zu einer verzettelten Agglomeration verdichtet. Der öffentliche Verkehr wurde lange vernachlässigt. Verstopfte Strassen und die Neat wirken nun als Motor für ÖV-Projekte. Diese wiederum sind eine Chance zur Nachverdichtung der «città diffusa».
27 SIA
Präsidentenkonferenz 1/2010 | «Frau und SIA ist eine Marke» | Sonderfall Tessin
31 PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Architektur auf der Suche nach der Stadt
Wie hat sich das Tessiner Architekturschaffen entwickelt, seit es Mitte der 1970er-Jahre weltberühmt wurde? Alberto Caruso, Chefredaktor der Tessiner Architekturzeitschrift «archi», verfolgt das Geschehen seit Jahren aus der Nähe. Aus Anlass der Übernahme von «archi» durch den Verlag von «TEC21» erzählt er die Geschichte einer Architektur, die sich nach Stadt sehnt.
Die Ausstellung «Tendenzen – neuere Architektur im Tessin» von 1975 in Zürich erscheint im historischen Rückblick wie die Momentaufnahme eines besonderen Augenblicks in der Generationenfolge der Architekturschaffenden. Mit den nachfolgenden Generationen hat sich die Tessiner Architekturszene nach 1975 langsam verändert, mit einer offensichtlichen Aktualisierung der Architektursprache, aber auch mit dem Reiferwerden einiger theoretischer Bezüge.
Der Erfolg der späten Moderne
Um die einzigartigen Verhältnisse im Tessin zu erklären, ist es vielleicht nötig, sich den wichtigsten Grund für die internationale Resonanz in Erinnerung zu rufen, die seine Architektur in den 1970er-Jahren hatte. Es war die in der Nachkriegszeit praktizierte radikale Interpretation der Moderne in dieser Region, die von Erneuerungen der Moderne bis dahin isoliert geblieben war. Die späte Moderne wurde hier erst entdeckt, als Länder wie Italien oder Deutschland eine Phase der Rückbesinnung auf die Bautradition durchlebten. Und sie wurde mythologisiert als Gelegenheit zur kulturellen Befreiung aus der (auch ökonomischen) Rückständigkeit der Zwischenkriegszeit.
So wie die moderne Bewegung kein einstimmiger Chor war, sondern ein komplexes und widersprüchliches Zusammenspiel von Figuren und Strömungen, die in verschiedenen Umgebungen wirkten, so übernahm auch die moderne Tessiner Architektur diese Polyphonie der Bezüge – von Wright zu Terragni, von Le Corbusier zu Mies, von Kahn zu den Kaliforniern. Es war eine Moderne ohne avantgardistische Phase, die quasi reif geboren wurde. Sie war gespeist von einer starken Hinwendung zur gesellschaftlichen Dimension des Bauens und traf auf eine bereits weit entwickelte und verbreitete technische Kultur. Sie hatte unmittelbar und über die Grenzen des Tessins hinaus Erfolg. In vielen Regionen Europas nahmen sie alle diejenigen Kritiker und Architekturschaffenden dankbar auf, die sich gegen eine Rückwendung zur Vergangenheit aussprachen und überzeugt waren, dass das Erneuerungspotenzial der Moderne noch keineswegs ausgeschöpft sei.
Die «Tessiner Architektur» existiert, ungeachtet der Vielfalt von Positionen und Architektursprachen ihrer Protagonisten. Sie war 1975 als solche erkennbar und ist es heute sogar noch deutlicher, und zwar vor allem durch ihre ungewöhnlich starke Bezugnahme auf die Geografie und die Geschichte des Orts, der mit einem Projekt verändert werden soll.
Bezugnahme auf den Ort
Zwei Bauwerke stehen exemplarisch für diese starke Bezugnahme auf den Ort. Hinter beiden Projekten steht sie als Motiv und verbindet – insbesondere über die expressiven Mittel – zwei Architekten, die sonst weit voneinander entfernt sind: «La Ferriera» von Livio Vacchini in Locarno von 2003 und die «Piazzale alla Valle» von Mario Botta in Mendrisio von 1998 (Abb. 2 und 3). Botta interveniert auf einer leeren Restfläche an der Rückseite des altenS tadtkerns, bebaut die Ränder des Grundstücks und schafft so ein eigenständiges Stück Stadt, das sich um einen hofartigen Platz von starker expressiver Intensität herumgruppiert. Die Hinterseite der Stadt wird damit zur Vorderseite eines neuen städtischen Orts; die Stadt wird durch Rekonstruktion erneuert.
Vacchini dagegen rekonstruiert einen rechtwinkligen Block des «Piano Rusca», des am Anfang des 20. Jahrhunderts entworfenen modernen Teils von Locarno mit seinem Muster von Strassenblöcken, die im Lauf der Zeit – in ungenügender Dichte – bebaut wurden. Der bis an die Baulinien überbaute Perimeter ist das Fragment einer grossen europäischen Stadt, Repräsentant eines virtuellen Locarno, und realisiert so die visionäre ursprüngliche Planung. Zwei verschiedene Städte – Botta denkt an die Räume der Mittelmeerstadt, Vacchini an die mitteleuropäische Stadt von Camillo Sitte –, aber ein gemeinsames Bewusstsein dafür, dass unsere heutige Gesellschaft in Räumen lebt, welche dichte soziale Beziehungen begünstigen.
Bauen in der „Città diffusa“
Diese Werke setzen – beide in einem strukturierten städtischen Kontext – das urbane Element in der Tessiner Architektur um, das sich schon 1975 angekündigt hat. Doch das Tessin ist nicht mehr, was es damals war. Heute sind die kleinen Orte in den Talsolen zu chaotisch überbauten Gebieten zusammengewachsen (vgl. Cover S.15 und Abb. im folgenden Artikel). Wird diese Entwicklung nicht koordiniert und korrigiert, dann wird die Tessiner Landschaft in den Talsenken bald aussehen wie die Ausläufer der Agglomeration Mailand um Como und Varese herum. Beim Vorsatz, korrigierend einzugreifen, prallen jedoch zwei politisch- kulturelle Visionen aufeinander. Die einen befürworten die Ausbildung einer grenzüberschreitenden «Regione Insubrica» im Dreieck Como-Varese-Lugano als starke Wirtschaftsregion.
Die andern verfechten das Konzept einer «Città Ticino» mit einer auf Exzellenz setzenden Wirtschaft, die die einmalige Lage zwischen Zürich und Mailand nutzt, mit Bellinzona als führender Stadt in einer ausgedehnten alpinen Region. Die Neue Eisenbahn-Alpentransversale (Neat) wird ab 2017 die Fahrzeiten enorm verkürzen, sodass der Abstand von Arbeits- und Wohnort praktisch keine Rolle mehr spielen wird. Das bedeutet, dass die Landschaft in der Region, wenn sie nicht mit einer klaren und gemeinsamen Vision entwickelt wird, zum Objekt einer allein vom Markt diktierten Verwandlung wird. Hier liegt der grösste Unterschied zwischen der architektonischen Kultur von 1975 und der von heute: Ihr Kontext – das Gebiet, in dem das Metier ausgeübt wird – hat sich verändert.
Die Architekturschaffenden gehören allerdings nicht zu den Protagonisten in dieser Debatte. Viele von ihnen arbeiten in der sogenannten «città diffusa». Hier projektieren sie Einfamilienhäuser und leben im Widerspruch zwischen den ökonomischen Bedingungen, die sie dazu zwingen, sich mit dem in Kleinparzellen zersplitterten Grundbesitz zu beschäftigen, und dem Bewusstsein, dass eigentlich Projekte in grösserem Massstab nötig wären, um die ungeordnete Bebauungsstruktur ohne öffentliche Räume verändern zu können. Der Sinn für die «Situation», das sorgfältige Bezugnehmen der Projekte auf ihre Umgebung, macht seit je den Charakter der Tessiner Architektur aus. Doch für diejenigen, die die gesellschaftliche Dimension ihres Berufs ernst nehmen wollen, reicht dies heute nicht mehr. Hier liegt die grosse Herausforderung der nahen Zukunft: den gänzlich neuen (1975 nicht vorhersehbaren) räumlichen Bedingungen mit adäquaten technisch-kulturellen Instrumenten entgegenzutreten.
Beschäftigung mit den Siedlungsräumen nötig
Aurelio Galfetti hat diese Herausforderung zum Grundmotiv seiner Lehre an der Akademie für Architektur in Mendrisio gemacht. Er arbeitet an der Ausbildung des «architetto del territorio». Wer sich der Realität verweigere und der «città diffusa» mit Modellen begegnen wolle, die von der traditionellen vorindustriellen Stadt abgeleitet sind, werde als Verlierer dastehen, meint er. Man müsse vielmehr die Gründe studieren, wieso eine derart antisoziale und volkswirtschaftlich teure Wohnform wie das Einfamilienhaus so beliebt sei. Dann müsse man in die Mechanismen ihrer Entstehung eingreifen und die Orte identifizieren, wo verdichtetes Bauen und die Schaffung öffentlicher Räume möglich und sinnvoll sind (vgl. dazu folgenden Artikel, Anm. d. Red.). Es ist ein Aufruf dazu, eine Phase breiter Forschung einzuläuten über Instrumente zur Vermessung und Analyse auf der Ebene von Typologie und Morphologie der Projekte und über Verkehrsinfrastrukturen, die heute eine grundlegende Wirkung für die Entstehung neuer Siedlungen entfalten. Dieser neue Typ von Architekturschaffendem beschäftigt sich nicht mehr nur mit Grundriss, Ansicht und Schnitt, sondern ist auch Experte für den Raum im grösseren Massstab und wird zum Regisseur eines interdisziplinären Teams, das komplexe Vorhaben zur Verbesserung bestehender Siedlungsräume und generell im urbanisierten Gebiet umsetzen kann. Am Ende eines arbeitsintensiven Wegs bleibt als Ziel am Horizont die Stadt mit ihrer Dichte an räumlich-funktionalen Bezügen. Doch ist es unmöglich, einzelne Ausschnitte daraus allein mit faszinierenden Entwürfen wie den 1975 in Zürich präsentierten grossmassstäblichen Wettbewerbsprojekten zu realisieren. Die neuen Bedingungen erfordern einen beruflichen Qualitätssprung. Viele Architekturschaffende der jüngsten Generationen reagieren darauf, indem sie den Massstab der Bezüge eines Projekts zu seiner Umgebung ausweiten. Sie beziehen die konstitutiven Elemente der Projekte aus der grossen, von Schneebergen begrenzten Landschaft, aus der Topografie, der Geografie und der Siedlungsgeschichte in ihrer Gesamtheit. Den Massstab auszuweiten, ist bei einer ungeordneten Siedlungsstruktur ein unumgängliches Verfahren, um der Architektur starke Anhaltspunkte zu liefern. Es muss die kritische Distanz ergänzen, die nötig ist, um Rücksicht auf die unmittelbare Umgebung zu nehmen. Mit dem Festlegen räumlicher Koordinaten vermeidet man das Risiko, eine Stadt als Summe von tausend kleinen Projekten zu bauen, die zwar auf ihre unmittelbare Umgebung abgestimmt, aber ohne Gesamtkonzept sind.
Formale Neuerungen
Auch die Architektursprache wird aktualisiert, indem Anleihen bei der Architektur in der Deutschschweiz, auf der iberischen Halbinsel oder bei verschiedenen internationalen Strömungen gemacht werden. Oft deformiert sich die Gebäudehülle, sie entrinnt der einst obligaten rechtwinkligen Ausrichtung und sucht formale Motive in der jeweiligen Aufgabe. Auch die Fensteröffnungen werden mit neuer kompositorischer Freiheit dimensioniert und angeordnet. Diese Neuerungen setzen ein Konzept voraus, das die Gebäudehülle eher als Teil des öffentlichen Raums versteht denn als charakteristischen Ausdruck des Gebäudes. Das offenbart erneut den Wunsch nach einer dauernd präsenten Urbanität, der aber oft unbefriedigt bleibt.
Die Bezugnahme auf die Stadt, auf grössere Massstäbe und komplexere Zusammenhänge treibt die jüngsten Werke der Tessiner Architektur generell an. Sie kollidiert aber offensichtlich mit den begrenzten Dimensionen der Ortschaften und mit politisch-kulturellen Bedingungen, die keine angemessenen professionellen Möglichkeiten bieten. Es ist jedoch ein positiver Konflikt, der in dieser Region voller Talente wichtige Vorbedingungen für eine Erneuerung der Disziplin schaffen kann.TEC21, Fr., 2010.03.26
26. März 2010 Alberto Caruso
Eine città Ticino mit öffentlichem Verkehr
Im Tessin – oder besser: in den Talsenken um Bellinzona, Locarno, Lugano Mendrisio und Chiasso – wächst die Überbauung ungeordnet zu einer Agglomeration zusammen. Hier arbeiten und wohnen über 85 % der Bevölkerung.
Die meisten bewegen sich mit dem Auto. Beim öffentlichen Verkehr besteht grosser Nachholbedarf. «Città Ticino» heisst das Raumentwicklungskonzept des Kantons, mit dem Siedlungs- und Verkehrsentwicklung koordiniert werden sollen. Die Liste von Projekten im öffentlichen Verkehr ist lang. Die neuen Knotenpunkte bieten sich an für die Verdichtung der «Città diffusa».
Die Revision des kantonalen Richtplans von 2005 bis 2009 bot die Gelegenheit, die Raumentwicklung im Tessin zu überdenken und zu diskutieren. Città Ticino ist das Leitprinzip, das sich aus dieser Auseinandersetzung herauskristallisiert hat. Es ist die Vision einer integrierten und leistungsstarken territorialen Struktur. In diesem fragmentierten Gebiet geht es darum, ein vernetztes System von Siedlungsräumen mit hoher Lebensqualität zu etablieren, die miteinander durch ein attraktives und effizientes Verkehrsnetz verbunden sind.
Den Anschluss finden
Das Tessin sieht sich in zweierlei Hinsicht mit einer bedeutenden Herausforderung konfrontiert: Auf der nationalen und internationalen Ebene will es seine Rolle als strategischer Standort im Herzen der Alpen wieder stärken. Denn Randgebiete drohen in den von Globalisierung und Metropolenbildung veränderten Kräfteverhältnissen unterzugehen. Es ist deshalb von zentraler Bedeutung, dass das Tessin sowohl stärker in das Netz der Schweizer Agglomerationen eingebunden als auch in die Dynamik des Wirtschaftsraums der Lombardei integriert wird. In der Lombardei, die den Kanton im Süden umgibt, leben in einem Radius von 50 km von der Grenze 6 Mio. Menschen. Um sich dieses Potenzial bewusst zu machen, genügt es, sich zu vergegenwärtigen, dass die Distanzen zwischen Tessin und der Mailänder Metropole viel kürzer sind als die zu Zürich oder Luzern.
Auf lokaler Ebene will das Konzept Città Ticino den Zusammenhalt zwischen den Agglomerationen stärken. Ziel ist eine Struktur von leistungsstarken, polyzentrischen und funktional integrierten Siedlungen. Eine bedeutende Rolle spielen drei Gebiete: das Bellinzonese mit den drei Tälern Leventina-Riviera, Blenio und Misox, das Locarnese mit dem Maggiatal und das Luganese mit dem Mendrisiotto. Die führenden Orte sind dabei Lugano als Zentrum von nationaler Bedeutung sowie Bellinzona, Locarno und Chiasso-Mendrisio als Zentren von kantonaler Bedeutung (Abb. 1).
Schweizer Meister beim Motorisierungsgrad
Das Wachstum von Wirtschaft und Bevölkerung vollzieht sich auf 15 % der Gesamtfläche des Kantons, in den Talsenken von Biasca bis Locarno respektive vom Ceneri bis Chiasso. In diesen Gebieten konzentrieren sich 90 % der Arbeitsplätze und 85 % der Wohnbevölkerung. Der Druck auf die Infrastrukturen und die Transportmittel ist gross. Mit 603 Personenwagen pro 1000 Einwohner (Stand 2009) weist das Tessin den höchsten Motorisierungsgrad in der Schweiz auf. In den letzten zwei Dekaden hat sich die Belastung an den zentralen Punkten des Autobahn- und des Kantonsstrassennetzes mehr als verdoppelt. Vor allem in den Agglomerationen haben sich die Verkehrsbedingungen verschlechtert. Die Staus während der Stosszeiten dehnen sich laufend aus. Die grossen Verkehrsvolumen verursachen unter den spezifischen geografischen und klimatischen Bedingungen am Alpensüdrand eine viel stärkere Luftverschmutzung als im Rest der Schweiz. Das Problem ist ungelöst, und die Entwicklungsperspektiven zeigen einen weiteren Anstieg der Mobilität um 15–30 % bis 2030 an.
Nachhalt iges Verkehrssystem entwickeln
Der Umgang mit der Mobilität ist damit eine zentrale Frage, auf die die Città Ticino konkrete Antworten finden muss: Attraktivität, Effizienz und Sicherheit sind in Einklang zu bringen mit Rücksicht auf die Umwelt und mit den Bedürfnissen aller Kantonsgebiete und Bevölkerungsgruppen. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs konzentriert sich prioritär in und zwischen den Agglomerationen. In den Tälern geht es darum, eine Basiserschliessung zu gewährleisten. Der Verkehrsstrategie und konkreten Verkehrsprojekten kommt damit eine grundlegende Rolle zu. Generell geht es darum, die sinnvolle gegenseitige Ergänzung der verschiedenen Verkehrsarten Privatauto, Bahn, Bus, Velo und als Fussgänger je nach ihren Eigenschaften und nach dem Kontext zu fördern. Dazu muss vor allem das lange vernachlässigte und unattraktiv gewordene öffentliche Verkehrsnetz ausgebaut werden. Die Fortschritte der vergangenen Jahre sind bereits beachtlich: 1997 wurde der Tarifverbund Tessin und Misox für Abonnemente eingeführt, die städtischen Transportsysteme in den Agglomerationen Locarno (1996), Lugano (2002) und Mendrisio-Chiasso (2004) wurden weiterentwickelt.
Im regionalen S-Bahn-Netz Tessin-Lombardei (Treni Regionali Ticino Lombardia, TILO) verkehren die Züge seit 2005 im Halbstundentakt. 2007 und 2008 wurde das alte Rollmaterial durch neue «Flirt»-Kompositionen ersetzt. Schliesslich sei noch auf den Ausbau der Bahnlinie Ponte Tresa–Lugano 2007 verwiesen.
ÖV-Projekte und urbane Verdichtung
Zur Verbesserung der Situation im öffentlichen Verkehr wird ab 2011 der flächendeckende Tarifverbund für das ganze Fahrausweissortiment im ganzen Kanton eingeführt. Ende 2013 soll die neue Eisenbahnverbindung von Mendrisio über die Grenze nach Varese und zum Flughafen Mailand-Malpensa in Betrieb genommen werden (Ferrovia Mendrisio–Varese, FMV, Abb. 1 und 6). Die Arbeiten an der Neubaustrecke Mendrisio–Varese sind seit 2008 im Gang, sie werden vom Bund mitfinanziert. Der Regionalverkehr (TILO), der seit der Erweiterung nach Como 2008 bereits grenzüberschreitend verkehrt, wird dann auch die Agglomeration Varese bedienen und damit einen Markt von rund 600 000 Einwohnern erschliessen. Der Flughafen Malpensa wird von Lugano aus in einer Stunde erreichbar sein. Ausserdem kann in Varese-Gallarate ein Anschluss an die Simplon-Linie geschaffen werden, wodurch die französische Schweiz vom Tessin aus mit beträchtlicher Zeitersparnis zu erreichen sein wird. Mit dem fortschreitenden Ausbau der S-Bahn (TILO) werden laufend Bahnhöfe modernisiert oder neu gebaut, so in Chiasso, Mendrisio, Lugano, San Antonino, Minusio, Stabio und Castione. Diese Projekte bieten Gelegenheiten zu städtebaulichen Aufwertungsprojekten, verdichtetem Bauen und zur Ansiedlung von Dienstleistungsunternehmen (vgl. auch vorangehenden Artikel). In Castione am Eingang zum Misox, wo der nördliche Endbahnhof der S-Bahn entsteht, hat die Gemeinde eine Revision der Ortsplanung begonnen.
Die Neat als Motor und Gelegenheit
Mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels 2017 werden sich die Reisezeiten von Bellinzona nach Zürich von heute 2:15 Stunden auf 1:30 Stunden verkürzen. 2019 wird voraussichtlich der Basistunnel durch den Monte Ceneri in Betrieb genommen, der die Reisezeit zwischen Bellinzona und Lugano von 25 auf 12 Minuten verkürzen und die Distanz zwischen Lugano und Zürich von 2:45 Stunden auf 1:40 Stunden reduzieren wird. Der Ceneri-Tunnel kann vom Regionalverkehr mitbenützt werden und spielt für dessen Entwicklung eine zentrale Rolle: Die Reisezeiten fast aller Regionalverbindungen werden sich drastisch verkürzen – die Città Ticino wird dann über eine Art Metro verfügen.
Das Tessin bereitet sich somit auf ein Jahrzehnt bedeutender Veränderungen auf dem Gebiet des Verkehrsmanagements und der Siedlungsentwicklung vor. Die Projekte bergen beträchtliche Potenziale, müssen aber trotzdem mit Offenheit und Klugheit angegangen werden. Aber auch die ungelösten oder unsicheren Fragen müssen angegangen werden, darunter die noch unattraktiven Verbindungen nach Mailand, die noch offenen Fragen der Zufahrten zu den beiden Basistunnels, die Verlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene und der Anschluss des Locarnese an das Autobahnnetz.TEC21, Fr., 2010.03.26
26. März 2010 Riccardo de Gottardi