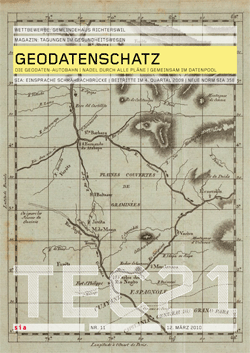Editorial
Mit der 1812 publizierten Karte (vgl. Bild) dokumentierte Alexander von Humboldt ein wichtiges Ergebnis seiner Forschungsreise durch Amerika (1799–1804): die entgegen der damals verbreiteten Lehrmeinung bestehende natürliche Verbindung der beiden Flüsse Orinoko und Amazonas. Für diesen Nachweis befuhr er das Flusssystem im Jahr 1800 während einer mehrmonatigen Expedition – eingezwängt mit mehreren Begleitern und allerlei Messinstrumenten auf einem engen Schiff, bedroht von Krankheiten, wilden Tieren und stechenden Insekten und bei spartanischer Ernährung, die meist aus Reis, Ameisen und ein paar Früchten bestand.
Die Erkundung der Welt ist heute um ein Vielfaches leichter geworden: Satelliten- und Luftbilder liefern detailgenaue Informationen über die Erdoberfläche und können häufig das Messen vor Ort ersetzen. Die Ablösung von Karten in Papierform durch digitale Geodaten macht auch den Zugriff auf raumbezogene Informationen immer einfacher. Deren Nutzung gehört für uns heute zum Alltag, oft ohne dass wir uns dessen bewusst sind: beim Autofahren mit Navigationssystem, beim Aufrufen eines digitalen Stadtplans oder beim Surfen auf Google Street View. Geodaten sind auch Grundlage jeder Planung. Da sie je nach Thema aber bei verschiedensten Stellen verwaltet werden, ist ihre Beschaffung heute oft mit einem zermürbenden Ämterparcours verbunden.
Der vom Bundesrat beschlossene Aufbau einer Nationalen Geodaten-Infrastruktur soll das ändern. Durch die Festlegung einheitlicher Standards werden Erhebung und Austausch von Geodaten harmonisiert, mit dem Ziel, alle Geodaten über zentrale Internetportale zugänglich zu machen. Dieses Heft gibt einen Vorgeschmack darauf, wie die Arbeit mit Geodaten dadurch erleichtert wird: Das beginnt bei der Planung eines Bauvorhabens, wenn digitale Karten die Suche nach einer Bauparzelle vereinfachen, ein geplanter Kataster den Überblick über die wichtigsten Eigen-tumsbeschränkungen eines Grundstücks ermöglicht und dank Überlagerung und Auswertung digitaler Karten beispielsweise auch die Festlegung der zulässigen Länge von Erdwärmesonden wesentlich einfacher wird.
Unkomplizierter werden auch die anschliessende Beurteilung eines Baugesuchs und der Bauvorgang selbst, da die zentrale Beschaffung und Aufbereitung von Daten dafür sorgt, dass Doppelarbeit vermieden und die Verfügbarkeit für alle Beteiligten ermöglicht wird.
Die Nationale Geodaten-Infrastruktur macht auch den historischen Teil des Geodatenschatzes besser nutzbar, indem beispielsweise die Dufour- und die Siegfriedkarten in digitaler Form zur Verfügung stehen. Sie dokumentieren die Veränderung der Landschaft und können damit auch heute noch wertvolle Hinweise geben.
Claudia Carle
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Gemeindehaus Richterswil
12 MAGAZIN
Tagungen im Gesundheitswesen
14 PERSÖNLICH
Jürg Buchli, 1944–2010
18 GRÜNES LICHT FÜR DIE GEODATEN-AUTOBAHN
Fridolin Wicki, René Sonney
Das neue Geoinformationsgesetz wird die Verfügbarkeit von Geodaten wesentlich verbessern. Digital abrufbar werden auch die wichtigsten Eigentumsbeschränkungen eines Grundstücks.
24 ELEKTRONISCHE NADEL DURCH ALLE PLÄNE
Thomas Noack, Peter Jordan
Mit dem Darstellungsdienst GeoView.BL hat der Kanton Basel-Landschaft ein Instrument geschaffen, das die Suche nach einer Bauparzelle und das Baubewilligungsverfahren erleichtert.
29 GEMEINSAM IM DATENPOOL
Thomas Glatthard
Planende benötigen Geodaten und produzieren bei ihrer Arbeit selber welche, die wiederum anderen als Grundlage dienen können. Ein zentraler Zugang zu diesen Informationen vereinfacht die Grundlagensuche und die Projektarbeit.
33 SIA
Einsprache für die Schrähbachbrücke | Beitritte zum SIA im 4. Quartal 2009 | Neue Norm SIA 358 | Aktuelle Kurse SIA-Form
37 FIRMEN
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Grünes Licht für die Geodaten-Autobahn
Für die Arbeit von Ingenieuren und Architektinnen sind Pläne, Karten oder digitale Geodaten essenziell. Das neue Geoinformationsgesetz des Bundes wird die Verfügbarkeit von Geodaten wesentlich verbessern. Sie sollen nach einheitlichen Standards verwaltet und über benutzerfreundliche, digitale Plattformen allen Interessierten zugänglich werden. Hilfreich wird insbesondere sein, dass die wichtigsten öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen eines Grundstücks digital abrufbar werden.
Geoinformationen sind orts- und raumbezogene Daten. Sie beschreiben die Gegebenheiten eines Landes in Form von Koordinaten, Ortsnamen, Postadressen und anderen Angaben. In praktisch allen Lebensbereichen werden sie immer wichtiger. 60 bis 80 % aller politischen, wirtschaftlichen und privaten Entscheidungen haben einen räumlichen Bezug. Im Alltag greifen wir regelmässig auf Geoinformationen zu, oft ohne es zu realisieren, beispielsweise bei der Nutzung von Stadtplänen, Adressverzeichnissen oder Navigationssystemen. Geoinformationen sind auch eine unerlässliche Voraussetzung für eine gut funktionierende direkte Demokratie, für transparente und nachvollziehbare Entscheidungen und für den Einbezug der Bevölkerung in politische Geschäfte. Für eine nachhaltige Entwicklung sollten Planungen und Beschlüsse immer auch ihre räumlichen Auswirkungen reflektieren. Nur mit genauer Kenntnis des Raums, seiner Nutzung und Entwicklung lassen sich die Folgen von Entscheiden extrapolieren. Mit Geoinformationen können die vielfältigen sozialen, natürlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse innerhalb eines geografisch definierten Gebietes realistisch nachgebildet und analysiert werden. Auch in der Privatwirtschaft sind Geoinformationen unentbehrlich: zum Beispiel im Marketing, in Logistik und Distribution, bei Investitionsentscheiden oder der Standortwahl.
Das enorme politische und volkswirtschaftliche Potenzial macht Geoinformationen zu einem erstrangigen Wirtschaftsgut von ähnlicher Bedeutung wie das Verkehrs- und Kommunikationsnetz oder die Energie- und Wasserversorgung.
Aufwendige Beschaffung von Plänen und Informationen
Im Bereich der Planung ist die Beschaffung von Geodaten oft mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. Da muss der Plan beim Geometer bestellt, beim Grundbuchamt der Eigentümer abgeklärt, beim Raumplanungsamt die Bauzone notiert, der Bauabstand eingemessen, das Weg- und Durchleitungsrecht lokalisiert und die Grenze der Schutzzone übertragen werden. Vielleicht muss bei der Archäologie abgeklärt werden, ob das vermutete frühmittelalterliche Gräberfeld bis auf das Grundstück reicht. Unvermeidbar ist der Gang zu den Städtischen Werken und zum Betreiber von Gemeinschaftsantenne und Telefonnetz, wenn man vermeiden will, beim Bau ein Kabel durchzuschneiden. Wenn noch Drainageleitungen vermutet werden, ist auch noch ein Besuch beim Meliorationsamt fällig.
Auch in Verwaltungen wird heute noch ein Vielfaches an Zeit dafür aufgewendet, geeignete Geodaten zu suchen, zu lesen und zu verstehen, als dafür, sie wirklich einzusetzen. In der Bundesverwaltung bestehen Hunderte von verschiedenen Geodatensätzen – in digitaler oder teilweise noch analoger Form – aus Bereichen wie Topografie, Geologie, Bodenkunde, Gewässer, Luft, Klima, Flora und Fauna, Bevölkerung, Verkehr, Infrastruktur, Umwelt, Gesundheit, Wirtschaft, Raumplanung, Kunst und Kultur. Sie stammen aus unterschiedlichsten, nicht vereinbaren Quellen. Hinzu kommen unzählige kantonale und kommunale Datenbestände aus weiteren, nicht kompatiblen Informatikanwendungen.
Aufbau einer nationalen Geodaten-Infrastruktur
All diese Informationen wurden mit immensen Kosten erhoben, ihr Wert wird auf insgesamt 5 Milliarden Franken geschätzt. Doch um den Datenschatz zu heben, braucht es eine benutzerfreundliche, vernetzte und dezentrale Plattform, die jederzeit und überall einen raschen und kostengünstigen Zugang zu verlässlichen Geoinformationen gewährleistet – für die Verwaltung, für die Wirtschaft, für alle. Für eine effiziente Nutzung des Datenschatzes fehlte es bisher an einer gemeinsamen Politik auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene, an einheitlichen Standards und Technologien und oft auch am Bewusstsein für die Wichtigkeit von Geoinformationen.
2001 hat der Bundesrat aber nun eine «Strategie für Geoinformation beim Bund»[1] beschlossen und zwei Jahre später das zugehörige Umsetzungskonzept[2] verabschiedet. Ein wesentliches Ziel der Strategie ist, hochwertige Geoinformation für die Verwaltung, die Wirtschaft und Private besser verfügbar zu machen. Das Umsetzungskonzept sieht den Aufbau einer Nationalen Geodaten-Infrastruktur (NGDI) vor. Sie soll sicherstellen, dass die bestehenden, dezentral verwalteten Geodaten landesweit allen Interessierten einfach zugänglich werden, laufend aktualisiert, in der richtigen Qualität und zu angemessenen Kosten. Dazu sollen im Sinne einer Harmonisierung bundesrechtlich verbindliche Standards für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festgelegt und modernste Technologien genutzt werden.
Koordination durch Netzwerk E-GEO.CH
Koordiniert und gesteuert wird der Aufbau der NGDI durch das Netzwerk e-geo.ch. Es vernetzt die im Bereich der Geoinformation tätigen Organisationen und Fachleute (Abb. 5). Trägerschaft von e-geo.ch sind der Bund (über die interdepartementale Koordinationsgruppe des Bundes für Geoinformation und Geoinformationssysteme [GKG-KOGIS]), die Kantone (vertreten durch die Konferenz der Kantonalen Geodaten-Koordinationsstellen und GIS-Fachstellen [KKGEO], die Konferenz der Kantonalen Vermessungsämter [KKVA] und die Kantonsplanerkonferenz [KPK]), die Gemeinden und Städte (vertreten durch den Gemeindeverband und den Städteverband) sowie die unter dem Dach der Schweizerischen Organisation für Geo-Information (SOGI) versammelten Vertreter der Privatwirtschaft, der Schulen und der nichtkantonalen Verbände.
Zu den Aufgaben von e-geo gehören (Abb. 6):
– Politisches Lobbying auf höchster Ebene
– Definition der grundlegenden Geoinformationen und -dienste, die von den Verwaltungen bereitzustellen und nachzuführen sind
– Festlegen der benötigten Metainformationen (vgl. Glossar S.18) und Gewährleistung der Nachführung
– Bestimmung und Aufbau der erforderlichen technischen Infrastruktur
– Erstellung bzw. Anpassung der rechtlichen Grundlagen
– Erarbeitung und Durchsetzung verbindlicher Standards für Metadaten, Modellierung und Datenaustausch
– Förderung der Aus- und Weiterbildung und der Forschung
– Entwicklung und Einführung einer gemeinsamen Tarifierungs- und Vertriebsstrategie
Erstes Land mit Geoinformationsgesetz
Den rechtlichen Rahmen für den Aufbau der NGDI bilden das Geoinformationsgesetz (GeoIG), das am 1. Juli 2008 in Kraft getreten ist, und seine Ausführungsverordnungen.[3] Die Schweiz ist das bisher einzige Land mit einem solchen Gesetz. Das GeoIG gilt für alle geografischen Daten, die im Rahmen des Vollzugs der vielen existierenden Gesetzgebungen des Bundes erhoben und verwaltet werden (Geobasisdaten des Bundesrechts). Eine vollständige Liste all dieser Geobasisdaten des Bundesrechts findet sich im Anhang zur Geoinformationsverordnung («Geobasisdatenkatalog»).
Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen
Mit dem GeoIG wurden auch die Grundlagen für den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB)[4] geschaffen. Damit beschreitet die Schweiz Neuland. Wer in der Schweiz Land besitzt, muss sich bei dessen Nutzung an Rahmenbedingungen halten, die ihm der Gesetzgeber und die Behörden vorschreiben. Dabei sind eine Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen und behördlichen Einschränkungen – die sogenannten öffentlich- rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB) – zu beachten. Die ÖREB haben sich seit dem Zweiten Weltkrieg sukzessive entwickelt. Während Grundeigentümer vorher in der Regel die volle Verfügungsgewalt über ihr Grundstück hatten, wurde das Grundeigentum danach zunehmend durch öffentlich-rechtliche Bestimmungen eingeschränkt. Anfänglich waren dies vor allem Bauordnungen, später kamen laufend Beschränkungen aus anderen Bereichen (Raumplanung, Umweltschutz, Gewässerschutz usw.) hinzu, wodurch die Rechtssicherheit beim Grundeigentum reduziert wurde.Weil diese ÖREB nicht an einem Ort, sondern bei unterschiedlichen Behörden dokumentiert sind, braucht es heute einen zeitaufwendigen Gang von Amt zu Amt, um alle Eigentumsbeschränkungen eines bestimmten Grundstücks zu sammeln. Der neue Kataster wirkt dieser unbefriedigenden Situation entgegen, indem er einen wesentlichen Teil der ÖREB systematisch dokumentiert und zentral veröffentlicht. Der heutige, aus Grundbuch und amtlicher Vermessung bestehende privatrechtliche Grundeigentumskataster wird um den Bereich der ÖREB erweitert. Das erhöht die Rechtssicherheit beim Grundeigentum und im Hypothekenmarkt und vereinfacht die Informationsgewinnung wesentlich.
Eine ÖREB besteht aus Plan und Reglement. Im Plan wird festgelegt, für welches Gebiet eine bestimmte ÖREB (beispielsweise eine Nutzungszone) gilt. Im Reglement (beispielsweise im Baureglement der Gemeinde) wird definiert, was die Einschränkung umfasst und welche Auswirkungen sie hat. Diese Informationen werden künftig digital und analog erhältlich sein.
Einführung in zwei Etappen bis 2019
Bund und Kantone werden sich in die Führung des ÖREB-Katasters teilen und auch gemeinsam die Kosten tragen. Der Bund wird die strategische Ausrichtung festlegen und die minimalen Anforderungen an den Kataster bezüglich Organisation, Verwaltung, Harmonisierung, Datenqualität, Methoden und Abläufen bestimmen. Er hat die Oberaufsicht über den ÖREB-Kataster (wie auch über die amtliche Vermessung) an das Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) delegiert. Die Kantone organisieren die Führung des Katasters und bestimmen die verantwortlichen Organe.
Der ÖREB-Kataster wird in zwei Etappen eingeführt: Bis 2015 werden zwei bis fünf Kantone, die bis Ende dieses Jahres bestimmt werden, den Kataster aufbauen. Die restlichen Kantone sollen von diesen Vorarbeiten profitieren und den Kataster anschliessend bis 2019 ebenfalls einführen.
Anmerkungen:
[01] Strategie für Geoinformation beim Bund, 15. Juni 2001 www.swisstopo.ch > Dokumentation > Publikationen > KOGIS
[02] Umsetzungskonzept zur Strategie für Geoinformation beim Bund, 16. Juni 2003 www.swisstopo.ch > Dokumentation > Publikationen > KOGIS
[03] Rechtliche Grundlagen inklusive die Gesetzesbotschaft und erläuternde Berichte zu den Verordnungen unter www.swisstopo.ch > über swisstopo > rechtliche Grundlagen. Der e-geo.ch-Newsletter Nr. 20 liefert wertvolle Zusatzinformationen (Bezug: www.e-geo.ch > Publikationen > Newsletter)
[04] Weitere Informationen zum ÖREB-Kataster: www.cadastre.ch, wo auch Publikumsbroschüren zum ÖREB-Kataster sowie zur amtlichen Vermessung erhätlich sindTEC21, Fr., 2010.03.12
12. März 2010 Fridolin Wicki, René Sonney
Elektronische Nadel durch alle Pläne
Mit dem Darstellungsdienst GeoView.BL hat der Kanton Basel-Landschaft ein Instrument geschaffen, das Baubewilligungsverfahren erleichtert. Auch externe Planungs- und Beratungsfirmen sowie Private können es nutzen und über einen Downloaddienst die Geodaten auch direkt verarbeiten. Durch die Verbindung bestehender Informationen können ausserdem neue Geodaten erarbeitet werden, die beispielsweise die Bewilligung von Erdwärmesonden erleichtern.
Für Planende ist die Beschaffung von Plangrundlagen wie Grundbuchauszug, Werkplänen und Katasterplan ein aufwendiger und zeitraubender Prozess. Ebenso mühsam war diese Aufgabe für die Baubehörden, bis sie sich entschlossen, alle Richt-, Nutzungs-, Gestaltungsund Schutzpläne, alle Spezial-, Sonder- und Belastungszonen, alle Inventare und Kataster usw. in ein Geografisches Informationssystem (GIS) zu laden. Damit war der Traum von der elektronischen Nadel geboren, die durch alle Pläne sticht, keinen vergisst und zurückmeldet, welche Zonen betroffen und welche Auflagen und Nutzungsbeschränkungen zu berücksichtigen sind.
Erleichterte Suche nach einer Bauparzelle
Eine solche GIS-Infrastruktur hat zum Beispiel der Kanton Basel-Landschaft für die Aufgaben der kantonalen Verwaltung aufgebaut. Ein grosser Teil der hier zusammengetragenen Geobasisdaten (vgl. Glossar S.18) wird der Öffentlichkeit über das Geodatenportal des Kantons Basel-Landschaft im Internet[1] zur Verfügung gestellt. Es handelt sich dabei auch um Kartenund Planwerke, die für Bürgerinnen, interessierte Architekten und Bauherrschaften bisher nur schwer zugänglich waren.
Die Grundlagen für diese Angebote bilden das kürzlich in Kraft getretene Geoinformationsgesetz (vgl. S.18), die grossen technischen Fortschritte der letzten Jahre und die konsequente Erhebung, Nachführung und Zusammenführung der Geobasisdaten. Die GIS-Fachstelle des Kantons Basel-Landschaft betreibt dazu eine umfangreiche zentrale Datenbank der kantonalen Geobasisdaten («Geodatawarehouse»), in der Daten aus den verschiedenen Fachbereichen mit einem einheitlichen Raumbezug gespeichert werden. Diese werden den Anwendern mittels Geodiensten bedürfnisgerecht zur Verfügung gestellt. Der Darstellungsdienst erlaubt zum Beispiel einfache Abfragen und räumliche Analysen, primär durch die Überlagerung verschiedener thematischer Karten, zum Beispiel für Standortevaluationen bei der Suche nach einer Bauparzelle (Abb. 1 bis 6). Mit diesem virtuellen Augenschein, dem Desktop Visiting, lassen sich diverse Vorabklärungen bequem zu Hause am Computer und dann auch gemeinsam mit dem Architekten oder der finanzierenden Bank durchführen.
Für die Suche nach einer geeigneten Bauparzelle müssen je nach den Ansprüchen der Bauherrschaft unterschiedliche Kriterien erfüllt sein. Eine umweltbewusste Bauherrschaft wird sich für die Anschlussmöglichkeit an ein Fernwärmenetz oder die Nutzungsmöglichkeit von Erdwärme interessieren. Pendler werden die Qualität der Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr hoch gewichten, Eltern die Distanz zur nächsten Schule. Das Geodatenportal erspart nicht nur die Beschaffung und laufende Aktualisierung eines grösseren Kartenwerks im eigenen Büro, sondern ermöglicht auch, die geforderten Grundlagen zu einem Baugesuch einfach zusammenzustellen. Die gesicherte Herkunft der Informationen und die einheitliche Darstellung schaffen Vertrauen und erleichtern das Bewilligungsprozedere.
Vorderhand haben die zur Verfügung gestellten Daten allerdings erst informativen Charakter. Teilweise sind die Angaben auch noch nicht vollständig. Gewisse Daten stehen zudem noch nicht zur Verfügung. Deshalb empfiehlt es sich, vor der Eingabe eines Baugesuchs noch die rechtsgültigen Pläne und Texte zu konsultieren, die bis heute nur in Papierform vorliegen. Mit der Einführung des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB) (vgl. S. 18 ff.) in den kommenden Jahren soll die Rechtssicherheit verbessert werden, sodass die elektronischen Angaben auch einen verbindlichen Charakter erhalten.
Vereinfachte Beurteilung von Baugesuchen
Ist eine Parzelle gefunden, bietet ein System wie die verwaltungsinterne Version des Darstellungsdienstes GeoView.BL diverse weitere Hilfestellungen an, die sich konsequent bis zur Beurteilung des Baugesuchs durch die Behörden weiterziehen. Mittels «Nadelstichen» durch die zur Verfügung gestellten Informationsebenen am Ort des Bauvorhabens lassen sich sehr viele für die Detailplanung eines Neubaus wesentliche Informationen am Computer ausfindig machen: die relevante Nutzungszone, überlagerte Schutzzonen, Angaben zum Grundwasserschutz und zur Altlastensituation, die Grösse der Parzelle usw. Indem zusätzliche Datenebenen eingeblendet werden, lassen sich weitere wichtige Angaben finden wie Baulinien oder die Lärmbelastungsstufe entlang von Hauptstrassen (Abb. 8 bis 10). Die in GeoView.BL eingebaute Druckfunktion erlaubt die projektbezogene Zusammenstellung dieser Karten als datierbare, herunterladbare pdf-Dateien. Schliesslich können Bauherrschaften, Architekten, Planerinnen und weitere Interessierte die relevanten Geodaten in gängigen GIS- und CAD-Formaten zur weiteren Bearbeitung mit dem Downloaddienst GeoShop.BL gratis und direkt beziehen.[2]
Ist ein Baugesuch einmal eingereicht, werden die gleichen Daten aus dem zentralen Geodatawarehouse innerhalb der Verwaltung für die Prüfung des Baugesuchs eingesetzt. Hierzu arbeitet die von der Informatikabteilung der Bau- und Umweltschutzdirektion entwickelte Baugesuchssoftware über räumliche Datenbankabfragen und Applets mit der Datenbank der Geodaten zusammen.
In einem ersten Arbeitsschritt wird das Baugesuch durch die Mitarbeitenden des Bauinspektorates georefenziert und seine Lage in GeoView.BL publiziert. Zusätzlich wird der von der Bauherrschaft eingereichte Situationsplan eingescannt, georeferenziert und ebenfalls in GeoView.Bl publiziert. Dann erfolgt die Verteilung der Baugesuche an die zuständigen Fachstellen der Verwaltung zur Stellungnahme, und zwar teilweise automatisiert nach definierten Kriterien über eine räumliche Abfrage beim zentralen Geodatawarehouse. Über räumliche Abfragen beim Geodatawarehouse werden dann den Sachbearbeitenden in der Baugesuchssoftware automatisch raumbezogene Informationen zur Verfügung gestellt. Sie wissen so zum Beispiel, in welcher Nutzungszone sich das Baugesuch befindet, welches die letzte Zonenplanmutation an diesem Ort war oder ob sich in der Nähe ein denkmalgeschütztes Objekt befindet, das für die Beurteilung relevant sein könnte.
Somit haben die am Baugesuchsverfahren beteiligten Fachstellen alle für die Beurteilung relevanten Geoinformationen über die Baugesuchsapplikation und den Darstellungsdienst GeoView.BL an ihrem Arbeitsplatz zur Verfügung. Damit entfällt eine aufwendige Suche nach aktuellen Grundlagendaten. Dank den definierten Kriterien erfolgt die automatische Steuerung der Baugesuche zur Stellungnahme an die zuständigen Fachstellen sehr effizient und zuverlässig. Ausserdem kann die Software automatisch Hinweise geben, zum Beispiel auf die Anschlussmöglichkeit an ein Fernwärmenetz, wenn das Baugesuch innerhalb des Perimeters eines Wärmeverbundes liegt.Rohdaten für analysen und auswertungen Bei den bisher vorgestellten Anwendungen handelt es sich vorwiegend um die Konsultation und den Vergleich bereits erfasster Daten mittels Darstellungsdiensten. Ein zunehmend wichtiger Bereich der Arbeit mit Geodaten ist aber die Verwendung der Rohdaten für spezifische und komplexe Analysen oder zur Erarbeitung neuer Geodaten. Die Darstellungsdienste der kantonalen oder der Bundesportale ermöglichen zwar teilweise einfache Auswertungen wie spezifische Flächenverschnitte, lassen aber meist nur die Überlagerung und den Vergleich eines eingeschränkten Satzes von Geodaten zu.
Wie im Gesetz über die Geoinformation vorgesehen, bieten heute bereits verschiedene Kantone über ihre Geoportale mit einem Downloaddienst ihre Geodaten frei oder gegen Gebühr zum Download an. Bereits weit verbreitet ist das bei Daten der amtlichen Vermessung. Im Angebot befinden sich aber auch Daten zu Planungs-, Umwelt- und Infrastrukturthemen. Mit diesen Rohdaten und den Entwicklungen der kommerziellen GIS-Programme ergeben sich viel weitergehende Möglichkeiten für Auswertungen und räumliche Analysen. Auch komplexe Berechnungen bis in den 3D-Bereich sind möglich.
Zulässige Länge von Erdwärmesonden einfacher bestimmen
Ein Beispiel sind Erdwärmesonden-Karten. Die Zulässigkeit von Erdwärmesonden (EWS) richtet sich nach verschiedenen Kriterien (Abb. 11). So wird unter anderem verlangt, dass auch tief liegende, nutzbare Grundwasservorkommen durch EWS nicht beeinträchtigt werden. Es handelt sich dabei oft um Karstgrundwasserleiter, d.h. höhlenreiche Kalkgesteinsformationen, die in der Schweiz für die Speisung bedeutender Thermal-, verschiedener Mineral- und vieler öffentlicher Trinkwasserquellen verantwortlich sind.
Bevor Geodaten und Geografische Informationssysteme verfügbar waren, war der Einbezug der Karstgrundwasserleiter in EWS-Karten sehr aufwendig und auch fehleranfällig, da kleinräumige Variationen in der Tiefenlage der Kalkgesteinsformationen nur beschränkt erfasst werden konnten. Die Erstellung und elektronische Verarbeitung von Höhenmodellen hat hier zu einem entscheidenden Durchbruch geführt.
Da EWS-Karten zudem viele extern festgelegte Elemente wie den Kataster der belasteten Standorte oder die Naturgefahrenkarte berücksichtigen, die jeweils unterschiedlichen Überarbeitungsrhythmen unterworfen sind, drohen sie rasch zu veralten, wenn neue oder revidierte Daten vorliegen. In jüngsten Ansätzen wird deshalb der Ersatz der klassischen Karten durch EWS-Applikationen angestrebt, in welchen für jedes einzelne Gesuch ein Nadelstich durch alle relevanten Themen gemacht wird. So ist nicht nur garantiert, dass jeweils die aktuelle und rechtsgültige Situation der planerischen Ebenen berücksichtigt wird. Vielmehr kann auch die maximal zulässige Sondenlänge individuell festgelegt werden. Ein weiterer Schritt in diese Richtung wäre zum Beispiel ein «intelligentes» Baugesuchsportal im Internet, das mit Hilfe regelbasierter automatisierter Plausibilitätskontrollen und räumlicher Abfragen schon bei der Eingabe des Baugesuchs Hinweise auf die Bewilligungsfähigkeit liefern würde.
Das immer dringendere Postulat, unseren Lebensraum nachhaltig zu nutzen, und die zunehmende Vielfalt an Nutzungsansprüchen lässt den Geobezug der einzelnen Fachdisziplinen immer wichtiger werden. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit muss in Richtung einer integralen Raumwissenschaft gefördert werden. Geodaten und Geografische Informationssysteme sind dabei wichtige Hilfsmittel. Von ihren Nutzern werden aber nicht nur technische Kenntnisse, sondern auch vernetztes Fachwissen, Raum- und methodisches Verständnis verlangt. Hier öffnen sich für Fachleute und spezialisierte Firmen in der Schweiz und weltweit Erfolg versprechende Entwicklungsperspektiven.
Anmerkungen:
[01] www.geo.bl.ch
[02] Im Geoportal des Kantons Basel-Landschaft ab 1. April 2010 öffentlich zugänglichTEC21, Fr., 2010.03.12
12. März 2010 Thomas Noack, Peter Jordan