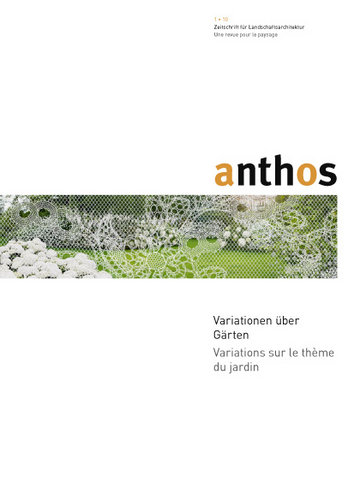Editorial
«Michelle Obama tut es... die Queen auch. Über das Glück im Garten.» titelte das Zeitmagazin im August 2008 und fragte auf den folgenden Seiten «Warum zieht es in diesem Jahr alle Welt in den Garten, sogar Michelle Obama und die Queen, Filmstars und Schriftsteller» – und stellte neben den beiden bereits Genannten unter anderem auch gleich die gärtnerischen Ambitionen von Tilda Swinton, Elfriede Jelinek, Prince Charles und Claus Peymann, Dennis Hopper und Martin Walser vor.
Der Garten ist damit heute nicht nur in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sondern auch wieder in ihren höchsten Kreisen. Das Gärtnern ist salonfähige Freizeitbeschäftigung. In einer Gesellschaft, in der Obst und Gemüse industriell gewonnen werden, ist der Ernteerfolg im eigenen Garten nebensächlich.
Interessant ist vor dem Hintergrund des permanenten Bedeutungswandels von Gärten die Renaissance temporärer Anlagen. In ihrer Geschichte wurden sie in Zeiten des Krieges auch in der Schweiz als Zwangsmassnahme verordnet, um Nahrungsmittel direkt dort, wo sie am dringendsten gebraucht wurden, zu produzieren: in den Städten. Der «Plan Wahlen» war ein Programm zur Förderung des innerschweizerischen Lebensmittelanbaus seit 1940, auch Anbauschlacht genannt. Er sah eine Steigerung der Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln vor und hatte zur Folge, dass auf allen grösseren, nicht bebauten Flächen Äcker und Gemüsegärten angelegt wurden. Alleine in Zürich führte dies zur Rodung von über 1000 Hektaren Wald und ihrer Umwandlung in Landwirtschaftsfläche. Mit Hilfe des Plans Wahlen wurden die Anbauflächen fast verdoppelt, weder Fussballplätze noch Parkanlagen blieben verschont.
Temporäre Gärten halten auch heute wieder verstärkt Einzug in Städte, wo sie Baulücken füllen, Brachen beleben oder Touristen anziehen. In Deutschlands neuen Bundesländern werden sie sogar zu Instrumenten städtebaulicher Entwicklung: In schrumpfenden Regionen ist die Bevölkerung aufgerufen, mit Hilfe temporärer Gärten, wie zum Beispiel im Projekt «400 qm Dessau», den Stadtumbau aktiv mitzugestalten.
Gärten haben aber auch immer noch klassische Gartenfunktionen – sie dienen der Repräsentation, der Meditation, der Erziehung und der Therapie. Sie sind Aufgabenfeld von Landschaftsarchitekten, Erholungsorte sowie Treffpunkte für Menschen. Sie verbessern die Siedlungsökologie und leisten ausserdem, besonders als Vertikal- und Dachgärten, einen Beitrag zur Verbesserung des städtischen Klimas.
anthos 1/2010 versucht, diese Bandbreite anzureissen – und beginnt mit dem Streben nach Glück und Erkenntnis im Garten.
Sabine Wolf
Inhalt
Anette Freytag
- Der Garten – Streben nach Glück und Erkenntnis
Andrea Fakler
- Küchengarten Kloster Einsiedeln
Gertraud Eibl
- Intervention hoch neun
Pascal Heyraud und Cécile Albana Presset
- Das Gelände vorbereiten
Eliza Kalata und Maja Kapellos
- Warschaus urbanes Biotop
Jean-Jacques Borgeaud
- Wiederentdecken des Vergessenen
Ute und Martin Studer
- Paradise now!
Andrea Christmann
- Die Schaugärten von Appeltern
Hikari Kikuchi und Irene Merlin
- Grüne Enklaven
Stéphane Collet
- Pflanzenwände, oder: Die Hybridisierung der Genres
Raphaël Dupraz
- Patio-Plaza, Vernier GE
Guido Hager
- «Grün tanken» – Garten J. in Berlin
Sabine Wolf
- Zwischendrin und zwischendurch: Temporäre Gärten
Anouk Vogel
- Spitzen-Garten – lang leben die Jahreszeiten!
Stefan Bernard
- Stabile Flüchtigkeit – ein politischer Garten
Robert Bloch
- Die Gesellschaft für Schülergärten Zürich
Rubriken
- Forum
- Schlaglichter
- Neue Leitung der Redaktionskommission anthos
- Wettbewerbe und Preise
- Agenda
- Literatur
- Schweizer Baumschulen
- Produkte und Dienstleistungen
- Markt
- Die Autoren
- Impressum
Der Garten – Streben nach Glück und Erkenntnis
(SUBTITLE) Alles Bizarre des Menschen und das Unstete, das Verstörte, das ihm eigen ist, liesse sich wohl in zwei Silben zusammenfassen: Garten. [Louis Aragon, 1926]
Was aber das Wesen der Gärten am meisten trifft, ist ihr illusionärer Charakter, das also, was man in gewissen Kontexten eine «Ideologie» nennt. Der Garten ist eine Täuschung, und zwar nicht nur in dem oberflächlichen Sinn, dass er Natur vortäuscht, etwa miniaturisierte Natur wie Fischteiche und Felsen, sondern in dem tieferen Sinn, dass er Landbesitz, also das Private, vortäuscht. Er täuscht vor, dass der ihn Besitzende auf eigener Scholle steht, dass er Wurzeln hat, dass es ein Stück Erde gibt, auf dem er für sich selbst steht. Der Garten täuscht also vor, dass «Cultiver son jardin» noch möglich ist, dass man also aus dem Gemeinen und Politischen ins Gesonderte und Private zurück kann, ohne dabei aus der Kultur herauszufallen. [Villem Flusser, 1993]
Der Garten ist nicht totzukriegen. Obwohl zu diesem Thema schon alles gesagt zu sein scheint, erfinden wir – zumindest in dieser unglaublich dehnbaren deutschen Sprache, die vor keinen noch so absurden Kombinationen zurückschreckt – regelmässig neue Ausdrücke, um zu beschreiben, was uns da an Gartenkreationen entgegenkommt: «Vertikale Gärten, Dachgärten, temporäre Gärten, Nutzgärten, Ziergärten, Familien- und Schrebergärten, Firmengärten, Wirtshausgärten, Kräuter- und Klostergärten, extensive Gärten, lineare Gärten und viele andere mehr» – diesen Spielarten des Gartens ist das vorliegende anthos gewidmet.[1] Seit der Gründung der Fachzeitschrift im Jahr 1962 bringt anthos etwa alle zwei bis drei Jahre ein Themenheft über Gärten heraus. In den 1960er und 1970er waren diese den «Landhausgärten », den «Ferienhausgärten» und in mehreren Ausgaben hintereinander den «Wohngärten» gewidmet – Gartenbegriffe einer Zeit, da die Welt der Gärten quasi zweigeteilt war: Die einen verrieten schon in ihrer Bezeichnung den Status, nach welchem sie geplant und auch bewertet werden wollten. Die anderen, mit der merkwürdigen Wortkombination «Wohn-Garten» versehenen Kreationen, wurden zum leidenschaftlichen Objekt einer als Wissenschaft betrieben Gartenarchitektur. Es ging dabei um die Untersuchung von «Nutzerbedürfnissen» als Motor für eine neue Gestaltung. Untersucht und diskutiert wurde die ökonomische und soziale Bedeutung von Gemüsegärten, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern von Reihenhäusern gemeinsam bestellt werden könnten; die Kombination von privaten Kleinstgärten und gemeinsam zu nutzendem «wohnungsnahem Freiraum»; die Frage, welche Materialien, welche Spielgeräte und welche Art von Räumen den Bedürfnissen von Kindern wirklich gerecht würden; und schliesslich wie Wohngärten zu gestalten seien, um die Hausfrau am Herd zeitlich zu entlasten, indem sie während des Kochens auch gleich die Kleinkinder vor dem Fenster beobachten könne.[2]
Verhübschung und Tiefenästhetisierung
Eine Generation später, in den 1990er Jahren, waren diese Fragen immer noch relevant, sie wurden aber anders und weniger geschlechtsspezifisch diskutiert. Der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit verschwand hinter einer seit der Postmoderne entwickelten Liebe für die Oberflächen der Kultur und ihre schöne Gestaltung. Der Diskurs zum Garten wurde verspielter und lehnte sich wieder mehr an den alten Mythos des Paradieses an, aber auch an Dionysos und Pan – und damit an die dunklen Seiten des Gartens, die zum Paradies gehören, wenn man einmal vom Baum der Erkenntnis genascht hat.[3] In diesem geschichtlichen Moment in der Diskussion über Gärten gab es eine Wegzweigung: Der eine Weg führte direkt zum Life-Style und zur Festivalisierung der Gartenkunst, der andere in eine Auseinandersetzung mit dem Garten als, wie es der Philosoph Michel Foucault formuliert hat, «kleinster Parzelle der Welt»[4], aus welcher die Totalität der Welt herausgelesen werden könne.
Zum ersten Gartenstrang – Lifestyle und Festivalisierung – passt auch der vom Philosophen Wolfgang Welsch Mitte der 1990er Jahre entwickelte Begriff der «Oberflächenästhetisierung». Am Beispiel der Verschönerungs- und Verhübschungsprozesse, die die meisten Innenstädte in Europa durchlaufen haben, beschrieb Welsch, wie «Lebenswelt» zum «Erlebnisraum » und «Erlebnis» überhaupt zur zentralen Motivation von Gestaltung wurde.[5]Parallel zu dieser Entwicklung verlief die Hochblüte der Festivalisierung der Gartenkultur[6] durch Aktionen wie die Temporären Gärten in Berlin, das Gartenfestival in Chaumontsur-Loire, das Cornerstone Festival of Gardens in California oder jüngst die Blumentopfaktion in der Zürcher Innenstadt.[7]
Was die Gestaltung von und Diskussion über Gärten betrifft, führte der zweite Strang in die Richtung der «Tiefenästhetisierung». Von ihr spricht Welsch dann, wenn aus ästhetischer Arbeit «Sensibilisierungseffekte » resultieren: «Eine wirklich ästhetisierte Kultur wäre sensibel für Differenzen und Ausschlüsse – und dies nicht nur in Bezug auf Formen der Kunst und Gestaltung, sondern ebenso im Alltag und gegenüber sozialen Lebensformen.»[8] Genau um diese Dimensionen geht es auch in Gärten: Um ästhetische Arbeit in der gestalterischen Auseinandersetzung mit Natur, um eine kulturelle Praxis bei der Nutzung des Gartens im Alltag – dabei spielen soziale Lebensformen eine genauso grosse Rolle wie die symbolische Bedeutung, die man dem Garten durch ein kollektives kulturelles Gedächtnis zuschreibt – und um die handwerkliche Gartenarbeit, also die täglich notwendige Auseinandersetzung mit Natur. Es geht um einen Zwischenraum an der Schwelle zur Wohnung oder zum Haus, um Eigenes und um Fremdes, um individuelle Mythologien und um stumme Biographien.
[9] Es geht um Natur und Ersatznatur, um leben und leben lassen. Um Zeit und um ein Verstehen von zyklischen Abläufen. Um Gartenarbeit, die einen immer stärkt, nie schwächt, und es geht um die Sorge für Pflanzen, die im besten Fall zur Sorge um uns selber werden kann.[10] Der Garten – und sei es nur ein Balkon – ist der Nukleus einer inzwischen höchst komplexen, mitunter komplizierten Beziehung zur Natur und zur Aussenwelt.
Der Garten als kulturelles Modell?
Wenn nun sowohl die realen Gärten in neuer Vielfalt in all den eingangs genannten Spielarten und Bezeichnungen auftauchen als auch das philosophische Interesse am Nachdenken über diese merkwürdigen Räume nicht nachlässt, muss die Frage aufgeworfen werden, inwiefern man Gärten heute als kulturelle Modelle der Gegenwart studieren kann? «Jeder Versuch, den Garten modellhaft zu beschreiben», konstatiert die Literaturwissenschaftlerin Gisela Steinlechner zu dieser Frage, «kann nur gelingen, wenn dieser auch als ein Wahrnehmungs- und Erfahrungsraum begriffen wird – in seinen sinnlichen, räumlichen und sozialen Dimensionen – und zum anderen auch als ein Generator und Mediator von Geschichten, Vorstellungen, Erinnerungen und Gefühlen. Gärten sind «privileged sites» nicht nur aufgrund ihrer Entbindung von elementaren Nutzfunktionen und dem damit einhergehenden Freiwerden für ästhetische Operationen, sondern sie sind auch privilegiert als Orte vielfältiger symbolischer Einschreibungen und kultureller Nutzungen.»[11] Unter diesen Gesichtspunkten müssen die im vorliegenden anthos-Heft vorgestellten Gärten betrachtet und bewertet werden, um den Spielarten solcher kultureller Modelle der Gegenwart auf die Spur zu kommen.
«Streben nach Glück und Erkenntnis»
Lässt der Philosoph Michael Hampe in seiner jüngst erschienenen philosophischen Annäherung an das Glück[12] als Romanfigur ausgerechnet einen Gärtner aufmarschieren – und zwar einen, der nach einer universitären Intrige die Welt der Wissenschaft verlassen hat, um als freier Philosoph und Gärtner einen Schlosspark zu betreuen – und gibt der Autor diesem dann die Stimme eines Mannes, der «ein glückliches, ja ideales Leben» führt, so muss dieser Kunstgriff ebenfalls im Kontext der Frage interpretiert werden, inwiefern der Garten für ein kulturelles Modell der Gegenwart steht? Die Romanfigur Kolk, der Gärtner-Philosoph, schätzt sich glücklich bei der Betrachtung und Mitwirkung am «Gedeihen der Pflanzen im Park» und mit der Möglichkeit zu studieren, «ohne in den verrückten Betrieb … einer Universität eingespannt zu sein und durch ihn über kurz oder lang geistig und moralisch ruiniert zu werden».[13] Aus dieser Position heraus präsentiert Kolk am Ende des Buches die Idee, dass wahres Glück sich dann einstelle, wenn man sich selbst «im Leben befindet» und dieses nicht von einem distanzierten, selbstgewählten Standpunkt aus betrachtet und beurteilt. Es gehe darum, in diesem Leben eine «eigene Stimme» zu entwickeln und zugleich die Differenzen der eigenen Stimme mit den anderen auszuhalten und so die Fremdheit zwischen sich und anderen Menschen anzuerkennen.[14] Eine solche «Kultur der Differenz» ist das auf anderem Wege erreichte Ergebnis, das auch Wolfgang Welsch mit seiner «Tiefenästhetisierung» erreichen möchte, und ihre Verknüpfung mit den Themen «Garten» und «Streben nach Glück und Erkenntnis» ist kein Zufall.
Wenn nun das erste anthos-Heft im 49. Jahr nach der Gründung der Zeitschrift wieder «Gärten» gewidmet ist, so könnte dies zur programmatischen Geste werden: ein Statement, durch die Beschäftigung mit dem Garten an den «Anfang» zurückzukehren und eine eigene Stimme zu entwickeln – eine, die einen Beitrag leistet zu einer Kultur der Differenz. Dies alles aus einer Haltung heraus, am Leben teilzunehmen, im Leben «mittendrin» zu sein. Welcher Ort eignete sich – sowohl symbolisch als auch praktisch – besser als Ausgangspunkt für solch ein schwieriges Unternehmen als der Garten?
Anmerkungen:
[01] Siehe die Ankündigung dieses anthos-Heftes.
[02] Siehe dazu Dieter Kienast, «Bemerkungen zum wohnungsnahen Freiraum», in: anthos, Nr. 4, 1979, S. 2–9, oder z.B. die Beiträge der anthos-Themenhefte der Jahre 1969 (Heft 3), 1971 (Heft 1), 1972 (Heft 4), 1973 (Heft 2), 1979 (Heft 1 und Heft 4) u.a.m.
[03] Siehe dazu Anette Freytag, «Der Garten als Gegenwelt. Geschichte und Zukunft», in: Marion Wohlleben (Hg.), Fremd, vertraut oder anders? Beiträge zu einem denkmaltheoretischen Diskurs, München-Berlin, 2009, S. 173–184.
[04] Michel Foucault, «Andere Räume», in: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Essays. Stuttgart, 1990, S. 34–46, hier S. 42 f.
[05] Wolfgang Welsch, «Ästhetisierungsprozesse – Phänomene, Unterscheidungen, Perspektiven», in: ders. Grenzgänge der Ästhetik, Stuttgart, 1996, S. 9–61, hier S. 10.
[06] Siehe dazu Christophe Girot, «Die unerträgliche Leichtigkeit des Gartens. Über temporäre Gärten und die Notwendigkeit einer neuen Haltung zur gestalteten Natur», in: Stadt und Grün, Nr. 3, 2006, S. 7–10.
[07] Siehe dazu Sabine Wolf und Bernd Schubert, «Festival Zürich», in: anthos, Nr. 2, 2009, S. 30–35.
[08] Welsch, 1996 (wie Anm. 7), S. 58.
[09] Siehe dazu Gisela Steinlechner, «Ablagerungen an der Schwelle. Der Garten als Deponie und Museum», in: Die Gartenkunst, Heft 2, 2003, S. 318–324.
[10] Zur Bedeutung von Gartenarbeit siehe: Anette Freytag, «Globale Gefahren – private Oasen? Der Garten als Trendsetter für die neue Sorge um uns selbst», in: BDLA (Hg.) System Landschaft. Zeitgenössische deutsche Landschaftsarchitektur, Basel-Boston-Berlin, 2009, S. 79–83.
[11] Gisela Steinlechner, «Garten-Räume. Erkundungen einer kulturellen Topographie», in: Die Gartenkunst, 19. Jahrgang, Heft 2, 2007, S. 245–251. Konzept der Gärten als „privileged sites“ zit. nach John Dixon Hunt, Greater Perfections. The Practice of Garden Theory, London, 2000, S. 10f.
[12] Michael Hampe, «Das vollkommene Leben. Vier Meditationen über das Glück», München, 2009.
[13] Ebenda, S. 36.
[14] Ebenda, S. 261–267.anthos, Do., 2010.02.25
25. Februar 2010 Anette Freytag