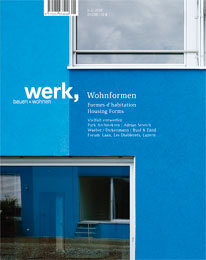Editorial
In der hiesigen Debatte um Wohnen und Siedlungsraum wird oft genug das «Urbane» gegen das «Ländliche» ausgespielt – eine Praxis in der Begründung von Architektur, die angesichts des Charakters unseres Siedlungsraums erstaunt. Es ist wohl nicht falsch, unsere Lebensgewohnheiten – mit Henry Lefèbvre und mit dem Studio Basel gesprochen – als «urban» zu bezeichnen. Das Gebiet der eigentlichen Stadt besetzt aber nur einen Bruchteil des bebauten Territoriums. Die bauliche Entwicklung der letzten 80 Jahre hat ausserhalb der historischen Zentren und ihrer unmittelbaren Erweiterungen nie wirkliche städtische Strukturen hervorgebracht. Die Attraktivität städtischer Formen muss, mit den Worten von Bart Lootsma also eher «mit deren ‚Knappheit’ zu tun haben, als mit ihrer absoluten, formalen, sozialen, politischen und ästhetischen Vorbildlichkeit.»
Welche Formen für das Wohnen drängen sich also auf für ein Siedeln an den Rändern der Zentren – oder ausserhalb davon, bei geringerer baulicher und perzeptorischer Dichte? Ist die dichte Stadt das einzige Gegenbild zur verstädterten Landschaft – und sind umgekehrt die Wohnformen von frei stehendem Mehr- oder Einfamilienhaus die einzigen ökonomisch und kulturell prägenden Typologien? Wenn dem so wäre, liesse sich der Wunsch nach einer Implementierung städtischer Typologien an der Peripherie ohne weiteres begrüssen.
Wir haben uns aber nach Alternativen umgeschaut und nach Wohnformen gesucht, die im vagen Umfeld Bedeutungen und Räume erzeugen, die eigenständige Identitäten ermöglichen und ein «verdichtetes Bauen» jenseits gängiger Schemata ernst nehmen. Das vorliegende Heft versucht die gestellte Frage von zwei Seiten her zu beantworten. Zum einen fanden wir Gebäude und Gebäudegruppen, die in ihrem Massstab zwischen Siedlung und Einzelhaus vermitteln. Bedingt durch Grösse und Gestalt vermögen diese auf ein sich schnell veränderndes und durch verschiedene Zielgruppen bestimmtes Marktumfeld mit stark differenzierten Wohnformen zu reagieren. Gleichzeitig versprechen sie durch typologischen Variantenreichtum ein lebendiges Wohnumfeld. Zum andern berichten wir über Bau- und Raumstrukturen, die sehr grosse Nutzungsflexibilität bieten – von der Werkstatt zu Büroräumen und über die loftartige Wohnung bis hin zum traditionell gekammerten Appartement ist fast jede Nutzung denkbar. Die Anpassungsfähigkeit solcher Strukturen trägt der sich stetig verändernden Nachfrage nach Wohnraum Rechnung und verspricht überdies eine nachhaltige Nutzung des Raums über gängige Amortisationszyklen hinaus.
Jenseits vom städtischen Block, von Wohnzeile, «Punktbau» und Einfamilienhaus sehen wir zwischen differenzierender Masskonfektion und funktional nicht determinierten Wohnformen spannende Impulse, um der Diskussion über ein Bauen «dort draussen» neue Möglichkeiten zu eröffnen.
Die Redaktion