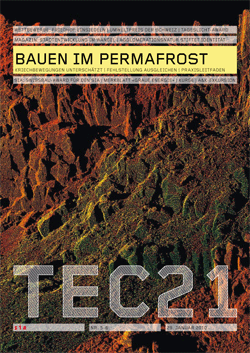Editorial
Ständig gefrorener Boden kommt auf rund 6 % der Fläche der Schweizer Alpen vor, hauptsächlich oberhalb von 2400 m ü. M. Die Kombination von Schneeschmelzwasser, hohen Lufttemperaturen und einer erhöhten Sonneneinstrahlung führt dazu, dass die oberste Schicht eines Permafrostbodens im Sommer auftaut. Die Mächtigkeit dieser Auftauschicht kann je nach Eisgehalt von Jahr zu Jahr variieren und beträgt in den Alpen zwischen 50 cm und 8 m. Das Abschmelzen des Eises dieser Schicht reduziert die Scherfestigkeit im Boden, was zu erhöhter Steinschlagaktivität, Oberflächenerosion und Baugrundverformungen führen kann. Hitzeperioden wie im Sommer 2003 oder 2006 sind für Lawinenverbauungen, Seilbahnmasten und Gebäude auf eishaltigen Böden besonders problematisch.
Als TEC21 im Jahr 2002 das Thema aufgriff, war das Auftauen des Permafrosts in der Öffentlichkeit wenig präsent. Mit Ausnahme der Richtlinie für Lawinenverbauungen im Permafrost (SLF/Buwal, 2000) gab es noch keine Richtlinien oder Empfehlungen für Bauten im alpinen Permafrost. Seither sind neue Erkenntnisse hinzugekommen. Im Herbst 2009 wurde ein praxisorientierter Leitfaden veröffentlicht, der den Entscheidungsträgern hilft, das Schadenpotenzial und die damit verbundenen Kosten und Risiken für Bauten in alpinen Permafrostgebieten einzuschätzen und zu senken. Die Dokumentation wird in Auszügen im Artikel «Leitfaden für die Praxis» vorgestellt. Auch wurde aus den Erfahrungen der letzten Jahre gelernt. 2002 hatten wir konstruktive und materialtechnologische Lösungen für die Erstellung von Verbauungen in kriechendem Permafrost vorgestellt (TEC21 17/2002, «Bauen auf bewegtem Boden»). Die Autorin dieses Artikels blickt in «Kriechbewegungen unterschätzt» (vgl. S. 24 ff.) zurück und stellt die Erkenntnisse der letzten Jahre vor.
Aus den Erfahrungen mit zwei Vorgängergebäuden, die abgebrochen werden mussten, lernten die Ingenieure in Ischgl (A). Um einen Gebäudekomplex an einem für solche Bauten geologisch ungeeigneten Standort vor Zwängungen und Verformungen zu schützen, wählten sie für die neuen Gebäude eine Dreipunktlagerung und installierten Hydraulikvorrichtungen in den Untergeschossen (vgl. «Fehlstellung ausgleichen»). Nach sechs Jahren zeigt sich, dass diese Lösung den Gebäuden zu einer längeren Lebensdauer verhelfen wird, als dies bei den Vorgängerbauten der Fall war.
Trotz den neuen Erkenntnissen auf dem Gebiet der Permafrostforschung gilt die Aussage unseres damaligen Redaktors und heutigen Korres-pondenten Aldo Rota aus dem Jahr 2002 (TEC21 Heft 17, S.3) weiterhin: «Natürlich sind alle Massnahmen Symptombekämpfung, denn die Ursachen entziehen sich unserem Zugriff.»
Daniela Dietsche, Clementine van Rooden
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Friedhof Einsiedeln | Umweltpreis der Schweiz | Tageslicht-Award
12 MAGAZIN
Stadtentwicklung im Wandel | Agglomerationsnatur stiftet Identität | Unsinnige Normen und Vorschriften | Energie- und wasserautarke Raumzelle | Einheimisches Buchenholz fördern | Start ins Jahr der Biodiversität| Funktionalität, Form und Landschaft
24 KRIECHBEWEGUNGEN UNTERSCHÄTZT
Marcia Phillips, Stefan Margreth
Jahrelang sammelte das SLF am Hang «Wisse Schijen» Erfahrungen mit flexiblen Schneenetzen. Jetzt lassen sich konkrete Aussagen machen.
27 FEHLSTELLUNG AUSGLEICHEN
Günther Gürtler
Mittels Dreipunktlagerung und Hydraulikpressen wird das Bergrestaurant auf dem Pardatschgrat in Österreich vor Zwängung und Verformung geschützt.
30 LEITFADEN FÜR DIE PRAXIS
Christian Bommer, Marcia Phillips
Seit Herbst 2009 hilft ein Leitfaden den Projektierenden, Gebirgsinfrastrukturen zu planen, auszuführen und zu unterhalten.
35 SIA
Swissbau-Award für den SIA | Neues Merkblatt «Graue Energie» | Kurse SIA-Form Deutschschweiz 1/2010 | A&K-Exkursion nach Athen | Publikationsverzeichnis 2010
41 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Kriechbewegungen unterschätzt
In der Lawinenanrisszone am «Wisse Schijen» in Randa (VS) wurden 1990 Schneenetze als Lawinenverbauung gebaut – ohne permafrostspezifische Vorstudien, da diese nicht üblich waren. Da die Geländeverschiebungen überdurchschnittlich gross sind, wird die Verbauung seit 2001 systematisch beobachtet. Nach nur 17 Jahren Betriebszeit mussten 2008 die Fundamente saniert werden. Heute würde man hier auf eine Verbauung verzichten und temporäre Massnahmen wie Lawinensprengungen einsetzen.
Seit 2001 untersucht das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) Lawinenverbauungen in der Lawinenanrisszone Wisse Schijen oberhalb Randa im Walliser Mattertal.[1] Der 40 ° steile und mit Felsen durchsetzte Hang besteht an der Oberfläche aus einer etwa 2.5 m mächtigen grobblockigen Schuttschicht (Gneis, Quarzit und Marmor), die sich in einem labilen Gleichgewicht befindet. Darunter befindet sich eine 0.5 m mächtige Schicht aus eisreichem Lockermaterial, die auf Permafrost-Fels liegt.
In den Jahren 1990 und 1991 wurden dort auf der Höhe zwischen 3010 und 3140 m ü. M. acht Schneenetzreihen erstellt. Sie ersetzen einen Auffangdamm, der die darunterliegenden Stahlschneebrücken vor Steinschlag schützte, aber wegen Geländeinstabilitäten zurückgebaut wurde. Die Netze verhindern das Anbrechen von Lawinen im obersten Anrissgebiet. Sie sind 24 bis 46 m lang und 4 m hoch (Abb. 1 und 2). Ihre Konstruktion ist flexibel und nimmt Geländeinstabilitäten auf. Die Pendelstützen sind auf Mikropfählen fundiert, die aus eingemörtelten 32-mm-GEWI-Ankerstäben und 76-mm-Stahlrohren bestehen. Zusätzlich ist der Kopf des Mikropfahles mit einem Betonfundament stabilisiert. Die Seilanker, mit Verankerungslängen von 5 m und im Abstand von 3.5 m berg- und talseitig versetzt, sind am Kopf durch je ein Betonfundament gesichert – der Fels wurde durchwegs erreicht. Da der Schutt in den obersten Metern Hohlräume enthält, war der Ankermörtelverbrauch mit etwa 30 kg pro Meter Ankerlänge sehr hoch.
Messen, Beobachten und Schlüsse ziehen
Ende der 1990er-Jahre stellte sich heraus, dass die Stabilitätsprobleme durch überdurchschnittlich rasch kriechenden Permafrost hervorgerufen wurden (vgl. nebenstehenden Kasten). Der Kanton Wallis liess daraufhin den Steilhang überwachen. Das SLF nahm Ingenieurvermessungen vor, liess drei 6 m lange Bohrlöcher abteufen und mit Instrumenten ausrüsten. Seit 2001 werden die Bodentemperaturen in den Bohrlöchern mittels Thermistoren stündlich gemessen. Die Hangdeformationen werden in denselben Bohrlöchern jährlich mittels Inklinometermessungen erfasst. Ausserdem werden jedes Jahr die 48 Fixpunkte auf den Fundamenten der Schneenetze vermessen, der Bauwerkszustand visuell beurteilt und dokumentiert. Die Beobachtungen erlauben, Änderungen der Geometrie und des Zustandes der Schneenetze zu quantifizieren und falls erforderlich entsprechende Massnahmen zu ergreifen.
Die Messungen zeigen, dass die Permafrosttemperaturen, die zwischen –0.5 und –1.5 °C schwanken, relativ hoch sind. Die Mächtigkeit der Auftauschicht beträgt gemäss den Temperaturmessungen rund 1.8 m – im Hitzesommer 2003 war sie etwa 0.1 m stärker. Die horizontalen Bohrlochdeformationen in Talrichtung sind in der Regel gleichmässig und kleiner als 5 cm pro Jahr. Eine Ausnahme war die in einem Bohrloch gemessene horizontale Verschiebung um 12.6 cm im Sommer 2003 (Abb. 4). Die Fundamente haben sich zwischen1999 und 2007 um 0.47 m horizontal verschoben und 0.38 m gesetzt. Auch hier waren die Verschiebungen, mit durchschnittlich 0.1 m allein im Sommer 2003, besonders stark. Diese ausgeprägten Kriech- und Setzungsbewegungen verursachten zunehmend Schäden an den Schneenetzen. Differentielle Verschiebungen der einzelnen Fundamente veränderten die ursprüngliche Geometrie ganzer Netzreihen (Abb. 1), was zu ungleichmässigen Belastungen und erhöhten Zwängungen führte. Infolge talseitigen Verkippens der Stützenfundamente kugelten die Gelenke der Pendelstützen aus, die Netze drohten einzustürzen. Ausserdem legte die Oberflächenerosion einzelne Fundamente frei, was die Stabilität der Mikropfähle reduziert und zum Versagen führen kann. Die Zustandsbewertung der Schneenetze gemäss der technischen Richtlinie 2 zeigte, dass nach einer Nutzungsdauer von nur 17 Jahren sechs Reihen in die Zustandsklasse 2 (schadhaft) und zwei Reihen in die Klasse 3 (schlecht) eingeordnet werden mussten. Die Lawinenverbauung wurde daraufhin 2008 saniert.
Nutzungsdauer verlängern
Um die Nutzungsdauer des Systems zu verlängern, wurden unter den Pendelstützen der «schlechten» Schneenetzreihen «schwimmende» Grundplatten aus Stahl anstelle der Mikropfahlfundamente installiert (Abb. 3). Die 90 × 90 cm grossen Grundplatten sind mit Drahtseilen an den berg- und den talseitigen Seilankern der Schneenetze befestigt. Sie reagieren weniger empfindlich auf Hangbewegungen und können normalerweise mit Seilzügen neuausgerichtet werden. Je nach Tragfähigkeit des Baugrundes werden solche Grundplatten in eine Ausgleichschicht aus Magerbeton eingebettet (z.B. bei wenig tragfähigen Böden) oder wie im vorliegenden Fall direkt auf die Bodenoberfläche gelegt. Gleichzeitig wurden zwei neue Bohrlöcher abgeteuft und instrumentiert, denn die alten waren infolge der Verformungen unbrauchbar geworden. Mit ihnen werden der Permafrost und die Hangstabilität weiterhin überwacht, um kritische Zustände zu erkennen.
Erfahrungen liefern neue Erkenntnisse
Die Probleme mit instabilen Permafrostbaugrund erkannte man erst mit der Überwachung von Gebieten wie am «Wisse Schijen». Die Projektierung der Schneenetze erfolgte darum 1990 ohne permafrostspezifische Vorstudien und Baumethoden. Dies war damals für Permafrostböden nicht üblich, da Leitfäden, aber auch die Erfahrung fehlten. Da die eingebauten Stützenfundamente nicht permafrostkonfrom sind, ist der Unterhaltsaufwand sehr hoch: Netze müssen neu ausgerichtet und Steine, die durch Steinschlag in die Netze fallen, in den Sommermonaten ausgeräumt werden. Fungierten die Netze nicht noch als Steinschlagschutz, würde man aus heutiger Sicht hier wahrscheinlich auf Lawinenverbauungen verzichten. Die angrenzende Lawinenanrisszone wurde jedenfalls nicht mit Stützwerken verbaut. Dort werden Lawinen mittels Sprengung künstlich ausgelöst. Gleichzeitig sind bauliche Verstärkungen der lawinengefährdeten Infrastrukturen im Tal geplant.
Das Fallbeispiel «Wisse Schijen» zeigt, wie wichtig eine detaillierte Vorstudie mit einer gründlichen Baugrunduntersuchung ist, die eine Abklärung des Permafrostvorkommens und des Eisgehalts umfasst. Dadurch kann die Dauerhaftigkeit von Bauwerken im Hochgebirge gewährleistet werden.[3]
[Marcia Phillips, Geografin und Leiterin der Gruppe Permafrost und Schneeklimatologie am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF)
Stefan Margreth, dipl. Bauing. ETH und Leiter der Gruppe Schutzmassnahmen am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF)]
Anmerkungen:
[01] P. Thalparpan, K. Moser, M. Phillips: Bauen auf bewegtem Boden. TEC21, 17/2002. S. 19–24
[02] S. Margreth: Lawinenverbau im Anbruchgebiet, Technische Richtlinie als Vollzugshilfe, Umwelt-Vollzug Nr. 0704. Bundesamt für Umwelt, Bern, WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF), Davos, 2007
[03] C. Bommer, M. Phillips, H.-R. Keusen, P. Teysseire: Bauen im Permafrost. Ein Leitfaden für die Praxis. Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL)/SLF, Birmensdorf, 2009TEC21, Fr., 2010.01.29
29. Januar 2010 Stefan Margreth, Marcia Phillips
Fehlstellung ausgleichen
Ein Gebäude, das im Permafrost errichtet wird, ist gezwungen, die Bewegungen des Untergrunds mitzumachen. Grosse Verformungen sind die Folge. Am Pardatschgrat im österreichischen Ischgl wurden zwei zu starre Vorgängerbauten abgebrochen, bevor mit einer Dreipunktlagerung eine dauerhaft zufriedenstellende Lösung für das Bergrestaurant gefunden wurde.
Das Bergrestaurant am Pardatschgrat in Ischgl steht auf 2620 m ü. M. im Permafrost. Der Pardatschgrat wird durch mehrere Bergblöcke gebildet. In Kluftgassen zwischen diesen Bergblöcken kommt es zu Frost-Tau-Wechseln und damit zu Hebungen bzw. Senkungen der Bergoberfläche, die bis zu 4 cm pro Jahr betragen können.
Starre Vorgängerbauten
Das 1972 errichtete Bergrestaurant wurde infolge von Setzungsrissen 1985 durch ein neues ersetzt. Für dieses zweite Gebäude wurde anstelle der Streifenfundamente eine steifere Unterkonstruktion gewählt: Das Kellergeschoss wurde als Kasten in Stahlbeton mit massiver Bodenplatte und Stahlbetonwänden ausgeführt. Die oberirdische Tragkonstruktion bestand aus Fertigteilstützen, -unterzügen und Elementdecken. Die Setzungen des Untergrundes führten jedoch weiterhin zu Zwängungskräften im Gebäude. Risse und Verformungen waren die Folge, was die Gebrauchstauglichkeit einschränkte. Die Tragsicherheitsanforderungen konnten zwar durch Sanierungsmassnahmen kurzfristig erreicht werden, ein grösserer Bauaufschub war aus Sicherheitsgründen aber nicht mehr vertretbar.
Aus geologischer Sicht ist der Standort nicht zum Bauen in konventioneller Bauweise geeignet. Ein Neubau an einem anderen Standort kam nicht in Frage, deshalb musste eine Lösung gefunden werden, die Gebäudeschäden aus Fundamentsetzungen verhindert.
Zwei Baukörper im Permafrost
Auf der Grundlage jahrelanger geometrischer Vermessungen entschied man sich für zwei getrennte Baukörper: ein Restaurant und ein kleineres Nebengebäude. Die architektonischen Vorgaben an das Restaurant waren ein um 14° geneigter Hauptträger, eine um 6° nach aussen geneigte Fassade und ein um 6° geneigtes Dach über einem konischen Grundriss (Abb. 5). Das dreigeschossige Restaurantgebäude ist ca. 60 m lang, 16 bis 25 m breit und die Fassade auf drei Seiten verglast. Die Stahlkonstruktion mit 4.60 m Rastermass wurde als geschraubte Konstruktion ausgebildet, die Decken mit Trapezblech und Überbeton errichtet und die Dachplatte mit 14 cm dicken Brettschichtholzplatten ausgeführt. Im Nebengebäude aus Stahlbeton befinden sich vor allem Infrastrukturanlagen und Personalunterkünfte. Es ist auf drei Stahlbetonsäulen gelagert, die auf drei Einzelfundamenten gegründet sind (Abb. 6). Bei den Stahlbetonsäulen wurden Nischen für die Justiervorgänge ausgebildet. Die Dachplatte wurde ebenfalls mit Brettschichtholz ausgeführt. Die beiden Gebäude sind durch eine 30 cm dicke Dilatationsfuge vollständig voneinander getrennt. Das grosse Mass wurde durch die zu erwartenden starken Setzungen des Untergrunds notwendig (Abb. 4). Gebäudeübergänge wie Korridore oder die Dachhaut sind mit einer einfachen Riffelblechkonstruktion überbrückt.
Justierbare Dreipunktlagerung als Lösung
Von Mai bis November 2004 wurden die Gebäude errichtet. Setzungen der Fundamente sind aufgrund der geologischen Situation nicht zu verhindern. Daher wurden beide Gebäude auf je drei Einzelfundamenten gelagert. Die Dreipunktlagerung lässt Fundamentsetzungen zu, ohne das darüberliegende Bauwerk durch Zwängungskräfte zu belastenund zu verformen. Die drei Stahlbetonfundamente des Restaurants wurden mit 7.5 m Seitenlänge konstruiert und die Lager, auf denen die Tragkonstruktion punktförmig aufliegt, als Stahl-Kalottenlager gelenkig ausgeführt (Abb. 5). Die Tragkonstruktion senkt sich analog der Fundamentsetzung, bleibt aber in sich ebenflächig und bewirkt weder eine Verdrehung in der Ebene noch eine Verwindung der Struktur. Das Tragwerk kann mit hydraulischen Pressen angehoben und das erforderliche Niveau der Strukturebene wiederhergestellt werden. Ein erprobtes Verfahren, wie es zum Beispiel im Brückenbau angewendet wird.
Das Setzungsmass wird durch Unterlegen von Stahlplatten ausgeglichen. Als Voraussetzung für die erforderliche Nachstellbarkeit wurden gut zugängliche Untergeschosse angeordnet, die zur Verminderung des Wärmeeintrags in den Untergrund nicht beheizbar sind und direkte Verbindung zur Aussenluft erhalten.
Bereits während der Bauphase wurde das verglaste Restaurant erstmals angehoben, da eines der drei Fundamente nach fünf Monaten Bauzeit schon 5 cm abgesunken war. Der eigentliche Hebevorgang dauert eine Stunde, und die Anhebelast wird durch eine Ölhydraulikpresse erzeugt.
Sechs Jahre schadenfrei in Bewegung
Sechs Jahre nach der Fertigstellung zeigt sich, dass das Tragwerkskonzept eine erfolgreiche Lösung ist und sämtliche Erwartungen bzw. Anforderungen erfüllt. Die aufgetretenen Hangbewegungen konnten bisher durch die Tragkonstruktion schadenfrei aufgenommen werden. Die unterschiedlichen Setzungen der Fundamente bewirken entsprechende Senkungen der Geschossdecken, die Solllage der Geschosse konnte aber durch hydraulisches Anheben ausgeglichen werden (Abb. 2, 3 und 4). Ein Fundament setzte sich 30 cm in sechs Jahren, die anderen in der Grössenordnung von 3 bis 10 cm. Trotzdem ist das Objekt in seiner Gebrauchstauglichkeit durch jährliche Justiervorgänge in plangemässer Niveaulage. In den Spritzbeton- und Winkelstützmauerwänden der Kellergeschosse sind zwar Rissbildungen wahrscheinlich. Die Gründungsmassnahmen und die Nachstellbarkeit der Fundamente lassen jedoch erwarten, dass dieser Neubau wenigstens einige Jahrzehnte schadenfrei funktionstüchtig bleibt.TEC21, Fr., 2010.01.29
29. Januar 2010 Günther Gürtler