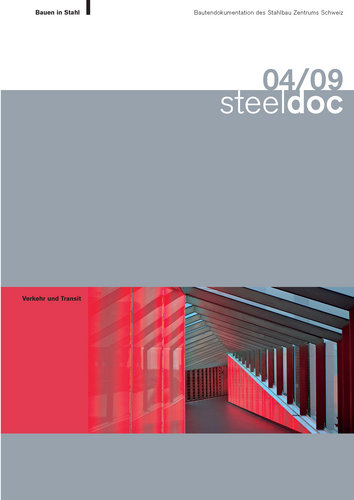Editorial
Der Weg ist das Ziel – schon immer waren Verkehrswege und Transitzonen wichtige Bauwerke, die eine Stadt oder eine Landschaft prägen. Sie bleiben in Erinnerung, weil sie den Reisenden dorthin führen, wo er hin will, oder ihm das Warten, Parkieren oder das Wiedersehen ermöglichen. Ein Verkehrsbauwerk hat deshalb nicht nur eine praktische Funktion, sondern auch eine wegweisende, welche die Orientierung und Wiedererkennbarkeit fordert. Im vorliegenden Steeldoc geht es also um diese meist leichtfüssigen aber expressiven Brücken, Dächer, Hallen und Wege.
Die vier Schweizer Beispiele sind allesamt mit dem Schweizer Stahlbaupreis Prix Acier 2009 oder einer Anerkennung ausgezeichnet worden. Die Passerelle über die Verzasca im Tessin ist exemplarisch dafür, wie mit möglichst wenig Material und einer einfachen, aber eleganten Konstruktion ein Brückenbauwerk mit ausgeprägtem, individuellen Charakter entsteht, das sich sensibel in eine Naturlandschaft einfügt. Die Welle von Bern ist das neue Tor zur Bundeshauptstadt. Der hochtransparente und leicht geschwungene Baldachin überdacht einen Grossteil eines verkehrsintensiven Platzes und schafft damit eine grosszügige, lichte Flaniermeile. Mit einer Anerkennung des Prix Acier gewürdigt wurde eine kleine, gedeckte Fussgängerbrücke in Liverpool. Das komplexe, facettierte Stahltragwerk wurde im Schweizer Werk entworfen und gefertigt und nach einem spektakulären Transport in der City von Liverpool montiert – ein Beispiel für die intelligente Bauweise in hochfrequentierten Zonen. Die Endstation der Glattalbahn am Zürcher Flughafen ist ein Bauwerk mit hohem wegweisenden Charakter. Folgt man den skulpturalen Grossformen der drei schwebenden Dächer, gelangt man automatisch ins Hauptgebäude des Flughafens.
Ein leuchtendes Beispiel für ein attraktives Parking-Dach steht am Flughafen im österreichischen Linz. Schon von weitem ist die zeltartig aufgespannte Leichtkonstruktion zu erkennen. Nachts leuchtet der gesamte Baukörper wie ein Kunstwerk, was angesichts der profanen Nutzung für Autos fast vermessen scheint. Doch auch ein Parkhaus gehört zur repräsentativen Ausstrahlung eines Stadtflughafens, was hier auf eine poetische Weise gelungen ist. Als letztes Projekt stellen wir die neue Empfangshalle am Pariser Flughafen Charles de Gaulle vor. Das ursprüngliche Bauwerk in Beton war 2004 eingestürzt – heute erhebt sich eine leichte, lichtdurchflutete Stahlkonstruktion über den Fluggästen. Das Bauwerk ist exemplarisch für die modulare, leichte Bauweise in Stahl, welche auch den schalenartigen Charakter der alten Halle zu neuem Leben erweckt.
Wie immer stellen wir die Projekte bis ins Detail vor, damit ersichtlich wird, dass Bauen mit Stahl ganz einfach ist. Wir wünschen viel Vergnügen und Einsicht beim Studium der nachfolgenden Seiten von Steeldoc.
Inhalt
03 Editorial
04 Fussgängerbrücke über die Verzasca, Tenero-Contra/Gordola
Leichtfüssiger Sprung über alpines Gewässer
10 Baldachin, Bahnhofplatz Bern
Gläserne Welle
14 Fussgängerbrücke Paradise Street, Liverpool
Verwinkelter Eingang ins Paradies
18 Perrondächer Glattalbahn, Flughafen Zürich
Geflügelte Schwere
22 Parkdeck, Flughafen Linz
Leuchtendes Zeltdach
26 Terminal 2E, Flughafen Paris-Charles de Gaulle
Hell und leicht
31 Impressum
Gläserne Welle
(SUBTITLE) Baldachin Bahnhofplatz Bern
Eine gläserne Welle überdacht den neuen Bahnhofplatz von Bern. Der Baldachin überspannt die Haltestellen von Tram und Bus sowie einen grossen Teil des öffentlichen Platzes, der als neues Tor zur Altstadt an städtischer Prägnanz gewonnen hat. Unter der eleganten, leichten und transparenten Grossform, bleibt der Blick auf die historischen Fassaden der Stadt erhalten.
Nach jahrelangem Ringen hat die Bundeshauptstadt einen neuen überdachten Bahnhofplatz. Aus dem chaotischen Verkehrsknotenpunkt im Herzen von Bern ist eine weiträumige und lichte Flaniermeile geworden. Das Dach gliedert die Fläche, die nun hauptsächlich Platz ist und den Verkehr aus ihrem Mittelpunkt an den Rand gedrängt hat. Die Heiliggeistkirche – das vertikale Prunkstück am Bahnhofplatz – wird durch die Weichheit und Transparenz des Daches nicht bedrängt, sondern umschmeichelt. Von jedem Punkt des Platzes aus, ist ihr hoher Glockenturm zu erkennen. Aus der Distanz betrachtet bietet der Baldachin vier unterschiedliche Ansichten: von der Spitalgasse aus nimmt man nur eine fein geschwungene Linie wahr. Zurückhaltend wirkt er aus der Richtung des Bahnhofs. Überraschend ist die Perspektive aus der Christoffelgasse, da hier die Stahlkonstruktion mit den am tiefsten Punkt zusammenlaufenden und frei über den Platz hängenden Trägern dominiert. Einer Metapher gleich schwingt sich der Baldachin vom Bubenbergplatz aus gesehen an der Stelle, an welcher das historische Tor gestanden hatte, von drei Metern auf seine maximale Höhe von zehn Metern empor.
Geschichtete Tragstruktur
Der Baldachin ruht auf einer Tragstruktur aus sechs Kastenträgern auf insgesamt zwölf eingespannten Stahlstützen. In Längsrichtung verlaufen die zweifach gekrümmten Sekundärträger, welche die Dachform alsWelle definieren. Zwischen diesen Sekundärträgern liegen Tertiärträger, an welchen die Punkthalterungen für insgesamt 528 Glasplatten, alle mit unterschiedlicher Geometrie, angebracht sind. Die Gläser werden von oben gehalten und verbinden sich zu einer hauchdünnen, geschlossenen Membran. Die mehrfache Krümmung der Dachfläche stellte hohe Anforderungen an die Präzision der Ausführung während Produktion, Transport und Montage.
Haut aus Glas
Die gläserne Haut prägt in ihrer Homogenität den überspannten städtischen Raum. Da die Tragstruktur des Baldachins komplett über der Glasfläche liegt, verbinden sich die Glasscheiben zu einer Membran von beachtlicher Transparenz. Für die Glasaufhängung wurden Bügel an die vorgebohrten Tertiärträger geschraubt. Um die ideale Anpassung an die verschiedenen Winkel der Dachneigungen aufzunehmen wurde eine Konsole mit Gelenk gefertigt. Ein feiner Siebdruck auf der Glasunterseite mit 25 Prozent Punktanteil dient der Entspiegelung der Glasunterseite sowie dem sommerlichen Wärmeschutz. Gleichzeitig wird damit die gewünschteTransparenz erhalten.
Präzision in der Ausführung
Mit der Montage der Stahlkonstruktion wurde von der Mitte aus begonnen, zuerst Richtung Süden und dann Richtung Bahnhof. Um den täglichen Trambetrieb uneingeschränkt aufrecht zu erhalten sowie für die allgemeine Sicherheit wurde eine fixe Arbeitsbühne gebaut, welche in Stufen dem Verlauf des Baldachins folgte. Die ersten drei Primärträger wurden von der Bühne aus auf die Stützen gehoben. Die Sekundär- und Tertiärträger wurden danach mit Baukranen sukzessive eingebaut und mit Montagelaschen fixiert. Nach dem Ausrichten wurden die Sekundärträger biegesteif an die Primärträger verschweisst. Die Montage der bis zu 400 Kilogramm schweren Gläser erfolgte mit einem Rollwagen mit Hydraulikzylinder. Dadurch konnten die Scheiben behutsam in die Halterungen eingefahren werden.
Prix Acier 2009
Das Bauwerk überzeugt durch seine zurückhaltend elegante Form und die äusserst filigrane und transparente Konstruktion in einem bedeutenden, historischen Kontext der Bundeshauptstadt. Die präzise und auf das Wesentliche reduzierte Detaillierung des Stahlbaus und seine weiche Gesamtform nehmen Bezug auf die Funktion des Platzes als hochfrequentierter, öffentlicher Ort und als einladende Geste für Ankömmlinge und Stadtbürger. Das Bauwerk wurde deshalb mit dem Schweizer Stahlbaupreis Prix Acier 2009 ausgezeichnet.Steeldoc, Mo., 2010.01.11
11. Januar 2010 Evelyn C. Frisch
verknüpfte Bauwerke
Baldachin Bahnhofplatz Bern
Geflügelte Schwere
(SUBTITLE) Perrondächer Glattalbahn, Flughafen Zürich
In einer grosszügigen Geste spannen sich drei weit auskragende Dachflügel über die Haltestelle der Glattalbahn am Zürcher Flughafen. In einer facettenreichen Verschränkung von Form und Licht begleiten sie den Reisenden auf seinem Weg bis zum Flughafeneingang. Dem Ort verleihen die körperhaften Kragarme ein spannungsvolles, urbanes Gesicht.
Steigt man am Flughafen Zürich aus dem Tram, erscheint das neue Perrondach angenehm unaufdringlich. Als schmaler Streifen erstreckt es sich zwischen Strassenstützmauer und Bahnsteigkante relativ niedrig über den Reisenden und schützt sie dadurch vor Regen und Schnee. Seitliche Stützen fehlen und der Blick wendet sich ungehindert nach links auf den weiträumigen Platz und zu dem in einer einladenden Geste schräg hochgeklappten und im Grundriss kreissegmentförmig geschwungenen älteren Dach über den Bushaltestellen. Grosszügig ist diese Anlage und sie weist ungewohnte Dimensionen auf, die zu einem internationalen Flughafen passen. Ein weiterer schmaler Dachstreifen führt quer über die Schienen unter das bestehende Dach zum Eingang in den Flughafen. Erst jetzt, wenn man sich umdreht, erkennt man die wahre Grösse der neuen Konstruktionen: Die scheinbare Leichtigkeit der durchsichtigen Dachflächen wird möglich dank mächtiger stählerner Kastenträger, die bei den Perrons jeweils seitlich über den Dachkanten liegen und daher von unten wenig auffallen. Vom Flughafengebäude aus gesehen verbindet sich die Anlage mit der langen Strassenstützmauer und rahmt ihre zentrale, nach Kloten hin führende Öffnung ein.
Zum einen ist die Konstruktion äusserst pragmatisch, ihre Grundfläche ist minimiert und reicht gerade aus, um Menschen im Trockenen vom Bahnsteig in den Flughafen zu führen. Diese vordergründige Bescheidenheit steht in einer Spannung zu den gewaltigen Auskragungen der Dachträger von über dreissig Metern. Was aus der Fernsicht den Massstab der umliegenden Bauwerke aufnimmt, sorgt aus der Nähe paradoxerweise dafür, dass die weitgespannten Dächer weit weniger präsent sind, als wenn sie durch sich wiederholende Stützenfolgen ständige Aufmerksamkeit einfordern würden.
Auskragende Kastenträger aus Stahl
Das Tragwerk besteht aus Stahl. Ein grosser Vorteil dieser Bauweise ist die Vorfertigung im Werk und die kurze Montagezeit auf dem durch den ständigen Bus- und Fussgängerverkehr stark belebten Areal. Das Gewicht des Stahlbaus ist vergleichsweise gering, daher genügen einfache Fundationen im teilweise unterbauten Gebiet; auch passen die Stahlträger gut zum bestehenden Bushofdach. Die beiden Perrondächer tragen an den zur Mitte hin liegenden Enden ihrer Auskragungen den dritten, zu ihnen quer verlaufenden Träger. Die Lager dieses Trägers sind jeweils in eine Richtung beweglich, um gegenseitige Zwängungen aus Temperaturdehnungen zu vermeiden. Der dritte Träger wirkt statisch als einseitig eingespannter Balken mit einfachem Auflager.
Bemerkenswert ist die technisch wie architektonisch sorgfältige Detaillierung der Konstruktion. Die Blechstärke der geschweissten Hohlkastenträger wurde aus gestalterischen Gründen so gewählt, dass die beim Schweissen unvermeidliche Beulung der Stehbleche gering bleibt. Weil die Aussteifungsrippen im Innern der Kasten im Abstand der Querträger angeordnet sind, gibt das Bild der Beulungen die Ordnung der Sekundärstruktur wieder. Die vom Hauptträger «figurativ » abgesetzten Querträger dienen neben ihrer Tragfunktion auch als Wasserrinnen, überdies versteifen sie als Elemente eines liegenden Vierendeelträgers die schlanken Hauptträger gegen horizontale Windeinwirkungen. Die nicht direkt sichtbare Dachhaut besteht aus kostengünstigen transluzentenWellplatten; die Untersicht und eigentlich wahrnehmbare Dachfläche wird aus ebenfalls lichtdurchlässigen, von den Querträgern abgehängten, tuchartigen Streckmetalltafeln gebildet.
Anerkennung Prix Acier 2009
Die Überdachung ergänzt das Gesamterscheinungsbild des Flughafeneingangs mit dem Bushof (Prix Acier 2005) durch eine erkennbare Eigenständigkeit. Der skulpturale Charakter und eine gewisse schlichte Schwere kontrastieren mit den extremen Auskragungen der Flügel und verdeutlichen damit, dass hier Stahl trägt. Dem Bushofdach ordnet sich diese Dachstruktur zwar unter, bildet jedoch als Bindeglied zur gegenüberliegenden massiven Stützmauer der Strasse eine angemessene repräsentative Identität. Die Jury des Prix Acier 2009 würdigte die einprägsame formale Umsetzung dieser grosszügigen, körperhaften Konstruktion, welche die Statik spüren lässt und für eine hohe Aufenthaltsqualität für Wartende sorgt.Steeldoc, Mo., 2010.01.11
11. Januar 2010 Jürg Conzett